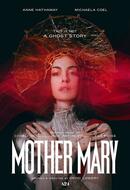The Awakening: Geister der Vergangenheit – Kritik
Ein erfrischend altmodischer Gruselfilm.

Etwa in der Mitte des Films gibt es eine Szene, in der die Protagonistin Florence Cathcart (Rebecca Hall) in einem heruntergekommenen Zimmer ein großes Puppenhaus entdeckt. Beim Blick durch dessen Fenster entdeckt sie in aufeinanderfolgenden Räumen eine Nachstellung verschiedener Geschehnisse, wie sie sich bisher im Film zugetragen haben. Im letzten Raum sieht sie quasi sich selbst in Form einer Puppe, die ebenfalls durch die Fenster eines weiteren miniaturisierten Puppenhauses blickt. Und hinter dieser Puppe steht jemand. Diese Szene, die einen der grusligen Höhepunkte des Films bietet, steht exemplarisch für die Art des Schreckens, die Nick Murphys The Awakening prägt. Es geht um die unheimliche Atmosphäre und den sich heranschleichenden Schauer sowie die Verunsicherung der eigenen Position.
Zunächst wird Florence als eine selbstbewusste und zutiefst rationale junge Frau im Großbritannien Anfang der 1920er vorgestellt. Zu dieser Zeit sind die Themen Geister und Jenseits gesellschaftsumspannend. Die Bevölkerung leidet noch stark am Trauma des Ersten Weltkrieges. Nahezu jeder hat einen Verlust zu beklagen, und diejenigen Soldaten, die heil aus dem Krieg zurückgekehrt sind, fühlen sich schuldig gegenüber den gefallenen Kameraden. Entsprechend haben Menschen mit angeblichen übersinnlichen Fähigkeiten, die behaupten, mit den Verstorbenen Kontakt aufnehmen zu können, Hochkonjunktur. Florence, hauptberuflich Autorin, hat es sich zur Aufgabe gemacht, jene als Scharlatane aufliegen zu lassen. Da sie mittlerweile als eine Art Expertin in der Lösung paranormaler Phänomene gilt, wendet sich der Internatslehrer Robert Mallory (Dominic West) Hilfe suchend an sie. An seiner Schule treibe ein echter Geist sein Unwesen.

The Awakening ist in mehrfacher Hinsicht wunderbar altmodisch. Zunächst einmal in der Erzeugung von Unheimlichkeit durch Atmosphäre. Der modernen Horrorstrategie, die Schockmoment auf Schockmoment folgen lässt, erteilt er eine Absage zugunsten der erfrischenden Wiederbelebung des stilsicheren klassischen Grusels. Der Film nimmt sich viel Zeit, die übersinnliche Ebene auf der Dialogebene vorzubereiten. Bevor er den ersten visuellen Schreckmoment auffährt, wird von Geistererscheinungen in ausgiebigen Unterhaltungen und Befragungen erzählt. Wenn es dann so weit ist und der Zuschauer selbst an den unheimlichen Begegnungen teilhaben darf, geschieht dies meist in angenehm unaufgeregter, aber effektiver Weise: Mal schaut ein Auge durch ein Loch in der Wand, mal huschen Schatten im Rücken der Protagonisten vorbei, mal befinden sich plötzlich Gegenstände an Orten, wo sie nicht sein sollten.

Unterstützt wird die klassische Atmosphäre der Unheimlichkeit vor allem auf der Bildebene. Viele großräumige und lang andauernde Einstellungen vermeiden jene Hektik, die aktuelle Horrorfilme so oft prägt. Ein kalter, trister Grau-Braun-Ton dominiert die Farbgebung nicht nur bei jenen Szenen, die in den alten Gemäuern des Internats mit seinen sich windenden Treppen und Korridoren spielen, und korrespondiert gut mit dem verhaltenen und bedachten Sprachduktus der Figuren.
Schön ist auch, wie der aufgeklärte Rationalismus mit seinem Glauben an die Beweiskraft der Naturwissenschaft, der das geistige Klima des beginnenden 20. Jahrhunderts prägte, zunächst gegen das Übersinnliche ausgespielt wird. Florence versucht mit Instrumenten von aus heutiger Sicht höchst nostalgischem Charme dem vermeintlichen Geist das Handwerk zu legen. Wenn der ganze Raum mit Fotoapparaten ausgestattet ist, überall die Stolperdrähte gespannt und die Pulver aus den schrulligen Fläschchen am Boden verteilt sind, um chemische Rückstände zu erfassen und mögliche Fußspuren festzuhalten, scheint man auch als Zuschauer erst mal auf der sicheren Seite. Umso größer dann die Verunsicherung, wenn sich Florence’ Vorkehrungen angesichts des sich entwickelnden Szenarios zunehmend als unwirksam erweisen.

Im Laufe der Handlung ist Florence nicht nur gezwungen, ihre Sicht auf die Dinge zu überdenken, sondern muss sich auch über sich selbst Gedanken machen. Hier versucht The Awakening doch noch aktuelle Tendenzen zu integrieren, mit denen den anderen Mysterygeschichten der vergangenen Jahre durch teils recht erzwungene, mittlerweile nicht mehr ganz so unerwartete letzte Wendungen ein zusätzlicher Kick gegeben werden sollte. Leider verpufft gerade dadurch nicht selten ein lange Zeit spannender Plot in Abstrusität. So schlimm kommt es in Nick Murphys Film keineswegs. Der finale Umschlagpunkt ist zwar hier ebenso keine zwingende Konsequenz des bisher etablierten Handlungsstrangs, lässt sich aber letztlich doch schlüssig in die Gesamterzählung integrieren. Ob man diese Pointe schätzt oder nicht, jedenfalls tut sie dem Genuss des gesetzten, aber wirkungsvollen Spannungsbogens, den der Film aufzubauen vermochte, keinen Abbruch.
Neue Kritiken

Gavagai

Stille Beobachter

Im Rosengarten

Die endlose Nacht
Trailer zu „The Awakening: Geister der Vergangenheit“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.