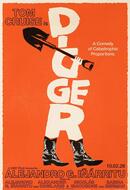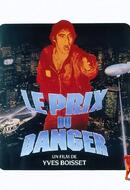Much Ado About Nothing – Kritik
Was du letzte Nacht getan oder nicht getan hast: Alejandro Fernández Almendras begleitet einen jungen Chilenen durch einen Partyabend und seine juristischen Folgen – und stellt durch seine narrative Reduktion die entscheidenden Fragen.

Eigentlich geht Vicente (Agustín Silva) nur durch seine Wohnung und macht sich für einen kurzen Strandausflug fertig, aber die bedrohlichen Hardrockbeats auf dem Soundtrack machen direkt deutlich, dass er geradewegs in sein Verderben laufen wird. Musikalisches Foreshadowing à la Funny Games, und tatsächlich gemahnt Alejandro Fernández Almendras’ Much Ado About Nothing (Aquí no ha pasado nada) mit der betont banalen Inszenierung eines Schockmoments und der präzisen Sezierung seiner Konsequenzen an Haneke, einen Haneke mit Handkamera allerdings. Ganz nah sind wir Vicente in jener fatalen Nacht, die zum Gegenstand von Much Ado About Nothing wird und die, wie so viele fatale Nächte, mit einer Zufallsbegegnung beginnt: Vicente lernt am Strand ein lesbisches Pärchen in offener Beziehung kennen, flirtet ein bisschen mit beiden, wird auf eine Party eingeladen, von der man irgendwann aufbricht, um weiterzuziehen. Läuft, der Abend. Auch der Alkohol.
Flüchtiger Moment, fatale Folgen

Mitunter nervt die aufdringliche Kameraarbeit hier etwas; hektisch geht es durch die Partycrowd, und wenn es intim wird, sprengen die Gesichter schon mal den unruhigen Rahmen, alles total in the moment, dazu ständige Schärfenverschiebungen, der Verstand im Rausch, schon klar. Dass das aber kein bloßes show-off ist, sondern ganz im Dienste der erzählten Geschichte steht, das ist spätestens klar, als Almendras die Unmittelbarkeit zugunsten einer distanzierteren Herangehensweise aufgibt, sobald es Tag wird. Denn auch darum geht es in Much Ado About Nothing: um den Rausch der Nacht, um ihre Unschärfen, um die Flüchtigkeit des Moments und die erbarmungslose Nüchternheit, mit der ein solcher Moment aufgearbeitet werden muss, wenn er Folgen hat.
Der Moment: Das Auto der Partygesellschaft prallt auf dem Weg von einer Location zur nächsten auf irgendeinen Widerstand. Vicente bekommt davon kaum was mit, ist auf der Rückbank vertieft ins Geknutsche mit Francisca (Geraldine Neary), und weil wir ganz bei ihm sind, bleibt auch für uns der eigentliche Schock unsichtbar. Irgendwann vorher saß auch Vicente mal am Steuer, aber wer wird schon am nächsten Morgen noch wissen, wann genau das war? An diesem nächsten Morgen sitzt Vicente allerdings vor einem Staatsanwalt und muss Fragen beantworten. Ein paar Stunden vorher hatten ihn seine neuen „Freunde“ abgeholt, um mit ihm zur Polizei zu fahren. Es gebe ein Problem. Aber es gibt nicht nur ein Problem, es gibt einen Toten. Und deshalb schleichen sich in Vicentes Aussage nicht nur katerbedingte Ungenauigkeiten, sondern auch panische Kompromisse zwischen Erinnerung und Strategie ein – zumal er allmählich gewahr wird, dass er von den anderen zum Sündenbock gemacht werden soll.
Belagerte Wahrheit

Es geht also mal wieder um die Wahrheit, die alte Schlawinerin. Von zwei Seiten sieht sie sich in Much Ado About Nothing belagert. Vicentes Vater, selbst Rechtsanwalt, versucht seinem Sohn verzweifelt klarzumachen, dass es niemanden interessiert, ob er unschuldig ist, sondern nur, ob und wie er das beweisen kann. Wahrheit als juridisches Procedere. Andererseits ist der zweite als Steuermann Verdächtigte der Sohn eines einflussreichen Politikers, der sich die wirklich guten Anwälte leisten kann. Wahrheit als Geldbeutelfrage. Stark ist der Film auf dieser Ebene unter anderem, weil wir als Zuschauer die entscheidende Nacht trotz penetranter Handkamera vollständig aus der gedachten Ferne mitbekommen haben – und trotzdem nachvollziehen können, wie Vicente in seine missliche Lage gerät. Wir wissen mehr als er, aber eben auch mehr als das System, das ihn verurteilen will. Keinerlei Mystery hier, es liegt alles offen vor uns und ist doch ziemlich unheimlich.
Zweite Realität im Bild

Dass Recht und Wahrheit nichts miteinander zu tun haben müssen, das ist auch dem Kino nicht neu, aber Almendras will diesem Verhältnis konsequent anhand des konkreten Einzelfalls auf die Spur kommen, interessiert sich für kleinste Details. Much Ado About Nothing zehrt von einem narrativen Minimalismus, verdoppelt diesen aber nicht in der Filmsprache. Grundsatzgespräche über Schuld und Unschuld zwischen Vater und Sohn werden in langen Tracking Shots geführt, Gerichtsverhandlungen in sorgsam gerahmten Close-ups, die aufmerksam jedes Minenzucken verfolgen. Zugleich setzt der Film auf Transparenz: So werden Vicentes Messenger-Chats auf der Leinwand reproduziert, was zwar mittlerweile schon zum Standard-Repertoire des Erzählens im 21. Jahrhundert gehört, hier aber sehr clever eingesetzt ist. Wenn Vicente sich gerade mit seiner Affäre ablenkt, als sein Vater ihm per SMS auf den Gerichtstermin am nächsten Morgen erinnert, dann lesen wir mit ihm und erfahren zwei Realitäten in einem Bild.
Nachdenken über einen Tweet
Mit der streng subjektiven Perspektivierung, die sich nicht zuletzt in diesen Momenten ausdrückt, evoziert Much Ado About Nothing ein durchaus anregendes Unbehagen. Denn nicht nur verdoppelt sie die Unsichtbarkeit des Toten, über den wir nichts erfahren. Auch verschleiert sie geschickt die Tatsache, dass Vicente im Moment des Unfalls sehr gut hätte am Steuer sitzen können. Nicht jeder Sündenbock ist ein Opferlamm. Über das Schlussbild legt Almendras dann eine Reihe von Twitter-Nachrichten, in denen sich Chilenen über den Fall und die Straflosigkeit für rich kids aufregen. Eine davon lautet: „I bet that in the film, the murderer is portrayed as a victim. This country sucks.“ Dass man nach dem Abspann noch ungewöhnlich lange über einen Tweet nachdenkt, das spricht durchaus für diesen Film.
Neue Kritiken

Silent Friend

Small Town Girl

Der Fremde

Holy Meat
Trailer zu „Much Ado About Nothing“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (5 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.