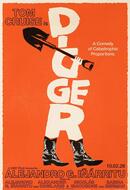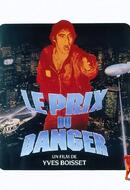Meine keine Familie – Kritik
Diktatur der Selbstoptimierung im Gewand der Befreiung. Ein Dokumentarfilm erzählt von einer Kindheit in der Kommune von Otto Mühl.

Erst ganz am Ende lässt auch Paul-Julien Robert den Gedanken zu, der einem als Zuschauer während seines Films mitunter durch den Kopf ging. „Man darf die Kleinfamilie auch nicht idealisieren“, verteidigt sich da die Mutter des Filmemachers, der auszog, um mit seiner Jugend fertigzuwerden. Diese Jugend fand statt in der österreichischen Großkommune von Otto Mühl, die zwischenzeitlich über 600 Mitglieder zählte. Auf den Einwand seiner Mutter antwortet Paul nicht, ihm bleibt nur die Idealisierung der Kleinfamilie, weil er sie nie gehabt hat. Dass es freilich nicht so einfach ist mit der Normalität und den alternativen Lebensentwürfen, das dürfte ihm selbst klar sein. Sein Film ist klug.
Zunächst ist Pauls Interesse ein persönliches. Er macht sich auf die Suche nach sich selbst als Kind, auf die Suche nach seinen drei möglichen Vätern, er findet diese Vergangenheit in den alten Archivaufnahmen der Kommune und in Gesprächen mit seiner Mutter, deren von der Kamera eingefangene Intimität verblüfft, dabei aber nie konstruiert wirkt. Diese Mutter ist eine der interessantesten Figuren des Dokumentarfilms der letzten Zeit. Sie weicht den unnachgiebigen Fragen ihres Sohnes – gleich zu Beginn will er wissen, mit wie viel Männern sie vor seiner Zeugung geschlafen hat – nicht aus, versucht ihr damaliges Denken zu erläutern, verteidigt das Kommune-Experiment, wo sie es für notwendig hält, stimmt in seine Verurteilung ein, wo sie nicht mehr anders kann. Wie sich in diesem Menschen Vergangenheit und Gegenwart verschränken, getrennt voneinander und doch schmerzlich miteinander verbunden, das geht weit über den Gemeinplatz der Vergangenheitsbewältigung und der entsprechenden Methode des biografischen Interviews hinaus.

Paul ist somit weniger Zentrum von Meine keine Familie als Ausgangspunkt. Es ist ihm ernst mit seiner Suche, und dass er in seinem sozialen Leben auch heute noch unter den Nachwirkungen des Aufwachsens in der Mühl-Kommune leidet, das nimmt man ihm sofort ab. Doch führt dieser subjektive Impetus nicht zu einer einseitigen Sicht auf das Kollektivprojekt, denn er lässt auch andere Stimmen zu Wort kommen: Kinder, die noch mehr gelitten haben als er, aber auch die ältere Generation, die ohne falschen Rechtfertigungsdruck versucht, die Umstände der Entscheidung für einen alternativen Lebensentwurf zu vermitteln. So ist der Film neben der persönlichen Neugier des Regisseurs auch von einer historischen Neugier motiviert, die innerhalb der intimen Suche zwar nicht vollends befriedigt werden kann, die aber zumindest Andeutungen zulässt: das reaktionäre Frauenbild der Mehrheitsgesellschaft, das Familienrecht des Staats, die in dieser Zeit vielfach aufgegriffene Vorstellung einer Auflösung der ideologisch naturalisierten Mutter-Kind-Bindung.
Die Aufnahmen aus dem Archiv des Projekts sind erst kürzlich von den mittlerweile in einer Genossenschaft organisierten Ex-Kommunarden zur Veröffentlichung freigegeben worden. Die Mühl-Kommune hat jeden Tag akribisch dokumentiert, wollte ihr soziales Experiment der Nachwelt zur Verfügung stellen, nicht vergessen werden. Zwar ist die Auswahl der hier zu sehenden Bilder selektiv, aber sie zeigt doch, dass die von Paul gebastelte Schablone der „normalen“ Familie gar nicht notwendig ist, um die hässlichen Umrisse dieses Kollektivprojekts zu erkennen.

Es reichen da schon ein paar Szenen aus dem Archiv, vor allem von Otto Mühl. Der war bei den Wiener Aktionisten, einer der provokantesten Kunstkollektive einer ohnehin schon provokanten Subkultur. Die 1970 gegründete Kommune, sie sollte sein großes Kunstwerk sein, das sagt er einmal ganz explizit: das Kunstwerk Leben. Und hier drückt sich das Scheitern dieses Projekts vielleicht am deutlichsten aus. Das Leben als Kunstwerk, diese Idee ist wohl niemals so gründlich missverstanden worden wie von Mühl. Er verbietet Popmusik und lehrt allen Kindern das Malen, er schreibt regelmäßige Selbstdarstellungen vor der gesamten Gruppe für die Entwicklung aller Kommunenmitglieder vor, er singt und lacht, und wer nicht singt und nicht lacht, der bekommt Ärger. Mühl erlaubte keine Kunstwerke neben dem seinen, und das Material dieses Werks ist nicht das lustvolle Leben, sondern das abgeschöpfte Vitalkapital seiner Kommunarden.
Ein anderer Junge aus Pauls Generation erinnert sich an eine Präsentation vor mehr als 200 Menschen. Sein kreatives Selbst sollte er ausdrücken, im improvisierten Tanz. Es ist eine paradoxe Szene, denn Selbstausdruck und Improvisation vollziehen sich hier nach Mühls Diktum, emotionale Ekstase findet unter Anleitung statt. Mühl dirigiert die Körper, er zwingt sie zum künstlerischen Ausdruck, impft ihnen eine Kreativität ein, die nichts zu tun hat mit selbstbestimmter Körperlichkeit. Befreit wird hier gar nichts, der Befreite erinnert sich nur noch an das Unwohlsein und die Angst vor der Strafe bei Verweigerung der Performance. In Mühls Kunstwerk der totalen Freiheit wucherte der Faschismus.

Tieftraurige Erkenntnisse wie diese ruft Meine keine Familie hervor, daneben ein Unbehagen, das über das Thema des Films hinausweist. Wenn man diese Szenen auf sich wirken lässt, den Geschichten zuhört, die Aussagen des Kommunensystems wirken lässt, dann erschließt sich das politische Unbewusste, das Pauls persönlichen Vergangenheitstrip umschließt und die im konventionellen Dokumentarfilm häufig so klare Grenze zwischen Reportage und Objekt brüchig werden lässt. Denn vieles kommt hier so bekannt vor. Da wird von einer Struktur gesprochen, die angeblich nichts mehr mit autoritären Hierarchien zu tun hat, die aber dennoch mithilfe einer ständigen Evaluierung und Selbstbefragung aufrechterhalten wird, in der sich die Kommunarden gegenseitig bewerten und bewertet werden. Da werden Kreativität, Spontanität und Sozialität gepredigt, die aber nur mit einer entsprechenden Arbeitsmoral bei der eigenen Selbstoptimierung zu erreichen sind. Da erinnern sich Kommunarden an die Zeit, in der die Kommune Geld brauchte und man Mitglieder losschickte zum Geldverdienen – die sich als begnadete Verkaufstalente entpuppten.

Wen wundert’s bei so viel Pflege des kreativ-spontanen Selbst. Der Diskurs der Kommune überlebt in der Management-Sprache der neuen Arbeitswelt, und Mühls Aussagen klingen gar nicht so verschieden von denen der Angestellten in Work Hard – Play Hard (2012). So zersetzt dieses Unbewusste des Films nicht zuletzt jene Mauer, die unser lineares Zeitverständnis ständig zwischen Vergangenem und Gegenwärtigem hochzieht. Die Kommune ist kein Extremfall, ihre Logik ist nicht das große Andere der bürgerlichen Normalität, zumindest zu einem Teil ist sie unsere neue Normalität, mit all ihren befreienden wie repressiven Elementen. Ganz wie für Pauls Mutter mit ihrer Vergangenheitsbewältigung ist auch für uns das Jetzt des Betrachtens vom Damals des Betrachteten kaum zu trennen. Das Persönliche, auch der scheinbar persönliche Dokumentarfilm, ist politisch.
Neue Kritiken

Der Fremde

Holy Meat

Die jüngste Tochter

Sorry, Baby
Trailer zu „Meine keine Familie“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (10 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.