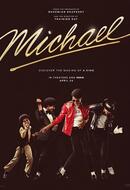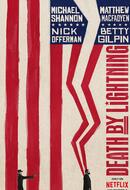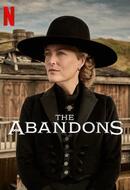Hagazussa - Der Hexenfluch – Kritik
Dogmen des Wahns: In Hagazussa ziehen dunkle Pestbeulen und das helle Licht einer christlichen Dorfgemeinschaft den Verstand einer jungen Frau in die Abgründe des Wahnsinns.

Die Fingerspitzen verfaulen zu schwarzen Wucherungen. Die Lymphknoten schwellen zu blutigen, blauen Beulen an. Der schwarze Tod. Das Todesurteil für Albruns Mutter. Während die kleine Tochter noch versucht, sie zu pflegen und zu füttern, siecht sie langsam dahin. Die Krankheit holt die Mutter. Die Tochter bleibt verschont und allein zurück. Noch Jahre später lebt Albrun (Aleksandra Cwen) in der gleichen Hütte, wo der mit Rosen verzierte Totenschädel der Mutter noch als dunkle Erinnerung thront. Sie ist nun selbst Mutter. Ihr Kind hat keinen Vater, sie keine Verbindung in das Dorf nahe der Berghütte. Der Tod der Mutter hat sie isoliert. Die Pest ist für sie auch ohne Ansteckung zur Strafe Gottes geworden.
Christlicher Aberglaube

In Hagazussa lauert die Gefahr nicht in der Dunkelheit des Waldgebirges, das Albruns Hütte umgibt, sondern strahlt vom göttlichen Licht der christlichen Gemeinde ab. In diesem Licht erscheinen die Geburt des Kindes und der grässliche Tod der Mutter als Frevel. So entspringen auch die Erniedrigungen, die Albrun durch die Dorfbewohner erfahren muss, stets dem Geist der Juden- und Hexenverfolgung. Das Zentrum dieses Horrors ist das Gotteshaus: eine kleine Dorfkirche, innen verkleidet mit den Schädeln und Gebeinen der unzähligen Toten. Hier sucht Lukas Feigelfelds Debütfilm den Ursprung des Aberglaubens, dessen Symbole er üppig im Film verstreut. Schlangen, Totenschädel, das Blut auf einem Leinentuch: Nichts lässt einen Zweifel darüber, dass das Konzept der Hexerei untrennbar mit dem Christentum verbunden ist. Wie die Befehlsgewalt über das Übersinnliche legt der Film auch Albruns von den Gräueln der Kindheit fragil gewordenen Verstand in die Verantwortung der Glaubensgemeinschaft. Je mehr sie sich gegen Albrun wendet, desto weiter scheint diese in den Wahnsinn abzugleiten.
Reizvoller Abscheu

Das gesellschaftliche Stigma findet sein Echo in rätselhaften Perversionen, die Albruns abgeschiedenes Leben immer wieder umgeben. Beim Melken ihrer Ziege streichelt sie das Fell des Tieres, schmiegt sich in einer zärtlichen Bewegung an, während sie die Zitzen fester ergreift. Die Ziege starrt mit aufgerissenen Augen ins Leere, während mehr und mehr ihrer Milch über Albruns Hand rinnt. Doch kaum scheint sich die Lust ihren Weg gebahnt zu haben, wird das Liebesspiel unterbrochen und bleibt eine der ambivalenten Gesten, die Hagazussa so reizvoll machen. Keines der okkulten Symbole, keine angedeutete Perversion ist letztlich eine unumstößliche Wirklichkeit oder ein eindeutiger Beweis für die Existenz des Übersinnlichen und Abscheulichen. Der Film nährt stets den Aberglauben, dessen Bedrohung aus den Tiefen der bewaldeten Berge abstrahlt: Lange Einstellungen, in denen dichter Nebel die Berge hochkriecht; Schlangen die sich um menschliche Körper winden und Maden, die sich in Wunden einnisten, deuten den Wahnsinn an, der alle Ebenen des Films befällt wie ein Parasit. Aleksandra Cwen absorbiert diesen Wahn, lässt ihn auf Albruns Gesicht erscheinen, das kaschiert wird von den Flammen des eigenen Kaminfeuers und sich schließlich im Schatten des eigenen Irrsinns verzerrt.
Hölle, das sind die anderen

Es ist stets die psychische Konstitution seiner Protagonistin, für die sich Feigelfeld interessiert. Die fackeltragenden Häscher, die noch zu Beginn des Films in schauerlicher Nacht auftreten, werden alsbald von gewöhnlichen Dorfbewohnern ersetzt, deren Ressentiments Albrun weiter in die Abgründe ziehen. Auf diesen Abgrund konzentriert Feigelfeld das ganze Repertoire des Genrekinos, das er in den letzten Kapiteln seiner Geschichte entfesselt. In Wellen, getragen vom sakralen Drone-Getöse des Soundtracks und den mal verzerrten, mal durchdringend klaren Babyschreien, breiten sich Albruns Delirien auf der Leinwand aus. Die Motive dazu sucht Mariel Baquieros Kamera ebenfalls nicht in greller Verzerrung, sondern im natürlichen Licht, das den natürlichen Ekel, das Delirium des Drogenrauschs und das Röcheln des Todeskampfes stets als das Ende einer langen Tortur zeichnet, deren Ursprung nie in den Schauern von Hexerei und Okkultismus liegt. Die Quelle des Wahnsinns züchtet Feigelfeld unter der Haut einer von Angst durchsetzten Gesellschaft. Grauen ist in nicht das Fremde, sondern das Vertraute. Der Wahn entwächst nicht der Hexerei, die Hexerei entwächst dem Wahn. Nicht das Okkulte oder das Fremde – mit dem Feigelfeld den Zuschauer stets geschickt in die Verunsicherung zurückdrängt – sind der Pfad zur Gewalt, sondern das Dogma, die Demagogie und die Hysterie, die den Verstand der Andersgläubigen vernichten. In Hagazussas dunklem Zeitalter kommt das Grauen nicht aus der Wildnis, sondern entspringt der Zivilisation.
Neue Kritiken

Peter Hujar's Day

Sehnsucht in Sangerhausen

Listen Up Philip

Der Mann, der immer kleiner wurde - Die unglaubliche Geschichte des Mr. C
Trailer zu „Hagazussa - Der Hexenfluch“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (11 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.