Der ganz große Traum – Kritik
Der Fußball als subversive Kraft: In unernstem Tonfall erzählt Sebastian Grobler davon, wie eine neue Sportart anno 1874 das Kaiserreich erschütterte.

Der Vorwurf, den man diesem Film machen könnte, hört sich wahrlich schrecklich an; deswegen sei er gleich zu Anfang genannt: Der ganz große Traum ist in mancher Hinsicht eine Mischung aus dem glatt polierten Rebellionsgeist im Club der toten Dichter (Dead Poet’s Society, 1989) und der Didaktik eines gut gemeinten deutschen Fernseh-Jugendfilms. Aber, und das ist das Schöne an dem Debütwerk von Sebastian Grobler, die meiste Zeit vergisst man das völlig, weil man sich einfach zu gut amüsiert.
Daniel Brühl spielt die historische Figur des Gymnasiallehrers Konrad Koch. Das ist der Mann, der in Deutschland 1874 das Fußballspiel einführte. Abgesehen von diesem Fakt und dem Ort des Geschehens – Braunschweig – hält sich die Handlung aber äußerst bewusst nicht an die Wirklichkeit. Die Abweichungen fangen damit an, dass der Brühl’sche Koch Englisch unterrichtet statt Deutsch und Alte Sprachen, und hört mit der ausgesprochen unwahrscheinlich modernen Geisteshaltung des Lehrers nicht auf. Das Kaiser-Wilhelm-Porträt in seiner Wohnung jedenfalls fällt, ein Running Gag, immer mal wieder von der Wand. Das ist zwar ein ziemlich offensichtlicher Regieeinfall, amüsant ist er aber trotzdem.

Dem Blick auf die Kaiserzeit ist durchgehend eine rein heutige Perspektive eingeschrieben, die die Auswüchse betont und den spätgeborenen Zuschauer in die angenehme Position des natürlichen Besserwissers hebt. Der Nationalismus, das Denunziantentum, das Klassenbewusstsein und der Widerstand des Bürgertums gegen den sozialen Aufstieg der Arbeiter – all das ist fein säuberlich anhand von einzelnen Figuren dargestellt: zum Beispiel dem skrupellosen Geschäftsmann und Vorsitzenden des Schulvereins, der gegen die Aufnahme eines Arbeiterkindes ins Gymnasium intrigiert, das sich dann natürlich als äußerst begabter Fußballer entpuppt. Mit dem Fair Play, das Koch seinen Schülern anhand des Sports beibringen will, ist stets auch die Idee gesellschaftlicher Chancengleichheit gemeint.
Auch das Patriarchat bekommt sein Fett weg, in Person des von Milan Peschel gespielten Schuldieners, der sich des Nachts auf dem Pausenhof betrinkt, weil seine Gattin in einen Frauenwahlverein eingetreten ist. Beeindruckt von diesem Schicksal, bleibt selbst dem so modernen Koch nichts anders übrig, als sich solidarisch danebenzusetzen und auch einen Schluck zu nehmen.

Das Didaktische, das aus solchen historischen Miszellen spricht, steht der ebenfalls darin vorhandenen Komik leider manchmal etwas im Weg. Der ganz große Traum ist nämlich vor allem eine Komödie, und in dieser Hinsicht völlig anders als der eingangs angeführte Club der toten Dichter. Die Stärke des Films liegt dabei nicht in der mehr oder weniger geschickten Einbettung „politisch relevanter“ Themen, sondern in der maßlosen Übertreibung, wenn eine Braunschweiger Schulklasse des Jahres 1874 so aufmüpfig wird wie eine Kreuzberger des Jahres 2011, nur ohne Migrationshintergrund. Oder zumindest wie eine des Jahres 1968, als die Filmreihe Die Lümmel von der ersten Bank begann.

Die Bedrohung für den Status quo kurz nach dem Sieg über Frankreich ist in Der ganz große Traum nicht der Sozialismus, sondern der Fußball – eine obrigkeitserschütternde Kraft, die das Bürgertum naserümpfend „Engländerkrankheit“ nennt. Koch sieht sich wegen seiner Lehrmethoden bald angegriffen, einzig der fortschrittliche Schuldirektor (Burghart Klaußner) versucht, zu ihm zu halten. Am Schluss werden, wie sich das für eine Komödie gehört, alle Konfliktlinien gelöst. Der Fußball kann seinen Siegeszug antreten, und Axel Prahl als Sportgerätehersteller stellt flugs seine Produktion von Medizinbällen auf die neue Mode um. Die Frauen dürfen zwar immer noch nicht wählen (das wird noch mehr als 40 Jahre dauern), können aber die Abseitsregel erklären. Und zwar so, dass selbst die kaisertreuen Herren sie verstehen.
Neue Kritiken

Kung Fu in Rome

Dangerous Animals

Versailles

Highest 2 Lowest
Trailer zu „Der ganz große Traum“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (24 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Neurath
Dieser FIlm verdreht die Tatsachen.
August Hermann hat den Fußball eingeführt.
Seine Schwägerin brachte den Ball aus England mit.
Hermann war Herzoglicher Turninspektor und hat den Ball zwischen die Jugend geworfen.
„Das größte Verdienst kommt dem in
Turnkreisen so wohl bekannten A. Hermann
Der zu, der den ersten Fußball auf die
Braunschweiger Spielplätze warf und damit
den Anfang zur Einführung des englischen
Spiels überhaupt machte“, schriebt Konrad
Koch .
andreas wittner
Zitat Prof. Dr. Konrad Koch aus dem Jahre 1899:
"Bis 1893 ward von uns ausschließlich der gemischte Fußball (mit Aufnehmen) betrieben; in den Wettspielen mit Göttingen, Hannover und hiesigen Vereinen blieben unsere Schüler stets unbesiegt. Im Herbst 1893 sah ich mich veranlaßt, das einfache Spiel einzuführen, zunächst für die oberen Klassen, deren Vorgang auch die unteren bald nachfolgten. Unsere Fußballmannschaft hält sich auch in diesem Spiele wacker, doch steht sie keineswegs mehr auf der ersten Stufe in Braunschweig."
Unter dem "gemischten Fußball mit Aufnehmen des Balles" verstand man in der damaligen Zeit das Spiel nach modifizierten Rugby-Regeln. Die Version nach den Associations-Regeln, unser heutiges in Deutschland gehuldigtes Fußballspiel, bezeichneten die Ur-Kicker als das "Einfache Spiel ohne Aufnehmen des Balles".
Adja et Capucine
Dieser Film ist sehr interessant, weil wir viel lernen über Schule .
Der Film gefält mir, weil ich
Fußball wirklich mag .
Am Ende des Film sind die Kinder solidarisch.
Aber der Film gefällt mir nicht ,denn die Lehrer sind sehr streng .
Der Film ist ein bisschen lang.
Ich empfehle diesen Film.
Lichtschwan
"Der ganz große Traum" bedient alle möglichen Klischees über das kaiserliche Deutschland, dem noch dazu ein Großbritannien im Sinne der westlichen Propaganda gegenübergestellt wird.




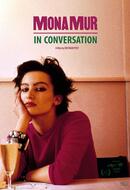
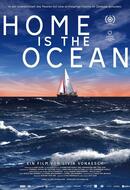









4 Kommentare