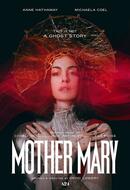Camille Claudel 1915 – Kritik
Abschied vom Rätsel, Flucht von der Oberfläche: Bruno Dumont hat einen Film gedreht, den wir wörtlich nehmen müssen.

Der Titel: ein Name, eine Jahreszahl, ein Bruch. Ein Regisseur, dem es in seinem Werk bislang nie um Figuren ging, nie um Individuelles oder gar Psychologisches, befasst sich mit der berühmten französischen Bildhauerin Camille Claudel, die nach großem Erfolg um die vorletzte Jahrhundertwende für den Rest ihres Lebens in einer psychiatrischen Anstalt endete – und lässt diese gar von einer bekannten Schauspielerin wie Juliette Binoche spielen. Dass Camille Claudel 1915 kein klassisches Biopic ist, darauf weist freilich schon der Zusatz im Titel hin, der die Künstlerin festsetzt in der Zeit, anstatt ihr Leben zu erzählen. Und auch Binoche interpretiert hier nicht selbstverliebt ein fürs Kino adaptiertes Leben, sondern bietet sich an für eine Begegnung mit Claudel; die unzähligen Einstellungen ihres Gesichts lassen dabei viel mehr an Bresson denken als an perfektes Method Acting.

Von Anfang an ist die Atmosphäre bedrückend. Die Insassen der Anstalt strecken Camille feindselig ihre Zungen entgegen und schlagen mit den Gabeln monoton auf den Tisch vor ihnen. Wir sind noch ganz in Dumonts Welt, die sogenannten Verrückten von „verrückten“ Laien dargestellt, deren Gesichter irritieren, weil wir nicht hinter sie blicken können, deren Handlungen verstören, weil wir ihre Motivation nicht kennen, weil sie nicht psychologisierbar sind. Aber diese aus vorherigen Filmen so vertraute Welt ist hier nur noch Umwelt, die Dumont’schen Rätsel haben sich vom Zentrum an die Ränder verschoben, und mit Camille bekommen wir eine Figur an die Seite gestellt, mit der wir diese Welt erfahren können. In einer frühen Szene hören wir den Inhalt eines ihrer Briefe an den Bruder, und Dumont scheint spätestens jetzt meilenweit entfernt von seiner radikalen Ästhetik der Oberfläche. Camilles Gesicht ist so vielschichtig wie andere Gesichter in seinen Filmen, jedes Zucken und jede Verschiebung der Falten ist wichtig, aber dieses Gesicht ist keine bloße Textur mehr, sondern transparent und lässt den Blick auf eine innere Realität zu, an der der Regisseur zuvor nie Interesse gezeigt hat.
Dieser Bruch ist hart, aber bereits im Sujet des Films angelegt: Denn Camille selbst ist das Außen abhanden gekommen. Als sie ein Stück Lehm findet, bearbeitet sie es nur kurz mit ihren Fingern und wirft es wieder weg. Sie ist gelähmt, ihrer Kunst entledigt, und so bleibt nur die Flucht nach innen, und Dumont der Einbezug eines Innenlebens mit Gefühlen, und damit einer Figur. Die Körper stoßen sich nicht mehr am Außen, sie sind eingesperrt, und so ist Camille Claudel 1915 Dumonts am wenigsten körperlicher Film geworden. Die Grenzen, an die der Regisseur so gerne stößt, sind nicht mehr Sex und Gewalt, sondern die sich mit Krämpfen und Schreien zwar körperlich äußernde, aber doch mentale Grenze des Wahnsinns.

Diese Verschiebung lässt eine interessante Verknüpfung des studierten Philosophen Dumont zu einer französischen Denkschule erkennen, für die das Verhältnis von Normalität und Wahnsinn im letzten Jahrhundert entscheidend war. Dass wir Camilles Einschließung in der Anstalt mit ihr gemeinsam als ungerecht empfinden, das macht die Insassen um sie herum auf eine nicht ganz unproblematische Weise zwar zu den „tatsächlichen Irren“ und scheint einer kritischen Annäherung an das Thema entgegenzustehen, doch die Geschichte der Bildhauerin macht den Wahnsinn eben auch als Machtstrategie erkennbar. Denn die Mechanismen, durch die man zur Verrückten wird, sind historisch kontingent, und zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Frau eine begabte Künstlerin zu sein konnte einen solchen Mechanismus in Gang setzen. Es scheint jedenfalls kein Zufall, dass einer der ganz wenigen Bezüge des Films auf die Vorgeschichte Camilles ihre Vermutung ist, ihr Lehrer und Liebhaber Auguste Rodin habe Angst vor ihrem Talent gehabt. Sätze dieser Art sind heute möglich, im Diskurs der Zeit hatten sie den Ausschluss zur Folge, die Einsperrung wegen Paranoia.
Als traue Dumont dem eigenen Wandel nicht ganz, als wolle er seinen Film absichern gegen ein mögliches Scheitern seines Experiments, das Eingeschlossensein filmisch zu radikalisieren, führt er uns zur Mitte doch ins Bekannte zurück. In einem überaus harten Schnitt mitten im Film lernen wir Camilles strenggläubigen Bruder Paul kennen, der die Einschließung seiner Schwester und überhaupt alles Gegebene mit dem Willen Gottes rationalisiert. Pauls Monologe über den Gehorsam zu Gott, die weiten Landschaften, durch die er schreitet, die lange Einstellung, in der er mit einem Pfarrer einer übermächtig wirkenden Kirche gegenübersteht, sie erinnern viel stärker als die Geschichte Camilles an Dumonts Filme.

In Camille Claudel 1915 allerdings wirken diese Szenen eher fehl am Platz und lassen den Film darüber hinaus fast ins Thesenhafte abgleiten. Denn dass Pauls dogmatischer Glaube an die Macht Gottes nur die andere Seite des Wahnsinns ist, wie es die parallele Struktur der Geschichten der beiden Geschwister nahelegt, das ist ein ungewohnt deutliches Statement, und auf solche Erkenntnisse war Dumonts Werk bis dato niemals reduzierbar. Bisher hat der Franzose Filme eher angeboten, machen sollte sie der Zuschauer, wie er selbst einmal sagte. Mit Camille Claudel 1915 hat er nun selbst einen Film gemacht. Es ist ein starker, intensiver Film geworden, aber was fehlt, und was in einem solchen in einer historischen Realität verankerten Projekt vielleicht gar nicht möglich ist, das ist jene radikale Ambivalenz früherer Werke, in denen Dumont unter Verzicht auf Kommentare und Urteile das Kino genutzt hat, um etwas erfahrbar zu machen, das in keine andere Sprache übersetzbar war. Zog Dumont mit vielen seiner Arbeiten die grundsätzliche Möglichkeit filmischer Aussagen in Zweifel und evozierte vielmehr eine radikale Rätselhaftigkeit, ist hier von Anfang an klar, worum es geht, und am Ende gehen wir zwar erschüttert, aber ganz ohne Fragezeichen aus dem Kino.
Neue Kritiken

Gavagai

Stille Beobachter

Im Rosengarten

Die endlose Nacht
Trailer zu „Camille Claudel 1915“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.