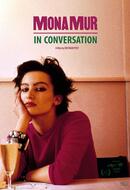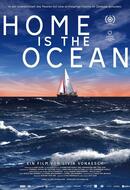Der Wert des Menschen – Kritik
VoD: Wie eine Treuepunktekarte in den Suizid führt und wie man zum Schämen in die Ecke geht: Stéphane Brizé zeigt, wie todernst es der Kapitalismus mit seinen Gesetzen meint.

Die äußere Erscheinung, das körperliche Auftreten bestimmt den ersten Eindruck zu exakt fünfundfünfzig Prozent. Nicht vierundfünfzig, nicht sechsundfünfzig, sondern fünfundfünfzig. Ohne solche Exaktheit lässt sich das Gesetz des Marktes (La Loi du marché – der französische Titel von Der Wert des Menschen) nicht exekutieren. Thierry Taugourdeau (Vincent Lindon) muss man daran erinnern, mehrmals sogar. Sein Jobinterview über Skype lässt in dieser Hinsicht nämlich arg zu wünschen übrig; und so ist es eine gütige, eine Samariter-Geste, dass dieses Interview nun in der Gruppe nachbesprochen wird. Mit pädagogischem Ernst leitet eine Männerstimme aus dem Off die lehrmeisterliche Analyse: Körpersprache, Schlagfertigkeit, Deutlichkeit, Rhythmus. Stéphane Brizé bringt mit dieser Szene bereits das Wesentliche auf den Punkt. Dafür braucht es im Grunde nur eine Kamera, die vielleicht gelegentlich um ein paar Zentimeter nach links oder nach rechts schwenkt, jedoch beständig ihren Protagonisten, nämlich Thierry, im Blick behält. Es ist eine Situation klinisch reiner Anonymität. Weder sieht man den selbsternannten Samariter, den Herren über die Formeln des Marktes, noch die Diskutanten. Man sieht nur Thierry, wie er schweigt, über sich ergehen lässt, was gerade geschieht, und wie ihm die Röte ins Gesicht schießt. In dem Maße, in dem die Kamera ihn mit aller Strenge nicht aus ihrem Blickfeld entlässt, erfährt er das ganze Drama, auf ewig an sich selbst gekettet zu bleiben: In der Scham wird dieses Drama zur Tragödie.
Die Würde und die verwaltete Welt

Natürlich geht es um Würde, denn Der Wert des Menschen ist ein Film, der sie Szene um Szene infrage stellen lässt. Fast jede Situation zeigt Vorgesetzte und Angestellte, Samariter und Bittsteller. Jedes Mal von Neuem wird ausgehandelt, wer sprechen darf und wer nicht. „Werden Sie sich bei mir melden, oder soll ich mich bei Ihnen melden?“, fragt Thierry nach einem Skype-Gespräch mit einem potenziellen Arbeitgeber. „Weder noch, wir schicken eine E-Mail“, bekommt er als Antwort. Gespräch beendet. Gewiss kann man fragen, ob Brizés Zugang zur verwalteten Welt als einer, die die Menschenwürde in der Phrase „Schönen Tag noch“ bewahrt wissen will, sonderlich originell ist, ob sich damit dem Fiasko der Moderne überhaupt eine neue Perspektive hinzufügen lässt, etwas anderes als die vielleicht doch endlich begriffene Entfremdung des Menschen, die sich immer dann zeigt, wenn die Souveränen selbst nicht im Bild sind, wenn sie gewissermaßen aus einem anonymen, leeren Raum heraus agieren, wenn sie nicht mehr lokalisierbar sind, wenn sich ihre Macht genau in dieser Ödnis kristallisiert. Man kann aber auch fragen, ob das Getriebe der verwalteten Welt überhaupt noch unentdeckte Mechanismen birgt, ob es überhaupt Originalität, in welcher Zuspitzung auch immer, zulassen kann und darf.
Die Treuepunkte und der Suizid

Dass dem nicht so ist, ist gewissermaßen Brizés These. Sein Minimalismus, seine Insistenz auf im Grunde immer identische Situationen sind die Beweisführung. Er will keine blinden Stellen ausleuchten, diese gibt es ohnehin nicht mehr, er will sagen, was jeder weiß, und zwar deshalb, weil man es gar nicht oft genug sagen kann: Die Würde des Menschen ist nicht nur nicht mehr unantastbar, über sie wird verfügt, und zwar absolut, von jenen, die über das Kapital verfügen. Thierry wird als Sicherheitsmann in einem großen Kaufhaus arbeiten, über Bildschirme soll er Diebstähle aufdecken, auch soll er seine eigenen Kollegen überwachen, jeder, so brieft man ihn, sei ein potenzieller Dieb. Zweimal muss eine Kassiererin zum Verhör mit dem Manager. Die eine hatte die eigene Treuepunktekarte mit den Einkäufen fremder Kunden aufgepäppelt, die andere sammelte Gutscheinbons auf Kassenzetteln. Beide Frauen, gezwängt in die Ecke eines kleinen, kargen Raums, werden zu ihrer Verteidigung keinerlei Argumente mehr finden, sie werden verstummen, die eine für immer. Thierry, das ist die einzige Hoffnung, die der Film gewährt, weiß über den Zusammenhang von Kapital und Würde. Eine letzte Szene deutet zumindest die Möglichkeit an, irgendwie demgemäß zu handeln.
Die Judikative des Marktes

Der Wert des Menschen, darin liegt seine Qualität und darin ist er konsequent, hat sich selbst keine Mission gesetzt, der Film versucht gar nicht erst, das Verhältnis von Kapital und Würde umzukehren, er kühlt sich selbst auf das herab, was er bereits als gefrorenen Stillstand voraussetzt, dass sich nämlich das Verhältnis immer selbst perpetuiert, dass es nach allen Seiten hin geschlossen ist. In der Scham kann genau das auf ein Gesicht projiziert werden, und im Gesicht wird ästhetisch erfahrbar, was sonst die Aufgabe der Taschenrechner ist. Die Scham ist die Nullsumme der kapitalistischen Kalkulation. Zu Recht schämt sich der, der sich schämt, weil er niemand mehr ist, weil er gegen das Gesetz des Marktes verstoßen hat. Die Scham ist die Strafe, die der Markt verhängt. Der Wert des Menschen ist in dieser Hinsicht vielleicht weniger ein Film über die Gesetze des Marktes als über dessen Judikative.
Der Film steht bis 23.06.2022 in der Arte-Mediathek.
Neue Kritiken

Kung Fu in Rome

Dangerous Animals

Versailles

Highest 2 Lowest
Trailer zu „Der Wert des Menschen“


Trailer ansehen (2)
Bilder

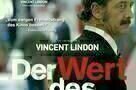


zur Galerie (12 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.