Vom Unbehagen mit dem Kurator
Im letzten Jahr ist die Debatte um die Macht von Kuratoren mit der Besetzung des theaterfernen Kunstkurators Chris Dercon an der Berliner Volksbühne weiter eskaliert. Im Mai diskutierten FAZ-Kritikerin Julia Voss, Künstler und Kurator Andreas Siekmann und Stanford-Professor Hans Ulrich Gumbrecht bei den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen sehr grundsätzlich über die heutige Kunst- und Kulturproduktion, welche Rolle Kuratoren darin spielen – und besser nicht spielen sollten.

Über die steile Karriere des Kunstkurators und was sie für die ästhetische Erfahrung bedeutet streiten Künstler, Kritiker und Wissenschaftler. Drei solcher Positionen konfrontierten die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen unter dem Titel „Oder ganz anders? Was erwarten wir von kuratorischer Praxis?“ am 9. Mai 2016. Die von Hilde Hoffmann moderierte Runde bestand aus der Leiterin des Kunstressorts der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Julia Voss, dem auch als Kurator tätigen Künstler Andreas Siekmann und Hans Ulrich Gumbrecht, Professor für Literatur an der Stanford University und Blogger.
Hans Ulrich Gumbrecht will zurückkehren zu einer ästhetischen Erfahrung ohne Mittelsmänner und Handzettel, Julia Voss fordert mehr Transparenz der Strukturen und Geldflüsse, Andreas Siekmann spricht sich für Interventionen gegen hegemoniale Praxen des Kuratierens aus. Virulent ist für alle drei, welches Bild wir uns vom Publikum machen: wie mündig, wie hilfsbedürftig, wie kritisch ist es?
Wir dokumentieren das ausführliche Gespräch in leicht gekürzter Form.
Hilde Hoffmann: Der „freie Kurator“ oder „freie Kunstkurator“ hat in den letzten Jahren eine steile Karriere durchlaufen und ist inzwischen in allen Bereichen der Kulturproduktion präsent. Mal wird er als ultramobiler Netzwerker und Sinngeber beschrieben, mal ist er mehr Consultant, mal wird er selbst zum Künstler. Auf jeden Fall scheint er ein Versprechen auf Ordnung in einer unverständlich gewordenen Welt zu sein. Bei diesen schillernden Berichten gibt es auch kritische Beobachtungen. Bei internationalen Großausstellungen steht die konzeptionelle Arbeit des Kurators häufig im Mittelpunkt des Interesses. Die Kunstwerke und ihre Eigenweltlichkeit treten in den Hintergrund. Die Befürchtung ist, dass der Kanon immer enger wird, wenn Kunst zur Illustration von kuratorischen Konzepten dient oder nur dazu, den eigenen Marktwert zu erhöhen. Welche Erwartungen können wir also an die Wahrnehmung und Vermittlung von Kunst und Film formulieren? Zuerst zu den Problemen und zur Kritik. Julia Voss, was sind die neuen Abhängigkeiten, in denen Kuratoren stecken, und was bedeutet kuratorische Macht?

Julia Voss: Das Unbehagen, das uns der Kurator bereitet, steckt im Begriff selbst. „Kurator“ kann auf der einen Seite „Pfleger“ bedeuten und auf der anderen Seite auch „Vormund“. Wir teilen alle dieses Unbehagen, wenn wir das Gefühl haben, dass Kunst nur noch zur Illustration einer These dient und in ihrer Eigengesetzlichkeit gar nicht mehr beachtet wird. Eigentlich ist der Kurator ja eine Art Botschafter, ein Mittler zwischen verschiedenen Welten. Eine wichtige Aufgabe ist natürlich, dass er mehrere Kunstwerke, wenn sie gleichzeitig gezeigt werden, in ein Verhältnis zueinander setzt und miteinander abstimmt. Ganz einfach gesagt, achtet er darauf, dass das eine Kunstwerk das andere nicht erschlägt. Aber er vermittelt natürlich auch zwischen anderen Welten, und das ist einmal eine große, die sich Öffentlichkeit nennt, und einmal eine kleine: Das ist die der Sponsoren und Finanzgeber von diesen Ausstellungen, die ja selten nur aus öffentlicher Hand bezahlt werden, sondern vor allem auch von Galerien und von Sammlern. Oft durchschauen wir das nicht richtig. Es wird nicht offengelegt, und Anfragen dazu werden nicht beantwortet. Mehr noch: Häufig ist es sogar die Bedingung für ein Sponsoring, dass die Geldgeber nicht öffentlich genannt werden.
Für den Kurator ist das eine große Herausforderung. Ein guter Kurator, das ist wirklich beeindruckend zu sehen, hat eine erstaunliche Fähigkeit: Er bekommt eine Fläche und muss das übersetzen können in eine Anzahl von Kunstwerken und Dollar pro Quadratmeter, die er organisieren muss. Besonders bei der letzten Biennale in Venedig fiel mir auf, wie die Verhältnisse dieser kleinen Welt und der großen Welt der Öffentlichkeit auseinandergeraten. Für die Blue-Chip-Künstler gab es eine sehr großzügige Präsentation: In diesen aufwendigen Architekturen, geradezu „Kathedralen“, wurde vor allen Dingen großformatige serielle Malerei gezeigt oder andere Serien. Wir müssen ja Serien haben, um die Preise richtig hochzutreiben. Und drum herum gab es einen Hühnerstall von Arbeiten, die hineingepfercht worden sind. Das hat mich tatsächlich sehr geärgert. Großausstellungen bedeuten immer eine gewisse Überforderung, aber jedes Kunstwerk muss trotzdem die Chance haben, wie ein Köder zu funktionieren. Bei manchen Sachen bleibt man eben stehen und denkt sich, das will ich mir genauer ansehen, und dafür nehme ich mir jetzt Zeit. Bei den Filmen war es tatsächlich überhaupt nicht möglich, sie zu sehen, weil der Lärm so groß war, die Arbeiten so dicht nebeneinander positioniert worden sind, dass einfach die Akustik fehlte, um zu hören, was in diesen Filmen passiert. Insofern haben sich die Werke tatsächlich gegenseitig den Raum genommen. Das war ein Scheitern auf zwei Ebenen. Einmal beim Kurator als Mittler zwischen den Kunstwerken, denn natürlich muss eigentlich jedes eingeladene Kunstwerk zu seinem eigenen Recht kommen. Und natürlich auch beim Kurator als Mittler zwischen öffentlichen und privaten Interessen. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Öffentlichkeit eher zum Statisten von privaten Interessen wird. Zugespitzt muss man mit Blick auf diese Biennale sagen: Während es früher zur Museums- oder Ausstellungsidee gehörte, dass private Gelder öffentlich gemacht werden, werden da in gewisser Weise eher umgekehrt öffentliche Gelder zu privaten gemacht.
HH: Lieber Herr Gumbrecht, ich zitiere Sie und frage Sie: Was nervt am Kuratieren?
Hans Ulrich Gumbrecht: „Was am Kuratieren nervt“ ist der Titel eines Blogs, den ich vor drei, vier Jahren für die FAZ geschrieben habe. Was ich erstaunlich finde, ist erstens, dass Sie auf diesen alten Blog reagiert haben. Und er ist tatsächlich, das kann man als Autor abfragen, von den 225 Blogs, die ich bisher geschrieben habe, der am meisten geklickte. Aber was nervt mich – und anscheinend so viele – am Kuratieren? Zunächst ist klar, dass natürlich gerade bei zeitgenössischer Kunst, und nicht nur in unserer Zeit, Vermittlung notwendig ist. Oder bei Kunst aus anderen Kulturen. Aber ich denke, dass das, was man die Selbstreflexivität oder die Selbstpräsentation des Kurators nennen kann, etwas überhandgenommen hat. Der Kurator ist ein Star geworden. Man spricht über das Tate Modern und redet nicht über die großartigen Kunstwerke dort, sondern about the hanging of the Tate Modern. Das trifft sich übrigens mit jener akademischen Disziplin, die man auf Englisch anthropology nennt, im Deutschen eher Ethnologie. Da gibt es die self-reflexive anthropology, wo man ständig darüber redet, was für Gefühle man hat, wenn man in Senegal oder in Australien ist, und wie einen das doch an zu Hause erinnert, aber über Australien oder den Senegal erfährt man sehr wenig. Man erfährt alles vom Familienleben des Anthropologen oder eben des Kurators. Da gibt es eine Disproportion. Das ist auch immer eine Frage des Takts. Ich beschwöre ganz bewusst dieses altmodische Wort aus dem Knigge herauf. Natürlich kann man ein bisschen von sich selbst reden (ich rede immer viel zu viel von mir selbst). Aber dann soll man eben ein wenig auf die Bremse treten.

Die Frage ist: Woher kommt das? Warum ist der Kurator so in den Vordergrund getreten? Und dazu habe ich eine These. Ich habe den Eindruck, im letzten halben Jahrhundert hat eine Nivellierung der Kunsthierarchie stattgefunden, vor allem in den 1970er, 80er Jahren, bevor die meisten von Ihnen geboren wurden: Man sagte damals ganz programmatisch, wir können jetzt auch über Trivialliteratur reden. Die hat auch ihre Qualität. Der Unterschied zwischen höherer Kunst und niederer Kunst sollte verschwinden.
Und ich glaube, dass man heute dem anspruchsvollen Publikum gefällt, wenn man einen Diskurs erfindet, der wieder die alten Hierarchien hervorbringt. Nicht offiziell, aber inoffiziell. Also der Leser der FAZ freut sich, ohne das so genau zu wissen, wenn er mit einem Diskurs angesprochen wird, den der Leser der BILD-Zeitung sowieso nicht verstehen könnte und den der ungebildetere Leser der FAZ, der sich nur auf die Börsenkurse konzentriert, auch nicht versteht. Es wird also wieder eine soziale Distinktion, eine Art von Bildungsbürgertum auf einem erneuerten Studienratsniveau eingeführt.
HH: Sie beschreiben in dem Text auch, dass die Erfahrbarkeit von Kunst und Film in dieser Form nicht mehr möglich ist.
HG: Erstens kann man sagen, dass dieser kuratierende Diskurs natürlich einen Vorhang zwischen die Kunstwerke und den Betrachter oder die Literatur und die Leser hängt. Jemand sagt mir, wie ich Ulysses zu lesen habe, und das bedeutet, ich kann selbst keine Erfahrung mehr machen. Und zweitens, und jetzt verwende ich ein Wort, das Frau Voss in einem Artikel in der FAZ gebraucht hat, die Diskursivierung. Der Diskurs des Kurators ist natürlich Sprache, das heißt, alle Kunst wird übersetzt in Begriffe. Was die spezifische Chance der Erfahrung von Kunst ist, wird in Begriffe, in Sprache überführt und dadurch ausgetrocknet.
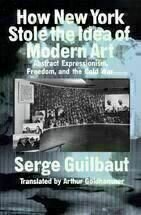
HH: Andreas Siekmann, vor allem geht es erst mal um Ihre Kritik als Künstler an kuratorischer Arbeit. Im zweiten Schritt aber tatsächlich auch um Ihre herausragenden kuratorischen Arbeiten, an denen wir kuratorische Praxis sehen können.
Andreas Siekmann: Ich bin Künstler, komme aber aus einer Generation, die das Kuratiertwerden infrage gestellt hat. Das Kuratiertwerden geht oft damit einher, dass man als Künstler auf bestimmte Dinge reduziert wird. Das macht aber nicht nur der Kurator. Dass man sich über den Kurator und das Kuratieren aufregt, hat damit zu tun, dass er wie ein Blitzableiter funktioniert. Ausstellungen funktionieren immer mehr wie Finanzprodukte. Die enorme Professionalisierung des Kunstbereichs drückt sich einerseits in der Verkürzung der Zeit aus, die der Planung und Durchführung von Ausstellungsprojekten zur Verfügung steht, aber auch in dem Anspruch an Weltkunst mit seinem ungeheuren Distributionsdruck. Und letzten Endes funktioniert ein so gemanagter Bereich dann wie andere ökonomische Dienstleistungen auch. Eine Biennale wird in drei oder vier Monaten rausgehauen, das Geld wird vorher fast zwei Jahre lang angelegt, und dann wird die eigentliche Ausstellung in kürzester Zeit von Heerscharen an Assistenten und Assistentinnen hergeschafft und abgewälzt. Diesen Vorgang zu umgehen heißt, sich den Luxus Zeit versus Geld herauszunehmen, die oben beschriebene Zeitökonomie als Nötigung zu begreifen und zu versuchen, Projekte langfristig zusammen mit den ausstellenden Künstlern zu entwickeln. Darin liegt auch die Chance, offenzulegen, worin die Kriterien in Findungsprozessen einer Diskursivität bestehen, und dem Publikum die Möglichkeit zu geben, daran Kritik zu üben. Demgegenüber wird oft vertreten, dass diese Diskursivität das unmittelbare Erleben von Kunst beeinträchtigen würde. Ich glaube, das ist letzten Endes ein paternalistischer Blick, der das Publikum degradiert und ihm in diesem Unmittelbarkeitsverdikt eine Teilnahme am Diskurs vorenthält. Kann ich aber Kunst überhaupt absichtlich sehen, oder ist es nicht eine permanent wiederaufzustellende Verabredung von dem, was wir für Kunst halten? Ich glaube, was Frau Voss beschrieben hat, diese enorme Ökonomisierung des Bereiches und die Aneignung der Kunst durch eine Yellow Press und die Gesellschaft des Reichen und Schönen und Guten, der Charity, das hat eher eine ideologische Funktion. Als Künstler würde ich natürlich sagen, man muss da nicht mitmachen.
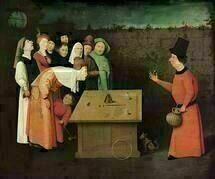
HH: Sie haben selber kuratiert. Was sind Ihre Forderungen und Erwartungen an kuratorische Praxis?
AS: Ich glaube, ein Großteil der Ausstellungen ist in der Zwickmühle, immer etwas repräsentieren zu müssen. In diesem Sinne wird ein Etikettenschwindel mit Identitätspolitik gemacht, oder es wird versucht, die geopolitische Karte noch mal zu reproduzieren und in die Biografien der Künstler hineinzulegen. Auch wenn ein Künstler zwar an einem Ort geboren, dort aber gar nicht aufgewachsen ist, muss er für dieses Land und die Illustration von Welt herhalten, obwohl die Kriterien seiner Arbeit damit gar nichts zu tun haben. Um diesem Etikettenschwindel mit anderen Ländern und Dingen zu entgehen, kann man kuratorisch nur arbeiten, indem man dort Zeit teilt oder eben mit Leuten arbeitet, die vor Ort so lange leben, dass man von einer vertraulichen Basis ausgehen kann. Wenn ich als Kurator China mit einbeziehen muss und vier Tage in China bin, bin ich nicht in der Lage zu entscheiden, der ist gut oder nicht gut. Die Leute, die ich am Flughafen abhole, sind tendenziell die falschen. Als Gegenprogramm kann ich den Luxus von Zeit beanspruchen, mit der Konsequenz, dass man aber auch nichts anderes macht. Für die permanenten Geldsubjekte, die im Kunstbereich da sind, die mindestens zwanzig bis dreißig Ausstellungen im Jahr bedienen müssen, um ihre Assistenten und Hiwis bezahlen und auch in diesen Strukturen überleben zu können, funktioniert so ein Modell nicht.
HH: In die Runde gefragt: Was sind Ihre Forderungen an kuratorische Praxis?
JV: Mir als Kunstkritikerin wäre es in der Tat wichtig, da eine größere Transparenz zu haben. Oder, wenn das nicht geht, wäre für mich die Alternative, zum Beispiel auch bei einer Veranstaltung wie der Biennale, zurückzukehren zu einer von Künstlern organisierten Privatausstellung, wie sie die Biennale in Venedig bei ihrer Gründung war. Dann hätten wir klare Verhältnisse. Was ich schwierig finde, ist diese Verwischung zwischen Privatem und Öffentlichem und die Inanspruchnahme eines im weitesten Sinne öffentlich aufklärerischen Diskurses für private Interessen. Es wird sich darauf berufen, dass es der Bildung diene, dass es einen aufklärerischen, moralischen, ethischen Wert hätte, diese Skulpturen, Gemälde oder Videoarbeiten zu zeigen. Im Grunde aber finden Sie darunter wie bei einem Maulwurfshügel ein Gangsystem, in dem es um andere Sachen geht. Zu der Frage danach, in welcher Art und Weise Ausstellungen gezeigt werden sollen oder was Kuratoren machen sollen, da lass ich mich gerne von Beispielen überraschen. Ich hab viele tolle Ausstellungen gesehen, die auf sehr unterschiedliche Weisen funktionieren.

Und weil Herr Gumbrecht gesagt hat, er hat ’ne steile These, warum der Kurator so mächtig geworden ist: Ich habe auch ’ne steile These. Ich würde sagen, es ist eine Form von Koevolution. Insofern stimme ich Herrn Siekmann auch zu, dass die Kritik am Kurator im Grunde ein Blitzableiter ist. Wenn wir uns jemanden anschauen wie Harald Szeemann – man kann noch Arnold Bode nehmen –, Szeemann ist noch immer der Inbegriff des Kurators: Womit ist er groß geworden? Mit der Konzeptkunst. Mit ein paar wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel der, die Ausstellung When Attitude Becomes Form nicht in New York zu zeigen, wo sie total untergegangen wäre, sondern in Bern, wo die Bauern protestiert haben. Das ist eine Kunst gewesen, die extrem spezialisiert ist und sich schon in einem Diskurs befindet. An sich eine Kunst für Kunsthistoriker. Wir haben inzwischen als dominierendes Modell Kunst, die für Kunsthistoriker oder für bestimmte Diskurse produziert wird oder, manchmal überlappt sich das auch, für ein Marktsystem. Für das Marktsystem werden die Serien, die großen Formate und diese dekorative Untröstlichkeit produziert. Für die Kunsthistoriker werden andere Dinge produziert, aber wir haben’s natürlich im weitesten Sinne mit einem oligarchischen System zu tun, bei dem Kunsthistoriker und bestimmte Marktspieler entscheiden, was gezeigt wird. Ich sage nicht, dass es diese Kunst gar nicht geben darf, ich will sie nur nicht als dominantes Modell haben. Von einem Kurator oder von einer Kuratorin erwarte ich, dass er oder sie versucht, das Dritte, die Öffentlichkeit, mit im Auge zu behalten und nicht für dieses kleine System zu produzieren.
HH: Herr Gumbrecht, was sind Ihre Ideen, wie die Erfahrung von Kunst einen weiteren Raum bekommen kann?
HG: Ich finde es schon wichtig, dass bestimmte Entscheidungen, auch politische Entscheidungen, auch ökonomische Einflüsse dem Betrachter zugänglich gemacht werden. Ich denke aber, dass die Proportion verrutscht ist. Was ich erwarte, tun jene Kollegen, die Literatur kuratieren, meistens schon. Wenn Sie bei einem Verlag diesen oder jenen Roman lesen können, dann steht dahinter auch schon immer die Entscheidung eines Lektorats, sehr oft eine gute Entscheidung. Das steht aber nicht so sehr im Vordergrund. Um einen großen Kurator von deutscher, aber nicht nur deutscher Literatur zu nennen, der Hanser quasi geschaffen hat: Michael Krüger, den man vor seiner Pensionierung nur wenig gesehen hat. Millionen von Lesern in diesem Land haben Literatur auf einem sehr hohen Niveau gelesen, die ihnen zu guten Preisen präsentiert worden ist, weil er sie ausgewählt hat. Und die undankbare Unsichtbarkeit des Kurators gehört vielleicht zum Beruf. Ich vertrete hier einen konservativen Begriff von Kunst und Literatur, bei dem Kunst in einem ganz naiven, primären Sinn wichtig und zugänglich sein kann. Man könnte auch von der ästhetischen Autonomie reden. Ich denke, dass Kunstwerke eine bestimmte Kraft haben, die sie tendenziell freisetzt von dem Kontext oder den Situationen. Ich denke, es ist möglich, sich auf ein Bild von Rembrandt zu konzentrieren und, obwohl Jahrhunderte dazwischen sind, plötzlich zu sehen, dass das eine Komplexität oder eine Farbe hat, die einen fasziniert. Dieser Moment der Konzentration kann ein Moment der Freiheit sein, in dem vielleicht auch jemand, der nicht Kunstgeschichte studiert, nicht die FAZ oder das ganze ZEIT-Feuilleton am Wochenende durchliest, sagt, mein Gott, das fasziniert mich. Faszinieren, das ist ein Begriff aus dem mittelalterlichen Latein, er bedeutet eigentlich Augenlähmung. Die Faszien sind gelähmt. Man kann nur noch da hinschauen. Und plötzlich erfahre ich eine Intensität der Emotion, die unbeschreiblich groß ist. Ich weiß, dass das der romantischste aller Begriffe von Kunsterfahrung ist, aber ich denke, es ist etwas, was in unserer Umwelt einen neuen Wert hat. Durch die Dauerreflexion, denn wir müssen schon immer reflektieren, und immer weiter reflektieren, drängt man davon ab. Ich glaube außerdem, dass Kunst nicht im Wesentlichen eine Bühne für Politik sein soll. Dafür gibt es die politische Öffentlichkeit. Dafür gibt’s Parteien.

JV: Ich fürchte, Herr Gumbrecht, Sie wecken jetzt gar keinen Widerspruch. Wir sind immer noch auf einer Linie. Bosch wäre bestimmt ein gutes Beispiel, ich weiß aber nicht, ob das auch für Richter gilt. Die ganze Malerei, die ganze Kunst so bis Ende des 19. Jahrhunderts hat einfach den Vorteil, dass sie das privilegierte Bildmedium in diesem Jahrhundert ist. Die Malerei kann etwas, was kein anderes Bildmedium besser kann. Und darum ist ein Rembrandt immer interessant und ein Bosch auch immer interessant, weil es bei diesen Künstlern so viel zu gucken gibt und weil es die privilegierten Überlieferungen visueller Art sind. Da kommt man gar nicht dran vorbei, und das ist auch das Faszinierende daran. Gerade Richter in Baden-Baden ist natürlich ein Beispiel dafür, durch welche Wahrnehmungsschleusen man Sie bringt, bis Sie vor diesem Gemälde stehen. Die Ausstellung im Museum Frieder Burda zu Richters „Birkenau“-Zyklus war begleitet von einer Flut von Veröffentlichungen. Es sind gleichzeitig drei Bücher nur zu diesen „Birkenau-Bildern“ erschienen und dazu noch die Rückblicke von Holocaust-Überlebenden. Dann haben Sie noch die Schleuse des Privatmuseums Burda. Dann haben Sie die Schleuse, dass Sie erst an den abstrakten Amerikanern vorbeikommen, und dann stehen Sie vor Richters Bildern, die „Birkenau“ heißen, was alles ändert. Gegenüber hingen noch dazu die historischen Aufnahmen von 1944, die überliefert worden sind, von den Konzentrationslagerinsassen, die versucht haben, die Gaskammern von Birkenau zu fotografieren. Das ist ja enorm, in was für einen Apparat wir da hineingebracht werden, um dann angeblich naiv davor zu stehen. Richter ist ein Meister darin, die Wahrnehmung seiner Bilder zu steuern, was ich überhaupt nicht negativ finde, und er steht auch dazu. Aber Richter ist natürlich kein Beispiel für naives Erleben und Erfahren.
HH: Ich hau jetzt mal dazwischen und öffne das Podium zum kritischen Publikum.
Publikum: Die Kuratorentätigkeit ist auf jeden Fall, auch wenn die Kunst es vielleicht nicht ist, immer politisch, sie ist immer ein Auswahlverfahren. Es ist immer ein Versuch, eine Vermittlung herzustellen zwischen Herrschaftsbedingungen und Geschmackswünschen im Volk. Es ist mal vom Staat organisiert, mal ist’s privat organisiert. Das heißt, da sind sehr viele Momente, und dieser verwaschene Begriff, der ist mir immer noch sehr unklar. Hat man die Vorstellung, die Kuratoren hätten ’ne Akademie durchlaufen? Welche? Müssen das Historiker sein, müssen das Künstler sein? Ich möchte Sie drauf aufmerksam machen, dass ich als Zuschauer denke, Sie wären hier aufs Podium kuratiert worden. Sie sitzen hier wie im Jungfraujoch in irgendeiner Eisscholle, rot erleuchtet und sind mir total sympathisch, obwohl Sie über Kuratoren reden, wie wenn alle gut werden.
AS: Ich glaube, dass der Begriff des Kurators wirklich auch eine Projektion ist. Wir bezeichnen Harald Szeemann als Kurator, er selbst würde sich als Autorenaussteller betrachten. Dass dieser Begriff so diffus ist, liegt daran, dass es von so vielen Seiten den Anspruch auf die Figur gibt und jeder dadurch den Beruf auch anders versteht. Es gibt Kuratoren, die den Begriff völlig technisch begreifen. Mir geht es darum, dass dieser Begriff, weil er so undefiniert ist, immer auch eine Möglichkeitsform ist, sich diese Tätigkeit anzueignen. Ich kann nur empfehlen, als Künstler die Seite zu wechseln und kuratorische Erfahrungen zu machen, weil man dann auch erfährt, wie die politische Bühne Kunst konstruiert ist. Man kann dann diese Bedingtheit der Konstruktion ausstellen und zugleich erklären. Das heißt also: Wie schreibe ich eine Pressemitteilung? Wie bilde ich Öffentlichkeit? Wie stelle ich das dar? Wen inkludiere ich? Diese ganzen Formen kann man auf einmal selber bestimmen. Und man agiert dann oft gegen Apparate, die immer schon definieren, wie das zu sein hat. Wenn die Pressemitteilung elf Seiten lang ist, dann wird das Museum meistens sagen, das geht nicht, die Presse wird das nicht lesen. Die werden sagen, nur anderthalb Seiten. Dann muss man sich über diese Regeln in dem Punkt hinwegsetzen, weil darin oft auch ein politisches Regime liegt, das in der Verkürzung der Begriffe die Relationsverhältnisse kappt und deshalb auch diese Abhängigkeiten außer Acht lässt.
HG: Die bedeutende Rolle der Konzeptkunst im 20. Jahrhundert hat dazu geführt, dass man dachte, ästhetische Erfahrung lässt sich nur noch mit Gebrauchsanweisung erreichen. Dieser Vorhang stellt sich mit einer großen Autorität zwischen die primären Möglichkeiten der Erfahrung und den Gegenstand. Wenn ich vorher nicht die elf Seiten Pressemitteilung gelesen habe, dann hab ich mich politisch schuldig gemacht. Mir scheint das auch eine Bevormundung zu sein. Wir müssen uns auch einigen, was wir unter „politisch“ verstehen. Dass immer bestimmte politische Konnotationen eine Rolle spielen, werde ich nicht bestreiten.
AS: Es geht nicht darum, dass eine Pressemitteilung eine Zumutung sein muss, sondern dass man sich die Freiheit nehmen sollte, die gesetzten Konditionen zu unterbrechen. Die Bildproduktion stellt an und für sich immer Machverhältnisse her, warum wir Bilder angucken, und auch das Privileg dazu haben zu können, hat etwas damit zu tun. Deswegen kann ich das davon nicht trennen. Ich glaube, dass die Idee von Unmittelbarkeit von Kunst oder der Wahrnehmung ein kolonialistischer Blick ist. Man denkt, ich weiß, wie Kunst auf mich wirkt, weil ich im Grunde schon die Welt weiß und das, was ich sehe. Ich als Wahrnehmungsorgan habe im Grunde das alles in mir drin, und diese Unmittelbarkeit ist dann der Anspruch. Ich glaube, dass es eine Verabredung ist, in der Form, dass man immer mindestens eine Person mehr braucht, die bestätigt, dass das, was ich sehe und für Kunst halte, Kunst ist. Diese Person, das ist die Anwesenheit einer Figur, in der Regel Medien. Ansonsten findet die Kunsterfahrung gar nicht statt.
JV: Ich glaube, dass hier niemand auf dem Podium tatsächlich Unmittelbarkeit verteidigt. Was ich auch mit Herrn Gumbrecht verteidigen würde, ist, dass auf irgendeine Art und Weise das Kunstwerk der Köder sein muss. Wenn ich vor einem Gemälde von Hieronymus Bosch stehe, dann schaue ich gerne lange drauf herum, und irgendwann werde ich mich fragen: Wo kommt das her? Warum hat er das gemalt? Wann hat er das genau gemalt? Wer war der Auftraggeber? Es leitet einen zu anderen Fragen hin, und niemand würde sagen, das ist aber falsch, weil ich Kunst einfach nur auf mich wirken lassen soll. Dieses Grundinteresse muss, davon bin ich überzeugt, hergestellt werden über das, was zu sehen ist. Reinziehen muss einen etwas, das irgendwie Verwunderung oder Faszination auslöst, oder meinetwegen auch Ekel, Bewunderung oder was auch immer.

AS: Aber nimmt der Kurator das weg? Ich verstehe das gar nicht.
JV: Genau das ist das Ideale: Dass der Kurator dafür Verhältnisse herstellt.
AS: Mittlerweile kann man das studieren, „artistic curating“.
Publikum: Seit den 1990ern wurde der Kurator zum Autor und dann zum Superstar. Da sieht man dann plötzlich Kataloge nur mit den Namen der Kuratoren auf dem Umschlag, und die Künstler werden zu Illustrationen ihrer Thesen degradiert.
AS: Das liegt auch an der Professionalisierung, zu der wir neigen. Diese Professionalisierung des Kurators, dass der Künstler da nur noch illustriert wird, das unterschlägt ein bisschen, was das Kapital des Kurators ist. Die klassischen Kuratoren der 1960er, 70er Jahre, die dann in der 80ern richtig groß wurden, zeichneten sich durch ihr Adressbuch aus. Heutige Kuratoren müssen schon Förderung und Kontakt zur Wirtschaft haben, das heißt, dass sie für eine Stadt oder für ein Museum Geld mitbringen, die Drittmittelfinanzierung also schon im Kopf haben. Die Überbeanspruchung dieser Form der Figur führt dazu, dass die Kuratoren dann zu einem Teil der Celebrity-Gesellschaft gehören, mit deren Namen man Öffentlichkeit und eine ganz bestimmte Programmatik verbindet. Das ist eine Form von Geheimwissenschaft, bei der dann die Künstlerliste im Grunde wie ein konkretes Gedicht verrät, um welche Programmatik es sich da handelt. Das zu unterlaufen geht nur, wenn man sich diesen Begriff aneignet, indem man sich den Beruf temporär aneignet. Die Aneignung bedeutet immer nur eine temporäre Intervention in dem hegemonialen Feld Kunst. Das ist das, was man darin leisten kann.
JV: Ich glaube tatsächlich, es ist nicht nur so, dass es einen Kurator gibt, dessen Konzept die Kunst überwölbt, sondern dass die Kunst diesen Kurator geschaffen hat, weil sie ihn braucht. Das ist eine Koevolution. Ich sag überhaupt nicht, dass Kunst voraussetzungslos ist. Aber es gibt ja keinen Roman, der sagt, bevor Sie dieses Buch lesen, müssen Sie aber auch noch das und das wissen. Natürlich kann man immer noch was dazu lesen, und das ändert das Verständnis. Bei der Kunst aber hat man sich total daran gewöhnt, dass diese ganzen Erklärungstexte wie Beiboote herumschwimmen und dauernd während der Fahrt etwas Neues darauf geworfen werden muss, damit man überhaupt folgen kann oder irgendeinen Anknüpfungspunkt findet. Eine bestimmte Richtung der konzeptuellen Kunst hat sich diesen Kurator geschaffen, über den sie jetzt klagt.
HG: Richter braucht Erklärung, ist konzeptuell. Um diese Bilder, die zuerst nur weiß aussehen und sich plötzlich in ihren Schattierungen enthüllen, verstehen zu können, muss man sicher zunächst durch einige Schleusen des Kuratierens gehen. Ich behaupte, dass das bei Jackson Pollocks Number 5 nicht der Fall ist. Dieses Bild kann einen plötzlich überfallen, überraschen – mich überfällt es jeden Morgen.
JV: Hängt das bei Ihnen zu Hause?
HG: Ja, über meinem Schreibtisch, in Originalgröße – und natürlich leider als Kopie! Ich würde gerne auf den Begriff des Politischen zurückkommen. Ich finde es immer eigenartig, dass Leute, die sich auf Kunst konzentrieren oder auch auf Philosophie oder Literatur, immer denken, was sie sagen oder schreiben, müsse politisch sein, weil es anders keine Legitimität habe. Man kann natürlich Politik so definieren, dass alles immer politisch ist. Aber ist das tatsächlich so wichtig für die Erfahrung von Kunst oder Literatur?
AS: Zur Konzeptkunst: Warum kam die hoch, und warum ist das ein Tool gewesen? Weil wir Kalten Krieg hatten. Natürlich war die Documenta selbst, als eine Form von Ausstellung am Eisernen Vorhang, ein demonstrativer Akt. Das ist immer ein politisches Interesse gewesen. Genauso ist es mit Jackson Pollocks Number 5. Jeder hat zumindest Serge Guilbauts Wie New York die Idee der modernen Kunst gestohlen hat gelesen. Man weiß, Jackson Pollock war wie viele andere Künstler in Gruppierungen, die auch von der CIA überwacht wurden. Er ist ganz bewusst herauskristallisiert worden, weil seine Bilder zu betrachten eine Form von Erschütterung produziert, wenn der kartographische Blick aus den drippings Bombentrichter werden lässt. Das heißt, dass wir Jackson Pollock überhaupt kennen, hat damit zu tun, dass der Einfluss u.a. von der CIA auf ein ganzes Kunstumfeld in der ideologischen Hochphase des Kalten Krieges und der Post-McCarthy-Ära diese Bilder medial überproportional rausgebracht hat. Deswegen glaube ich nicht, dass nur die Wirkungsmacht des Bildes selber das gemacht hat, sondern dass es das ganze Gefüge produziert hat. Natürlich kann man das immer wieder behaupten, aber es unterschlägt, wie die Geschichte eines Bildes und das Bild der Geschichte mit zur Vermittlung gehören. Das Bild in seiner Fokussierung auf die „Brutalität“ auf sich wirken zu lassen, würde die Eroberung, die das Bild als Funktion hatte innerhalb des Kalten Krieges, als Bildpolitik, unterschlagen. Ich will nicht sagen, dass wir das Bild deswegen abhängen, es geht aber darum, nicht zu monopolisieren und zu hegemonisieren, sondern zu relativieren. Das unterminiert diese „universelle“ Behauptung durch eine permanente Befragung seiner Instrumentalisierung in den verschiedenen Kontexten von Ausstellungen und Präsentationsformen.
Publikum: In der Kunstwelt haben Sie heute ja häufig Werke in verschiedenen Versionen. Wenn man jetzt von Installationen mit Bewegtbildern spricht oder eben filmischen Werken in Ausstellungen, gibt es diese Werke in verschiedenen Versionen, je nachdem, wo Sie sie zeigen. Wenn Sie zum Beispiel ein Werk in der Ausstellung in einem installativen Aufbau zeigen, werden manchmal zweikanalige Produktionen als Single Channel zusammengeschnitten, damit sie auch im Kontext eines Filmfestivals gezeigt werden können. Ich finde diesen Aspekt interessant, dass Künstler nichts dagegen haben oder sich verschiedener Öffentlichkeiten erfreuen und bereit sind, ihre Werke so aufzubereiten.
HG: Das hat möglicherweise mit einer Dimension zu tun, die nicht nur auf ein einziges Medium der Kunst zutrifft, nämlich mit der Performanz. Das ist nicht das isolierte Kunstwerk, sondern das Kunstwerk im Raum. Denken Sie an eine Performance von Abramović, die sozusagen nie dieselbe sein kann, von Sekunde zu Sekunde nicht dieselbe sein kann. Sie steht im Kontrast zum Kunstwerk des 18. Jahrhunderts, das statisch war, auch bei einem Drama von Goethe dachte man wohl nur an eine Version. Im 20. Jahrhundert hat sich das Drama verflüssigt. Es gibt eine Serialität der Performanzen. Das schließt auch eine Transformation in der Kunstszene des 20. Jahrhunderts ein. Wir denken nicht nur an einzelne Bilder, sondern schließen viele andere Szenen und Bedingungen mit ein.
Publikum: Das hängt aber auch sehr stark mit den aktuellen Medien zusammen, mit den Produktionsbedingungen und Möglichkeiten, die sich da eröffnen.
HG: Ich versuche zu formulieren, was mein Eindruck der Diskussion ist. Ich bin eingeladen worden. Das war die Politik der Kuratorin, der Metakuratorin sozusagen. Jetzt habe ich das bloßgelegt. Und wir haben dem Publikum nun in vielen Worten – kuratierend sozusagen – klargemacht, was es ohnehin schon weiß. Ich fühle da eine enorme Sorge um das Publikum, eine sozialdemokratische Sorge sozusagen, das Publikum nicht alleine zu lassen. Nichts als gute Absichten stehen hinter dieser Sorge – aber sie neigt zum Trivialen und nimmt am Ende dem Publikum die Möglichkeiten einer eigenen, autonomen Erfahrung.
JV: Ich finde, dass das Problem unserer Zeit gerade nicht darin besteht, dass es zu viel Sorge um die Einzelnen gibt, sondern dass es im Kunstbetrieb leider in exponierter Stellung eine Umschichtung von Geldern gibt: von öffentlichen in private, von unten nach oben. Da brauchen wir dringend Gegenstrukturen. Das macht mir mehr Sorge als die Überbetreuung. Und ich glaube, dass dieser unbedingte Glaube an die Kunst ein Produkt der Nachkriegszeit gewesen ist. Diese Kunstwahrnehmung kommt sehr stark aus der Verfolgung der Künste in den großen Diktaturen. Daraus entwickelte sich wiederum dieser Glaube, dass eine freie Kunst in einer demokratischen Gesellschaft was weiß ich für Kräfte freisetzen kann. Ein Umdenken oder eine gewisse Ehrlichkeit muss auch um das Kunstsystem einsetzen und sich auch viel besser organisieren.
AS: Ich plädiere für den Begriff der Intervention. Und möchte noch etwas zur Nische sagen. Ich finde Nische total wichtig, aber man muss die Nische auch in dem Punkt so präsentieren, dass sie auch in dem hegemonialen Feld interveniert, denn ansonsten bleibt sie da, wo sie ist. Dass man das also mit der Geste macht, dass das hegemoniale Feld weiß, dass es hegemonial eben nicht alles repräsentiert. Wieso müssen in Venedig – um den Bogen zu schließen – solche Millionärssammlungen noch diese Öffentlichkeit generieren? Die Sammler brauchen diese Öffentlichkeit zur Wertbildung, zu ihrer Form von hegemonialer Geschichtsschreibung. Sie bestimmen im Augenblick, was in der Geschichtsschreibung als Bild gilt, und das ist dann Politik. Deswegen sag ich, man muss intervenieren, dass man damit nicht einverstanden ist.
Veröffentlichung in Zusammenarbeit mit den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen.








Kommentare zu „Vom Unbehagen mit dem Kurator“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.