Visuell überbordend, innerlich zerrissen – Retrospektive zum Hongkong-Kino
Unter dem Titel "Splendid Isolation" zeigt das Berliner Arsenal im März eine große Reihe zum Hongkong-Kino von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Handover im Jahr 1997. Eine einmalige Gelegenheit, um sich zu überzeugen, wie exzessiv und ungeniert, wie dynamisch und farbenprächtig, wie mitreißend und hyperemotional das Kino aus der ehemaligen Kronkolonie war – auf 35 mm.

Das Codewort lautet Pekingente, wenn auch vielleicht nur in der deutschen Übersetzung. Für die fünf schneidigen Revolutionäre, die in Tsui Harks Peking Opera Blues (1986) Anfang der 1930er Jahre gegen dämonische Kriegsherren und für die Demokratie kämpfen, ist es der Schlüssel zu einer konspirativen Gegenwelt – zumindest für den, der weiß, was er darauf zu antworten hat. Es passt ganz gut, dass der Dreh- und Angelpunkt der Handlung eine Bühne für Pekingopern ist. Ständig geht es darum, sich zu verkleiden, eine falsche Identität anzunehmen oder den eigenen Vater über seine politische Gesinnung zu belügen. Und im Hintergrund dieses endlosen Tarn- und Versteckspiels zieht eine Theaterwelt vorbei, in der Männer nicht nur sämtliche Frauenrollen übernehmen müssen, sondern dadurch auch mal zum Objekt der Begierde eines ebenfalls ausschließlich männlichen Publikums werden.
So wie sich die Spannung des Films häufig auf dieses eine Codewort konzentriert, weil es von einer repressiven politischen Wirklichkeit in eine Utopie führt, die erst noch umgesetzt werden muss, so führen Missverständnisse um seine Bedeutung immer wieder zu komischen Situationen. Zum Beispiel gibt die sympathisch unbedarfte Musikerin und Gelegenheitsdiebin Sheung Hung zwar nicht die korrekte, aber doch die nächstliegende Antwort auf die Nennung des Nationalgerichts: „Schmeckt gut.“
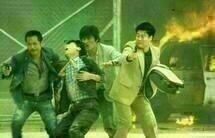
Unter dem Titel „Splendid Isolation“ zeigt das Berliner Arsenal vom 1. bis zum 28. März eine große Reihe zum Hongkong-Kino, die einen Bogen von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Handover im Jahr 1997 spannt. Peking Opera Blues wirkt wie ein Paradebeispiel der Reihe, weil darin das In-der-Luft-Hängen zwischen zwei Welten wie die Allegorie auf ein Land wirkt, das lange nach seiner Identität gesucht hat – und sie mit dem steigenden politischen Einfluss der Volksrepublik und der zunehmenden Konzentration auf den gesamtchinesischen Filmmarkt heute wieder neu bestimmen muss. Hongkong war während und nach dem Krieg ein Hort für zahlreiche Flüchtlinge vom kommunistischen Festland. Die Filmindustrie orientierte sich zwar schon früh an Mustern aus Hollywood und genoss weniger strenge Zensurbestimmungen, griff aber eben auch traditionell chinesische Einflüsse aus dem Shanghaier Kino der Vorkriegszeit und der Pekingoper auf. Daraus hat sich eine Kinematografie entwickelt, in der die innere Zerrissenheit zum Leitmotiv wurde.
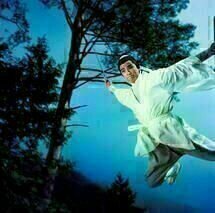
Aber Tsuis Film steht auch wegen seines visuellen Reichtums und des lässigen Umgangs mit unterschiedlichen Genres und Erzählsträngen exemplarisch für die Vielfalt und gut eingespielte Routine des Hongkong-Kinos. Es gibt wenig, was Peking Opera Blues auslässt; er ist Historienfilm, Buddy-Komödie, Martial-Arts-Reißer, Musikfilm und Melodram. Und so souverän, wie er seine höchst unterschiedlichen Figuren zu einem Kollektiv zusammenbringt, in dem man sich eher ergänzt als im Weg steht, so geschmeidig wechselt Tsui auch ständig den Erzählton, ohne dabei jemals den Überblick zu verlieren. Ähnlich wie King Hus poetische Wuxia-Filme für die legendäre Produktionsfirma Shaw Brothers in den 1960er Jahren verbanden auch zwanzig Jahre später die Vertreter der ersten Neuen Welle aus Hongkong – zu der neben Tsui etwa auch Ann Hui und Patrick Tam zählen – Autorensensibilität und Kassenerfolg. Letztere bilden damit eine Ausnahme unter all den Aufbruchsbewegungen im Weltkino, denn sie verstanden sich nicht als Opposition zum populären Film, sondern agierten innerhalb einer auf Stars und Genrestoffe ausgerichteten, kommerziellen Filmindustrie.

Wie wichtig diese vom Kuratorenkollektiv The Canine Condition zusammengestellte Reihe ist, zeigt schon ein Blick darauf, wie stiefmütterlich Kinematheken im deutschsprachigen Raum nicht nur das asiatische, sondern auch das Mainstream-Kino jenseits von Hollywood behandeln – besonders wenn es sich um Exploitationregisseure wie Chang Cheh handelt, dessen Kung-Fu-Filme zwar hierzulande zahlreich auf DVD verfügbar, aber letztlich zu grob und actionreich sind, um auch die hohen Weihen der Kunst zu bekommen. Dass man heute außerdem kaum noch 35mm-Kopien aus Hongkong bekommt, die Retrospektive aber trotzdem ausschließlich analog bestritten wird, ist ein kleines Wunder. Man sollte diese einmalige Gelegenheit nutzen, um sich davon zu überzeugen, wie exzessiv und ungeniert, wie dynamisch und farbenprächtig, wie mitreißend und hyperemotional das Kino aus der ehemaligen Kronkolonie sein konnte. Nicht zuletzt auch, weil man dort erfährt, was die korrekte Antwort auf das Codewort Pekingente ist.



















Kommentare zu „Visuell überbordend, innerlich zerrissen – Retrospektive zum Hongkong-Kino“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.