Unterschwellige Tragik: Retrospektive Antonio Pietrangeli
Vom Neorealismus zur Commedia all’Italiana arbeitete Antonio Pietrangeli mit führenden Vertretern des italienischen Kinos zusammen, doch ein vergleichbarer Ruf blieb ihm verwehrt. Das Berliner Arsenal zeigt im Mai ein Werk, das zwischen Unterhaltung und Gesellschaftskritik vermittelt – und immer wieder Tabus brach.
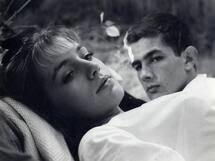
Über den 1968 bei einem Badeunfall früh verstorbenen Regisseur Antonio Pietrangeli, dem das Berliner Arsenal in diesem Monat eine ausführliche Retrospektive widmet, ist nur wenig bekannt. Begonnen hatte der 1919 geborene Römer früh als Filmkritiker, bevor er erstmals 1942 als Regie-Assistent von Luigi Chiarini bei Via delle cinque lune direkt am Set mitwirkte. Bis zu seiner ersten eigenständigen Regie sollte noch mehr als ein Jahrzehnt vergehen – eine Phase, die Pietrangeli intensiv als Drehbuchautor nutzte. In dieser Funktion war er maßgeblich an der Erneuerung des italienischen Kinos beteiligt. Bei Ossessione (1942), einem Schlüsselwerk des Neorealismus unter der Regie von Luchino Visconti, wirkte er als Regie-Assistent und Drehbuchautor mit, eine Zusammenarbeit, die sich bei Die Erde bebt (La terra tremat, 1948) wiederholte. Mit weiteren führenden Vertretern des Neorealismus wie Alberto Lattuada (Il nostra guerra, 1945) und Die Wölfin von Kalabrien (La lupa, 1953)), Pietro Germi (Strandgut der Sünde (Gioventù perduta, 1948)), Alessandro Blasetti (Fabiola, 1949) oder Roberto Rossellini (Europa ’51", 1952) arbeitete Pietrangeli eng zusammen. Eine ähnliche Reputation blieb ihm allerdings größtenteils verwehrt.
Tabubrüche ohne Voyeurismus

Seine Filme nahmen einen unterhaltsamen, in der Moderne der Nachkriegszeit verankerten Charakter an, der die tragische Komponente unterschwellig entwickelte und damit signifikant für die Commedia all’italiana steht. Selbst in seinem ersten Film Sonne in den Augen (Il sole negli occhi, 1953), dessen Stil noch spürbar im Neorealismus wurzelt, widmete sich Pietrangeli seinem bevorzugten Thema: der Sozialisation am Beispiel des Verhältnisses von Mann und Frau, dabei das Gewicht eindeutig auf die Frauen legend, aus deren Blickwinkel die meisten seiner Filme erzählt sind. Viele weiblich assoziierte Elemente prägten seine Filme: Kleidung, Schmuck, Familie, Kinder, Gespräche über Männer, Tanz und Musik. Die Frauen selbst fing die Kamera ohne jeden Voyeurismus ein, und verlieh ihnen eine Leichtigkeit, die die Ernsthaftigkeit dahinter oft übersehen ließ.

Pietrangelis Realismus zeigte sich nicht im konkreten Aufzeigen gesellschaftlicher Missstände, sondern in der Beobachtung der kleinsten Zelle – dem Umgang der Menschen untereinander. Das entbehrte nicht Temperament, Freude und Glück, ließ aber Abhängigkeit, Machtmissbrauch und moralische Verlogenheit ebenso deutlich werden. Die Filme brachen immer wieder Tabus. Sexuelle Belästigungen, unehelicher Geschlechtsverkehr und daraus folgende Schwangerschaften sind bei Pietrangeli ebenso alltäglich wie das ständige Jonglieren der Frauen zwischen jungfräulicher Außendarstellung und dem Begehren der Männer. In Adua und ihre Gefährtinnen (Adua e le compagne, 1960) gab er diesem Zwiespalt ganz konkret Gestalt, indem er den Versuch von Prostituierten beschrieb, nach dem staatlichen Verbot von Bordellen wieder eine bürgerliche Existenz aufzubauen – ein von vornherein zum Scheitern verurteiltes Ansinnen, dem der Regisseur trotzdem humorvolle Momente abgewinnen konnte.
Ständige Wegbegleiter

Sein eigenständiger zwischen Unterhaltung und Drama vermittelnder Stil war auch der engen Zusammenarbeit mit Regisseuren, Drehbuchautoren und Darstellern zu verdanken, von denen ihn einige während seiner zu kurzen Karriere intensiv begleiteten. Der Episodenfilm Amori di mezzo secolo (1954), zu dem er Girandola 1910 beitrug, war die erstmalige Zusammenarbeit mit Ettore Scola. Bis zu Ich habe sie gut gekannt (Io la conoscevo bene) Mitte der 1960er Jahre sollte dieser – abgesehen von Souvenir d’Italie (1957) – Pietrangeli als Co-Autor begleiten. Die Kombination aus Gesellschaftskritik und Unterhaltung verband beide Künstler, auch wenn Scola in seinen eigenen Regie-Arbeiten zu einer kompromissloseren Sichtweise wechselte. Mit Ruggero Maccari stieß ab Pietrangelis folgendem Film Lo scapolo (1955) ein weiterer ständiger Wegbegleiter beim Schreiben hinzu.

Neben dieser gestalterischen Kontinuität wurde die Besetzung einer Vielzahl weiblicher Stars prägend für Pietrangelis Oeuvre. Neben Sandra Milo, die in Lo scapolo ihre Karriere begann und in Adua und ihre Gefährtinnen, Das Spukschloß in der Via Veneto (Fantasmi a Roma, 1961) und Der Ehekandidat (La visita, 1963) weitere Hauptrollen unter seiner Regie spielte, besetzte Pietrangeli bekannte Darstellerinnen wie Claudia Cardinale, Simone Signoret, Catherine Spaak, Stefania Sandrelli, Jacqueline Sassard, Emanuelle Riva oder Belinda Lee in seinen spezifischen Frauenrollen. Auch die männlichen Darsteller Alberto Sordi, Gabriele Ferzetti, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi und Nino Manfredi traten mehrfach in seinen Filmen auf.
Überfälliger Blick aufs Gesamtwerk

Erst Pietrangelis letzter vor seinem Tod fertig gestellter Film Ich habe sie gut gekannt (1965), der die Retrospektive im Arsenal eröffnet, erhielt die verdiente offizielle Anerkennung. Die Geschichte vom hübschen Landmädchen, das Schauspielerin werden will und den typischen gesellschaftlichen Mechanismen ausgeliefert wird, ist großartig erzählt und inszeniert, aber letztlich nur Beispiel für eine Reihe herausragender Filme, die sich auf vielfältige Weise der menschlichen Sozialisation widmen. Vor allem in Unkenntnis seines übrigen Werks wird Ich habe sie gut gekannt daher häufig als sein bester Film angesehen.

So gibt es ab dem 5. Mai die einmalige Gelegenheit, einen Blick auf dieses Gesamtwerk zu werfen. Selbst Fata Marta, Pietrangelis Beitrag zum Episodenfilm Le fate (1966), der ihn mit Luciano Salce, Mario Monicelli und Mauro Bolognini – weitere Protagonisten der Commedia all’italiana – zusammenführte, wird zu sehen sein. Ebenso der sehr rare Come, quando, perché (1969), den Valerio Zurlini nach Pietrangelis Unfalltod zu Ende führte – ein Bruder im Geiste, dessen Wurzeln ebenfalls im Neorealismus zu finden sind und der sich wie Pietrangeli in seinen Filmen intensiv der sich verändernden Sozialisation, besonders im Hinblick auf die Rolle der Frau, nach dem Krieg widmete.
Zum Programm der Reihe geht es hier.









Kommentare zu „Unterschwellige Tragik: Retrospektive Antonio Pietrangeli“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.