Jede Projektion ein Akt der Zärtlichkeit
Über lustbetonte Off-Festivals, die sich um ihre Anschlussfähigkeit an den Betrieb nicht scheren – und es ihren Besuchern ermöglichen, über die Bedingungen ihrer Entfremdung selbst zu entscheiden.
1. Filme, die im Allgemeinen keinerlei Qualitäten besitzen
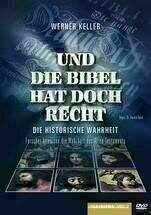
„Und die Bibel hat doch recht“ heißt ein Sachbuchbestseller von Werner Sommer aus dem Jahr 1963, der die religiöse Schrift am damals aktuellen Forschungsstand der Geschichtswissenschaft und der Archäologie abglich. Schon der Buchtitel verrät das Ergebnis der Unternehmung. „Und die Bibel hat doch recht“ wurde zu einem Bestseller und auch verfilmt – allerdings mit deutlicher Verspätung: 1976/77 bereiste der Unterhaltungskinoroutinier Dr. Harald Reinl auf den Spuren Sommers zahlreiche biblische Städte im Nahen Osten, im Oktober 1977 kam sein Film dann in die Kinos, sorgte dort wohl nicht gerade für helle Aufregung und verschwand anschließend in der Versenkung. Gut, immerhin existiert eine Special-Interest-DVD-Veröffentlichung, aber warum sollte jemand auf die Idee kommen, den Film noch einmal im Kino zeigen zu wollen?
Tatsächlich war Reinls … und die Bibel hat doch recht diesen Juli beim im Nürnberger KommKino stattfindenden „STUC – 4. Wochenende des stählernen Films“ nicht nur Teil des Programms, sondern als Eröffnungsfilm außerdem ziemlich prominent platziert. Die Veranstaltung ist Teil eines kleinen, informellen Festivalnetzwerks, das sich der (Wieder-)Entdeckung von Filmen verschrieben hat, die von der dominanten Filmgeschichtsschreibung vernachlässigt werden. Tatsächlich ist der STUC selbst im Kreis dieser Off-Festivals noch einmal ein Außenseiter: Hier geht es nicht darum, zu Unrecht Vergessenes und Übersehenes auszugraben – sondern darum, eben jene Filme aus den hinteren, gammligen Regalen der Archive zu bergen, die auf den ersten Blick durchaus zu Recht vergessen sind oder die möglicherweise überhaupt nie wirklich jemanden interessiert haben.
Denn tatsächlich, um die Frage noch einmal zu wiederholen: Warum würde jemand auf die Idee kommen, …und die Bibel hat doch recht noch einmal im Kino vor (zahlendem) Publikum aufzuführen? Eine naheliegende Rechtfertigung wäre: Vielleicht ist der Film ja ein bizarres Dokument der evangelikalen Gegenaufklärung? Nach der Sichtung kann die Antwort nur lauten: Nein, ist er nicht. Keineswegs geht es dem Film darum, bibeltreuen, kreationistischen Wunderglauben gegen die Naturwissenschaften auszuspielen. Die Bibel hat, folgt man dem Film, nicht deshalb recht, weil Gott die Welt in sieben Tagen erschuf, weil er die sündige Menschheit mit einer Sintflut bestrafte und weil Moses beim Auszug aus Ägypten das Rote Meer teilte. Sondern weil einige in der Bibel erwähnten Orte und Personen auch in nichtbiblischen Dokumenten auftauchen. Und weil Teile Mesopotamiens möglicherweise irgendwann einmal von sintflutartigen Überschwemmungen heimgesucht wurden.
Die Sache mit dem geteilten Meer wiederum basiert, lernt man, ohnehin auf einem Übersetzungsfehler. Und dann desavouiert der Film dieses eh schon wenig spektakuläre Programm auch noch mit plumpen rhetorischen Tricks: Die historische Existenz Batsebas, der Offiziersgattin, die mit König David zunächst eine außereheliche Affäre hatte und anschließend dessen achte Frau wurde, sei zwar nicht erwiesen, gesteht der Sprecher ein; sehr wohl wisse man jedoch, dass es im alten Ägypten Frauen gegeben habe, die Männer mithilfe ihrer körperlichen Reize und entsprechender Aufmachung verführten (der Sexismus dieser Argumentation, das merkt man schnell, unterläuft dem Film nicht einfach). Fragen des Glaubens behandelt der Film fast überhaupt nicht. Stattdessen wird mit viel Aufwand wieder und wieder nachgewiesen, woran eigentlich niemand ernsthaft zweifeln kann: dass die Bibel zumindest auch als eine historische Chronik verfasst wurde und sich deshalb zwangsläufig die eine oder andere Parallele zur historischen oder geografischen Realität einstellt.
Ist der Film wenigstens „so schlecht, dass er schon wieder gut ist“? Wieder: Nein, ist er nicht. Selbst unter allgemeiner gefassten Trash- oder Camp-Aspekten macht …und die Bibel hat doch recht nicht viel her. Als der kompetente Handwerker, der er ist, verleiht Reinl auch diesem eher sonderbaren Projekt eine glatte, professionelle, bruchlose Oberfläche. Geduldig arbeitet sich der weitgehend nüchterne Voice-over-Kommentar vom Alten zum Neuen Testament vor, Originalaufnahmen aus Israel, Ägypten und anderen Ländern wechseln sich im besten Infotainmentstil ab mit historischen Dokumenten und Bibelillustrationen. Die Musik von Eberhard Schoener ist teilweise sogar ziemlich gut. Es hilft alles nichts: Wir schauen uns im KommKino am Abend des 6. Juli 2018 eine gut abgehangene 90-minütige Bibelstunde an, die mit ein paar weitgehend nichtssagenden historiografischen Fußnoten unterfüttert ist. Noch dazu ist die 35mm-Kopie, die zur Aufführung kommt, bereits reichlich rotstichig, was die teils durchaus beachtlichen Naturschönheiten, die Reinls Kameramann Ernst Wild einfängt, doch gehörig eintrübt.
Ein letztes Mal die Frage: Warum? Warum einen Film zeigen und anschauen, wenn es doch so gar keinen Grund gibt, dies zu tun? Die Antwort kann nur lauten: eben deshalb! Gerade weil es keinen Anlass, keine nachvollziehbare Rechtfertigung dafür gibt, … und die Bibel hat doch recht noch einmal im Kino zur Aufführung zu bringen, lohnt es sich, ihn zu zeigen.
Erst aus dieser Perspektive kommt die Radikalität des STUC in den Blick: Er stellt nicht einzelne Qualitätskriterien oder cinephile Ordnungssysteme infrage, sondern das Konzept „Relevanz“ an sich. Denn plötzlich erkennt man: Bei den meisten anderen Festivals, vor allem bei den größeren, bei jenen, die die meisten Schlagzeilen machen, geht es gar nicht darum, Filme zu zeigen und anzuschauen. Sondern es geht darum, diskursive Mechanismen aufzurufen, die die gezeigten Filme mit Relevanz aufladen. Das beginnt bei dem Fetisch für Welt-, Europa-, Deutschlandpremieren, dem die allermeisten Festivals erliegen. Die bloße Tatsache, dass er noch nie vorher (hier) zu sehen war, also eine dem jeweiligen Film selbst komplett äußerliche Zufälligkeit, wird zum hauptsächlichen Grund dafür erklärt, ihn zu zeigen. Die Rhetorik der Erst- und Neuheit ist in der Film- und Festivalkultur auch ansonsten erdrückend allgegenwärtig: Hier wird sehnsüchtig der neue Film von Regisseur X erwartet, dort eine „neue Welle“ im Land Y herbeigeschrieben. Und wenn das alles noch nicht ausreicht, sind die Filme, laut Katalogtext, „am Puls der Zeit“, oder sie behandeln, im Fall von Wiederaufführungen, Themen, die „gerade heute wieder aktuell“ sind.

So sind besonders Filme, die auf großen Festivals ihre Premiere feiern, bereits in mehrfacher Hinsicht überdeterminiert, bevor auch nur ein einziges Bild auf der Leinwand erschienen ist. Die kuratorische, oder vielleicht besser antikuratorische Haltung des STUC läuft hingegen, konsequent zu Ende gedacht, auf das glatte Gegenteil heraus: Die bloße Existenz eines Films ist nicht nur Grund genug, ihn zu zeigen – sie ist auch der einzige echte Grund. Erst wenn ein Festival die Filme, die es zeigt, nicht mehr nach Kriterien der tagesaktuellen, kulturellen, künstlerischen oder sonstigen Relevanz auswählt, nehmen wir die Filme als Filme und nicht mehr als Ausgangspunkt der einen oder anderen Debatte wahr.
Das ist natürlich eine radikale und in dieser Radikalität in der filmkulturellen Praxis schlichtweg nicht realisierbare Position. Noch dazu entspricht sie nicht einmal der empirischen Realität des STUC, sondern stellt lediglich eine idealistische Projektion meinerseits dar. Schließlich zeigt auch der STUC nicht irgendwelche, sondern eben „stählerne“ Filme. Wobei allerdings die Definition von kinematografischem Stahl so rätselhaft bleibt wie die Bedeutung des „U“ im Festivalnamen. Auf der (nicht öffentlich zugänglichen) Facebook-Seite der Veranstaltung ist zu lesen: „Die Definition eines stählernen Films ist schnell getan: Filme, die im allgemeinen keinerlei Qualitäten besitzen, weder optisch noch inhaltlich; Filme, die weder wirklich gut sind noch so schlecht, dass sie dadurch wieder an Reiz gewinnen; Filme, bei denen kein Gag zündet und keine Emotionen geweckt werden […]“.
Auf … und die Bibel hat doch recht trifft die Definition zu, wie die Faust aufs Auge sogar. Auf einige andere Filme des Programms freilich keineswegs. Bob Rafelsons Spätwerk Man Trouble (1992) beispielsweise erwies sich, seinem schlechten Ruf zum Trotz, als ein auf einnehmende Art verquerer Nachzügler des New-Hollywood-Kinos. Und Hermann Schnells Psychologie des Orgasmus (1970), in dem acht junge Menschen nackt auf einem durchsichtigen Plastiksofa sitzen und einer Therapeutin von ihren sexuellen Problemen erzählen, darf gar als eine veritable Entdeckung gelten: Ein faszinierender, weil bis zu einem gewissen Grad tatsächlich aufgeklärter Aufklärungsfilm ist das, außerdem ziemlich ambitioniert designt, mit einem psychedelisch-popsurrealistischen Drall. Ein Film, der jeder Retrospektive zum „Kino um 1968“ zur Ehre gereichen würde. Und was hat es damit auf sich, dass auch ein durchaus geläufiges Spätwerk des Neuen Deutschen Films ins Programm genommen wurde, allerdings als ein Beispiel für eines nicht „stählernen“, sondern „bleiernen“ Kinos? So oder so: Der STUC setzt sich seine Regeln selbst. Und er nimmt sich die Freiheit heraus, die selbstgesetzten Regeln auch wieder zu brechen.
2. Zwei Arten von Filmfestivals
Hinzu kommt: Der STUC ist ein Extremfall. Es ist gut, dass es ihn gibt, aber vermutlich ist es auch gut, dass er nur einmal im Jahr stattfindet und nach drei Tagen wieder vorbei ist. Länger würden auch die Härtesten die radikale Umwertung aller Werte, die absolute Abwesenheit aller Relevanz nicht durchstehen. Aber mein diesjähriger erster (und sicher nicht letzter) STUC-Besuch hat mir noch einmal nachdrücklich vor Augen geführt, weshalb mich Veranstaltungen wie diese so viel mehr interessieren als „echte“ Filmfestivals.
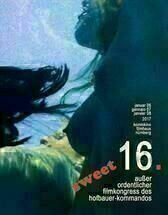
Denn es gibt, in meiner Erfahrung, zwei Arten von Filmfestivals: die offiziellen und die inoffiziellen. Die offiziellen finden zumeist im Jahresrhythmus statt, erhalten mehr oder weniger großzügige staatliche Förderung, werden arbeitsteilig organisiert und haben ein Nahverhältnis zum Repräsentationellen (und deshalb zur Relevanz), was bereits damit anfängt, dass sie zumeist (auch) nach der Stadt benannt sind, in der sie stattfinden. Und es setzt sich fort in ihrer Vorliebe für Wettbewerbe, Preisverleihungen sowie, siehe oben, Weltpremieren. Die inoffiziellen oder Off-Festivals haben zumeist keinen regelmäßigen Spieltermin, teilweise auch keine fixe Spielstätte, sie erhalten keine oder kaum Förderung, die Teams bestehen oft nur aus zwei, drei, vier Filmliebhabern, die alle anfallende Arbeit, zum Teil sogar die Projektion, übernehmen – was natürlich, das sei gleich dazugesagt, fast immer in krasser Selbstausbeutung resultiert. Und sie feiern nicht das Repräsentative, sondern das Idiosynkratische.
Ich selbst besuche seit einigen Jahren immer seltener Festival der ersten und immer häufiger Festivals der zweiten Art. Mein Erweckungserlebnis fand im selben Kino statt, das auch den STUC beherbergt: Im Dezember 2012 war ich erstmals im KommKino zu Gast, beim „10. Außerordentlichen Filmkongress des Hofbauer-Kommandos“. Die „Hofbauer-Kongresse“ waren damals noch reine Undergroundveranstaltungen: Eine Gruppe Filmverrückter schließt sich ein Wochenende lang in einem – damals noch eher ranzigen, heute grundrenovierten – Kinosaal ein und schaut sich einen sonderbaren Film nach dem anderen an. (Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass auf den Kongressen Außergewöhnliches vor sich geht, die Vorführungen finden teilweise vor ausverkauftem Saal statt und ziehen Filmliebhaber aus ganz Deutschland an; der STUC hingegen hält den älteren, klandestinen, dezent asozialen Spirit am Leben.) Ich war auf Anhieb begeistert davon, wie bei den Kongressen Filme gezeigt und über Filme gesprochen wird – von einer Cinephilie, die gleichermaßen lustbetont, neugierig und unprätentiös auftritt.
Und die sich dabei kein bisschen um ihre Anschlussfähigkeit an den Betrieb schert. Natürlich kann man auch andere Filmfestivals, die großen, offiziellen, einfach als eine Gelegenheit betrachten, in kurzer Zeit viele interessante Filme zu sehen. Aber wenn man an Film mehr als nur ein beiläufiges Interesse hat, dann drängt sich schnell das geschäftige Hintergrundrauschen in den Vordergrund. Dann merkt man schnell: Filmfestivals sind immer auch Branchentreffen, Gelegenheiten zum „Netzwerken“ (ein Schauder läuft mir auch heute noch jedes Mal über den Rücken, wenn ich das Wort affirmativ verwendet höre oder lese); Karrieren wollen vorangetrieben werden, und manchmal wollen auch, auf sogenannten Filmmärkten, Filme verkauft werden. Es gibt spezielle Vorführungen für die Presse, und selbst in den öffentlich zugänglichen trifft man andauernd auf Leute, die das gleiche oder ein anderes Akkreditierungskennzeichen wie man selbst um den Hals hängen haben. All das steht für und etabliert ein instrumentelles Verhältnis zum Kino. Es gibt nicht mehr bloß die Filme auf der einen und die interessierten, hingerissenen oder auch entgeisterten Zuschauer auf der anderen Seite; vielmehr sind Filme und Zuschauer in einen beide Seiten umgreifenden Funktionszusammenhang integriert.
Auf einer analytischen Ebene mag das auch für die Off-Festivals gelten. Einen Raum komplett jenseits der kapitalistisch-kulturbürokratischen Entfremdung stellen auch sie nicht zur Verfügung. Das individuelle Festivalerlebnis ist dennoch ein völlig anderes. Wer ein Off-Festival besucht, wird hoffentlich glücklicher und möglicherweise klüger, im Leben vorankommen wird er oder sie dadurch nicht. Ich bin, wenn ich ein Off-Festival besuche, nur deshalb hier, um gemeinsam mit anderen Menschen Filme zu sehen, und ich weiß, dass alle anderen aus mehr oder weniger demselben Grund hier sind. Man könnte vielleicht sagen: Die Off-Festivals ermöglichen es ihren Besuchern, über die Bedingungen ihrer Entfremdung bis zu einem gewissen Grad selbst zu entscheiden.

Inoffizielle oder Off-Festivals gab es selbstverständlich schon vor den Hofbauerkongressen. Sie sind Teil einer langen Offkino-Tradition, die im Schatten des offiziellen Kino- und Festivalbetriebs bereits seit vielen Jahrzehnten unschätzbare Arbeit leisten. Ohne die Filmclubs der 1950er Jahre und die zahllosen Folgeinitiativen, also ohne Orte, an denen Kino und Filmgeschichte unabhängig von tagesaktuellen Interesselagen und Verwertungszusammenhängen präsentiert werden, gäbe es heute nicht einmal eine Diskussion um das sogenannte (ein weiteres Unwort:) „Filmerbe“.
Die Off-Festivals, die ich seit einigen Jahren besuche, stehen in dieser Tradition, sind aber gleichzeitig etwas Neues. Interessant ist, dass sie hauptsächlich von jungen bis sehr jungen Leuten besucht und auch organisiert werden. Und das, obwohl andere Formen der alternativen Kinokultur, wie vor allem die kommunalen Kinos und die Kinematheken, große Probleme damit haben, ihre Zuschauerschaft kontinuierlich zu erneuern. Vielerorts hat man immer noch den Eindruck, dass die Offkinokultur mit ihrem Publikum altert – und irgendwann mit ihm sterben wird.
Ob die Initiativen der letzten Jahre in der Lage sind, diesen Trend dauerhaft aufzuhalten oder gar umzudrehen, wird sich noch zeigen. Institutionell sind sie zumeist kaum bis schwach verankert, alles steht und fällt mit dem Enthusiasmus von Einzelpersonen. Doch zumindest vorläufig reicht das aus, um nicht nur für mich die deutsche Festivallandschaft auf den Kopf zu stellen. Die Berlinale oder das Filmfestival München reizen mich kaum noch. Meine deutsche Festivallandkarte sieht derzeit stattdessen so aus: In Nürnberg gibt es den Hofbauerkongress und, als dessen illegitimes Kind, den STUC; in Frankfurt das dem italienischen Genrekino gewidmete Terza Visione sowie die unregelmäßig stattfindenden Veranstaltungen des in der Stadt ansässigen Filmkollektivs; in Köln schließlich das bereits etwas ältere „Besonders Wertlos – Das Festival des Deutschen Psychotronischen Films“.
Es ist natürlich faktisch nicht möglich, die beiden Arten von Festivals scharf voneinander abzugrenzen. Auf einigen offiziellen Festivals, wie dem Cinema Ritrovato in Bologna oder den Dokumentarfilmtagen Duisburg herrscht ebenfalls eine Atmosphäre der entspannten Wohlfühlcinephilie, irgendwo zwischen Schullandheim (Duisburg) und Sommerurlaub (Bologna). Und andersherum beginnen sich einige der Off-Festivals, vor allem das inzwischen im Deutschen Filminstitut beheimatete Terza Visione, langsam zu professionalisieren.
3. Hey You, The Rock Steady Crew
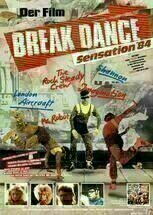
Allerdings unterscheiden sich die beiden Arten von Festivals nicht nur in ihrem Professionalisierungsgrad. Sondern auch hinsichtlich der Filme, die auf ihnen zu sehen sind. Die meisten der Off-Festivals, die ich besuche, und auch die meisten, die ich nicht besuche (die Szene wächst schnell, inzwischen könnte man fast jedes zweite Wochenende in eine andere Stadt reisen), zeigen ausschließlich Unterhaltungsfilme. Besonders gern solche, die in den 1950er bis 1980er Jahren in Europa produziert wurden.
Das ist kein Zufall. Das Kunstkino in all seinen Facetten, von bürgerlichem Arthaus bis zur Avantgarde, muss seine eigene Daseinsberechtigung immer schon mitproduzieren, in Form von Diskursen, die auf die eine oder andere Art auch dann noch anschlussfähig bleiben, wenn die Filme längst vergessen sind. Das kommerzielle Kino schöpft seine Relevanz hingegen ausschließlich aus dem Markt – oder vielmehr aus dem popkulturellen Kontext (Starsystem, Genrekonventionen, Modetänze und so weiter), der die Filme erst als Produkte am Markt platziert. Sobald dieser Kontext wegfällt, liegen die Filme, wenn sie noch einmal zur Aufführung kommen, einzeln und schutzlos, fast nackt vor uns. Sie haben etwas Rührendes an sich; sie noch einmal zu zeigen (und zwar im Rahmen einer richtigen Kinovorstellung, auf der großen Leinwand und wenn irgend möglich als 35mm-Filmkopie) heißt, ihnen einen neuen Kontext, ein neues Leben zu schenken. Jede Projektion ein Akt der Zärtlichkeit.
Auch der Abstand zu Amerika spielt dabei eine Rolle: Der Hollywoodglamour, nach dem sich viele der Filme offensichtlich sehnen, ist für sie fast stets unerreichbar. Aber gerade diese Sehnsucht, das dezent Hochstaplerische dieses Kinos, die Mischung aus Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex, verleiht den Filmen eine eigenartige, betörende Artifizialität. Ein ideales Studienobjekt ist in dieser Hinsicht das italienische Genrekino, das spätestens seit der Italowesternwelle der 1960er Jahre als eine Art phantasmagorischer Pappkulissenwiedergänger des Hollywood-Genrekinos beschrieben werden kann.
Natürlich ist es damit, das sei gleich hinzugefügt, nicht hinreichend beschrieben; es speist sich auch aus zahlreichen anderen Traditionen, aus indigen-italienischen, paneuropäischen, sogar aus japanischen und anderen. Dennoch ist die Amerika-Fixierung unübersehbar, sie durchdringt alle Ebenen der Filme, von „amerikanisierten“ Regisseursnamen über importierte, in Hollywood ausrangierte US-Stars bis hin zu den New-York-Szenen oder auch nur -Postkartenansichten, die in diverse, ansonsten komplett in Europa produzierte Filme eingefügt wurden, als Beweis dafür, dass zumindest ein kleines bisschen Amerika auch in diesem billig heuntergekurbelten Stück Italo-Exploitationkino steckt.
Auch einer meiner Favoriten der diesjährigen Ausgabe des Terza Visione ist von Amerika regelrecht besessen: Dance Music (1984), in Deutschland verliehen als Breakdance Sensation ’84 (wohl recht erfolgreich; gut 20 35mm-Positivkopien lagern allein im Archiv des Deutschen Filminstituts, damit dürfte der Film zu den bestkonservierten seiner Zeit gehören). Wie der Titel der Synchronfassung nahelegt, entstand die von Vittorio De Sisti inszenierte Musikkomödie im Zuge des Breakdancebooms der frühen 1980er.
Gleich mehrmals wird einer der größten Hits der damaligen Zeit eingespielt: „Hey you, the Rock Steady Crew / Show what you do, make a break, make a move / Hey you, the Rock Steady Crew / B-boys, breakers, electric boogaloo“. Wie für das Lied mit seinen wuchtigen Beats und den endlos sich wiederholenden Nonsenselyrics sind auch für den zugehörigen Film Sinnzusammenhänge weniger wichtig als energetische Zustände. Konkret geht es um eine Gruppe junger Tänzer, die vom großen Durchbruch träumen. Aktiviert werden sie von Filmausnahmen aus New York: Das Breakdancegenie Mr. Robot, der Mann mit den Gummiknochen, führt vor stilisierter New-York-Kulisse sein Können vor. Schon auf dem Rückweg aus dem Kino beginnen die italienischen Jungs und Mädels das Gesehene zu imitieren, und sie lassen nicht locker, bis es ihnen gelingt, ein Ticket in Richtung Amerika zu lösen.
Wenn die jungen, bunt frisierten, bezaubernd versponnenen italienischen Tanzverrückten dann tatsächlich New York erreichen, gerät der vorher zwischen exaltierten Tanzszenen und fröhlichem Comedyunsinn hin und her pendelnde Film völlig aus dem Häuschen. Gemeinsam mit den europäischen Neuankömmlingen stromert die Kamera durch die Straßen der Metropole, kann sich nicht sattsehen an den damals noch ganz und gar nicht gentrifizierten Fassaden Manhattans. Die Handlung kommt fast komplett zum Stillstand, verliert sich in Alltagsimpressionen und zunehmend derangierten Tanzproben. Auch Mr. Robot taucht wieder auf: In einer langen Montagesequenz tanzt er sich, wie ein Touristenführer, durch die gesamte Stadt.

Letztlich bleibt völlig unklar, wie sich Mr. Robot und der Film, in dem er auftaucht, zueinander verhalten. Wurde der Tänzer von den Produzenten unter falschen Versprechungen in den Film geholt? Weiß er überhaupt, dass seine Tänze in den 1980er Jahren in Italien und in zahlreichen weiteren europäischen Ländern auf der Leinwand bewundert wurden? Einige der Mr.-Robot-Aufnahmen sind offensichtlich dokumentarisch, und nur in einer einzigen Szene ist er gemeinsam mit einem der italienischen Castmitglieder im Bild: Da tanzt er am Times Square, eine der jungen Italienerinnen blickt ihr Vorbild erst bewundernd an und nimmt sich dann ein paar Geldscheine aus dem Hut, den Mr. Robot vor sich aufgestellt hat, damit Passanten ihm ein paar Dollar zustecken können. „Für die U-Bahn“, erklärt sie, während sich der Breakdanceprofi verblüfft abwendet. Ist das vielleicht sogar ein Hinweis auf das eigenwillige Finanzierungsmodell des Films Breakdance Sensation ’84?
So oder so besteht die spezifische Leistung des Terza Visione darin, diesen gleichermaßen berauschenden und beknackten Film wieder sichtbar zu machen – und zwar nicht nur als ein bizarres kulturhistorisches Dokument, sondern als ein Stück lebendige Filmgeschichte, als ein ästhetisches Objekt, das, wie die euphorische Stimmung im Kinosaal – spätabends am 27. Juli im Filmmuseum Frankfurt – zeigt, auch Jahrzehnte nach seiner Uraufführung noch seine Wirkung entfalten kann. Außenstehende sind, das lässt sich zum Beispiel auf Facebook wieder und wieder nachvollziehen, gerade davon irritiert: Auf Off-Festivals werden Filme wie Breakdance Sensation ’84 vorbehaltlos gefeiert, als wären das weithin anerkannte Meisterwerke der Filmgeschichte. Während umgekehrt sogenannte Kanonregisseure von den Festivalmachern ignoriert oder gar, in der einen oder anderen Äußerung im diskursiven Umfeld der Off-Festivals, dezent lächerlich gemacht werden.
Um plumpen Contrarianism, um eine rein destruktive Lust an der Provokation geht es dabei aber keineswegs. Ganz im Gegenteil kann man die Off-Festivals als eine Selbsterneuerungskraft der Filmkultur betrachten. Denn ein Filmkanon, der nicht konstant infrage gestellt und gelegentlich komplett über den Haufen geworfen wird, hat schlichtweg keinen Wert, verwandelt sich in einen bloßen Katechismus, der auf die Dauer jede intellektuelle Auseinandersetzung mit Film lähmt.
Aber vielleicht ist das, das legt insbesondere der STUC nahe, gar nicht das Entscheidende. Vielleicht geht es den Off-Festivals primär gar nicht darum, die richtigen Geheimtipps gegen den falschen Kanon stark zu machen. Das ist schließlich letztlich ebenfalls ein Relevanzdiskurs. Vielmehr haben die Off-Festivals es zumindest mir ermöglicht, nicht einzelne Filme, sondern das Kino selbst wiederzuentdecken – als eine Unsicherheitsmaschine, die, wenn man sich nur auf sie einlässt (und zwar so vorbehaltlos wie nur möglich), immer schon klüger, großzügiger, neugieriger und komplexer ist als die Diskurse, die sich um sie herum anlagern.
Der Text ist im Rahmen des Siegfried Kracauer Stipendiums entstanden und zuerst im Filmdienst erschienen.












Kommentare zu „Jede Projektion ein Akt der Zärtlichkeit“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.