Über kurz oder lang – Berlinale Shorts
Ein Ausflug ins Archiv mit Radu Jude, eine Spurensuche in Kambodscha, ein Kampf gegen das Schweigen und eine sinnliche Überforderung, die an die Anfänge des Kinos erinnert: Leonard Krähmer präsentiert vier Favoriten aus der Berlinale-Kurzfilmsektion.

Kurzfilme fristen in den ohnehin aus allen Nähten platzenden Programmen der „wichtigen“ Filmfestivals ein Nischendasein. Große mediale Aufmerksamkeit wird ihnen selten zuteil. Aus pragmatischen Gründen sind Kurzfilme meistens zu Programmblöcken gebündelt, die vor allem die Maßgabe erfüllen müssen, insgesamt ungefähr anderthalb Stunden zu dauern. In diesen Zeitschienen – ein Begriff, der die Sache vielleicht besser trifft, als von einem kuratierten Programm zu sprechen – tummeln sich in der Regel vier bis fünf Kurzfilme, die erst mal nichts eint, außer die Tatsache, dass sie hintereinander weg gezeigt werden.
In Programm 4 der Berlinale Shorts führt das etwa dazu, dass ein astreiner Flickerfilm, ein senegalesisches Begräbnisdrama, eine Fotoarchiv-Montage, eine Meditation über Schnecken, Katzen und Schlaflosigkeit und eine queere Genre-Skizze scheinbar herrschaftsfrei nebeneinanderstehen. Im Grunde bündelt sich hier die disparate, ehrlich gesagt schon auch an Wahnsinn grenzende „Seherfahrung“, die ambitionierte Berlinale-Gänger*innen machen, wenn sie jeden Tag fünf Filme sehen – nur eben nicht über den Verlauf eines Tages, sondern binnen anderthalb Stunden.
In fünf Programmen zeigt die Sektion Berlinale Shorts insgesamt 21 Kurzfilme; drei von ihnen sind sektionsübergreifend mit jeweils einem Kurzfilm aus Forum Expanded und Generation Kplus zum Programm „Desires – Five Queer Short Films of the 76th Berlinale“ kompiliert. Dem Team der Shorts ist die Zeitschienenproblematik bei Festivals natürlich nicht entgangen, daher nahm man sich bei dem speziellen Screening „Shorts Take Their Time“ am 18.2. in der Betonhalle besonders viel Zeit für detaillierte Q&As nach jedem einzelnen Film. Das ist eine löbliche Maßnahme, löst aber freilich nicht das zugrunde liegende Problem, nämlich dass der einzelne Film, ob kurz oder lang, über kurz oder lang in der Festivalmasse unterzugehen droht.
Am Ende schaut man sowieso nur, was man schaut, und schreibt nur über das, was man mag oder zumindest „interessant“ findet. Was folgt, ist ein ebensolcher subjektiver Streifzug durch die Shorts.
Plan contraplan (Radu Jude, Adrian Cioflâncă)

Dank seiner beachtlichen Produktivität ist Radu Jude jedes Jahr mindestens mit einem Film auf einem großen Festival vertreten. Während seine letzten Spielfilme eine zwanghafte Tendenz zu eintönig-aneckender Vulgarität mit oder ohne Einsatz Künstlicher Intelligenz erkennen ließen, war in Judes Werk trotzdem schon immer Platz für filmische Erkundungen im Archiv, die sich aus historiografisch-kritischer Sicht mit den gewaltvollen Abgründen der rumänischen Geschichte beschäftigten. Nach The Exit of Trains (2020) und Memories from the Eastern Front (2022) hat Jude für Plan contraplan erneut mit dem Historiker Adrian Cioflâncă zusammengearbeitet. Gemeinsam haben sie die Reportagen des US-amerikanischen Fotografen Edward Serotta, der sich in den 1980er-Jahren kurz vor Ende des Ceaușescu-Regimes mehrfach in Rumänien aufgehalten hat, zu einem strukturellen Film verarbeitet.
Die erste Hälfte von Plan contraplan ist eine kommentierte Fotoserie mit Serottas Aufnahmen von leeren Regalen, frierenden Menschen und jüdischen Friedhöfen. Jahrzehnte nachdem die Bilder entstanden sind, spricht ihr Urheber nun ein Voiceover, das die kontrastreichen und zuweilen arg ästhetisierend wirkenden Schwarzweiß-Dokumente kontextualisiert. Während seiner Reise habe der Fotograf sich zunehmend für die Lebensrealität der jüdischen Community Rumäniens interessiert – darüber fotografisch Zeugnis abgelegt zu haben, erfüllt ihn hörbar mit Stolz. Gleichzeitig schildert Serotta die offensichtliche Überwachung, der er durch die rumänische Sicherheitspolizei Securitate ausgesetzt war, mit der er schon vor Beginn der Reise eine Abmachung treffen musste, um die Reportage überhaupt durchführen zu dürfen. Serotta nimmt es pragmatisch: „Es gibt keine schlechten Reiseerfahrungen – nur gute Reisegeschichten.“
Was Plan contraplan (englischer Titel: Shot Reverse Shot) zu einem guten Film über eine gute Reisegeschichte macht, ist die Gegenüberstellung von Serottas dokumentarischen Arbeiten mit einem anderen Bildkorpus. Der Fotograf geriet nämlich seinerseits vor die Linse der Securitate, die ihm auf Schritt und Tritt folgte und seine Aktivitäten minutiös protokollierte. Der zweite Teil von Judes/Cioflâncăs Film liefert diese Bilder aus der Securitate-Akte als Kontrapunkt zum ersten Teil nach: Schuss-Gegenschuss. Um zu verhindern, dass Serotta Kontakt zu „rebellischen oder parasitären Elementen“ aufnahm, wurde außerdem peinlichst genau mitgeschrieben, wen er traf, wen oder was er fotografierte, was er sagte, wie er seinen Dacia zu Schrott fuhr. Im Film werden diese schriftlichen Aufzeichnungen von einer lakonischen Frauenstimme verlesen.
Der Filmtitel Plan contraplan rekurriert augenzwinkernd auf die filmtheoretische Stilfigur des Schuss-Gegenschuss, also das Hin- und Herschneiden zwischen zwei mehr oder weniger komplementären Kameraperspektiven (etwa bei einem Dialog zwischen zwei Figuren), um durch den Nachvollzug der sich ergänzenden Blickwinkel die Illusion eines geschlossenen – ideologiekritisch formuliert: totalen – Filmraums herzustellen. In einem Text benennt Harun Farocki Schuss-Gegenschuss als elementares Prinzip der Filmsprache: „So lässt sich eine Unterhaltung aufbauen aus dem, was die Augen sagen, während der Mund spricht.“ Jude weiß, dass Schuss-Gegenschuss eigentlich dem Spielfilm vorbehalten ist; in Plan contraplan ist somit eher die Gegenbewegung von These (Serotta) und Gegenthese (Securitate), von Gesagtem und Gesehenem entscheidend, die den aufklärerischen Impetus von Dokumentarfotografie verkompliziert.
Incident on the Mountain (Savunthara Seng)

Dass die Fotografie die Wahrheit nicht gepachtet hat, weiß auch Savunthara Seng. Die Bilder, die es vom Helikopterabsturz in den kambodschanischen Bergen, jenem titelgebenden Incident on the Mountain, gibt, sind im Film nur kurz zu sehen – besonders viel zeigen sie nicht. Jahre später sind ein Journalist und ein volltätowierter Militär zur Unfallstelle hinaufgewandert, um sich auf Spurensuche zu begeben, wo kaum noch Spuren sind. Dafür viel grüne Natur und wahrheitsverschleierndes Dickicht. Es kreucht und fleucht an allen Ecken und Enden, auch die Vögel sind alle schon da, außerdem ein Schamane. Das Personal besteht aus Mann in Blau, Mann in Grün, Mann in Weiß, wie die Credits erklären.
Zu dritt sitzt man bei Tee beisammen und redet über Regenrituale. Die Fotos widersprechen den Theorien verschwörerischer Art: War der Helikopter nur eine Attrappe – und welche Rolle spielt Russland? Später wackelt die Kamera mit den Figuren durchs Gestrüpp, rückt der Flora so sehr auf den Leib, dass nur noch grüne Formen bleiben, die in der Abstraktion zu verschwimmen drohen. Dasselbe Schicksal ereilt unsere Wahrnehmung, vielleicht ist die Gegenwart doch nicht so stabil, wie sie manchmal scheint. Der Schamane öffnet den Film jedenfalls in Richtung einer magischen Welt, denn die Geister einer archaischen Vergangenheit sind diesen Wäldern ohnehin nie ausgetrieben worden. Die Narbe, die der Mann in Blau seit seiner Geburt über der Hüfte trägt, erinnert an das Aderwerk eines Blattes und ist ein Portal werweißwohin.
Miriam (Karla Condado)

„It’s hard to write this letter, not because it’s hard but because it hurts.“ Dieser Schmerz vermittelt sich in Karla Condados filmischem Brief an ihre verstorbene Tante Miriam ab der ersten Sekunde. Dass Miriam nicht nur tot ist, sondern auf grausame Weise von ihrem Partner (Miriams „Liebstem“, dem „Monster“) ermordet wurde, erfährt man erst zur Mitte des Films, man ahnt es aber schon vorher. Das hat mit morbidem Spannungsaufbau nichts zu tun, sondern entspringt vielmehr dem durch und durch politischen Anliegen, für das Condados herzzerreißender Film im Modus persönlicher Trauerarbeit eintritt: das Schweigen zu brechen. Über Miriams Tod wurde in Condados Familie nämlich kaum gesprochen, es gab keine Sprache für die sprachlos machende Trauer, noch weniger für die dahinter liegende Gewalt gegen Frauen, die in Mexiko (und nicht nur dort) ein totgeschwiegenes Problem ist.
Condado nähert sich der Verbalisierung des Traumas auf doppelte Weise, in Schrift und Wort: Per Voiceover ordnet sie brüchige Erinnerungen an ihre Tante; emotional gefärbt ist die Stimme, die manchmal wegbricht, ob der Angst und der Ohnmacht. Dazu wird Schrift eingeblendet, handgeschriebene Sätze, fragmentiert und auf Englisch, manchmal entsprechen sie dem Gesagten, verdoppeln es, manchmal nicht. Wenn die Worte versagen, übernimmt das Handgeschriebene, das direkt an Miriam adressiert ist. Die Schrift legt sich nicht über die Bilder, sie ist in sie eingraviert, wie auch Condados Erinnerungen an Miriam, so sehr sie auch verblassen, von einer brutalen Zäsur durchbohrt sind, die sich in der Gegenwart nicht auflösen lässt. In schwarz-weiß gehalten und mit Analogfilmemphase ausgestattet, versammelt Condado assoziative Aufnahmen. Mal ist sie selbst zu sehen, mal ihr Freund, mal übernehmen Formen und Texturen, in denen sich sowohl der gesprochene als auch der geschriebene Text entfalten kann. Für das Nachwirken des Femizids in den Alltag der Filmemacherin findet Miriam eine zarte Form, die „in sich stimmig“ ist, insofern die Gestaltungselemente perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Flim Flam (Siegfried A. Fruhauf)
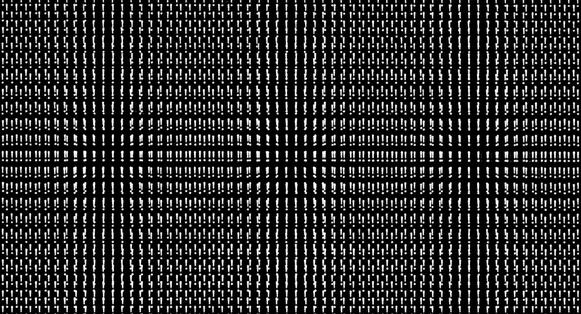
Während die emotionale Sogwirkung von Miriam durch das Zusammenwirken verschiedener Ebenen entsteht, setzt Siegfried A. Fruhaufs Flim Flam auf sensorische Überforderung. „Focus on the center for one minute!“, wird man direkt zu Beginn aufgefordert und bekommt anschließend ein schwindelerregendes Tableau aus konzentrisch kreisenden Miniaturmonden präsentiert, die sich ineinanderschieben und schließlich zur Ruhe kommen (im Kopf dreht sich’s gleichwohl weiter). Flim Flam ist ein lupenreiner Experimentalfilm, da er derartige Illusionsspielchen immer wieder aneinanderreiht, um die Sinne des Publikums auf die Probe zu stellen. Visuell flackert und verschiebt sich ständig irgendwas; der unbedingten Adressierung bzw. Strapazierung des sehenden Auges wird in einer enervierenden Sequenz durch ein waberndes Muster aus einer Ansammlung umgedrehter Ausrufezeichen Aus- und Nachdruck verliehen. Die Tonspur folgt meist einer eigenen Agenda: Was man hört (Quietschen, Quaken, Plätschern u.a.) entspringt nicht dem Gesehenen, aber zwischen beiden Ebenen lassen sich Korrespondenzen rhythmischer oder struktureller Art finden.
Um ein Kino der Attraktionen geht es Fruhauf nicht zwingend, wohl aber um eine phänomenologisch aufgesattelte Durchleuchtung der filmischen Form. Ein galoppierendes Zebra, das mehrmals im Film in unterschiedlichen Aggregatszuständen und Bildraten auftritt, verweist auf die präfilmischen Anfänge des Bewegtbildes, die Experimente von Eadweard Muybridge und Konsorten. Das Zebra flimmert nicht nur galoppierend durch den dichten Überblendungsnebel, sondern steht auch manchmal Kopf. Bildkader werden umgekehrt und gespiegelt, überhaupt ist die Inversion eines Ausgangszustandes eines der auf Instabilität abzielenden Standardverfahren Fruhaufs. Bei all den abstrakten Form- und Farbspielen bildet das Zebra eine Art Konkretionskonstante, vor allem dann, wenn Kinderhände eine geschnitzte Spielzeugfigur des gestreiften Huftiers – wie im freudianischen Fort-Da-Spiel – abwechselnd umschließen und wieder dem Blick der Kamera freigeben.














Kommentare zu „Über kurz oder lang – Berlinale Shorts“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.