Sichtbarkeit statt Schubladen: Internationales Frauenfilmfestival Dortmund|Köln 2016
Der letzte Film Chantal Akermans, Malick’sche Bilder auf sozialrealistischem Terrain und eine Entdeckung aus dem Goldenen Zeitalter des mexikanischen Kinos: Auf dem diesjährigen Internationalen Frauenfilmfestival Dortmund|Köln ließen sich Blicke nicht nur auf gegenwärtiges weibliches Filmschaffen werfen.
„Ich bin keine feministische Filmemacherin. Ich bin eine Frau. Und ich mache Filme.“ So oder so ähnlich hat Chantal Akerman das mal gesagt, und diese Klarstellung zeugt natürlich nicht von einer unpolitischen Haltung oder gar einer Ablehnung feministischer Positionen als vielmehr vom Wissen um die Gefahr schubladisierender Begriffe – die ein bestimmtes Publikum gerade anziehen mag, einem anderen das Abwinken und Weitergehen aber gehörig erleichtert. Dem Internationalen Frauenfilmfestival Dortmund|Köln wäre eine solche Label-Resistenz ebenfalls zu wünschen, ist sein Anliegen doch ein ähnliches: Die Kuratorinnen zeigen zwar Filme und veranstalten Diskussionen, die sich mit feministischen Kämpfen und queeren Lebensweisen ebenso auseinandersetzen wie mit der strukturellen Diskriminierung von Frauen im Filmbereich. Im Grunde geht es aber nicht um „Frauenfilme“ und eine genügsame special-interest-Politik, sondern – im Kontext einer noch immer männerdominierten Industrie – um eine größere Sichtbarkeit für Filme, die von Frauen gemacht wurden, und für Frauen, die Filme machen. Um die hundert Werke waren dabei in sechs Tagen zu sehen.
Ich filme, dass ich nichts filmen kann

Akerman selbst war auch zugegen, so zugegen, wie sie seit ihrem tragischen Tod im letzten Jahr noch sein kann: durch ihre Filme. No Home Movie, in Zusammenarbeit des Festivals mit der Kölner Kunsthochschule für Medien gezeigt, ist ihr letztes Werk; knapp zwei Monate nach seiner Premiere auf dem Festival von Locarno nahm sie sich das Leben. Der Tod begleitet auch diesen Film, eine auf unheimliche Weise von liebender Intimität wie schmerzlicher Distanz durchdrungene Beobachtung einer Mutter in ihren letzten Lebensjahren. Natalia Akerman war im Werk ihrer Tochter eine ständige, geisterhafte Präsenz, vor allem im ähnlich persönlich angelegten News from Home (1976), in dem der mutter-töchterliche Briefwechsel nicht nur von der absurden Kluft zwischen Heimat und Wahlheimat sprach, sondern auch vom Schicksal Natalias als Auschwitz-Überlebende.

Und hier sitzt diese Frau nun, alt und gebrechlich, und begeht ihren Alltag, während die Tochter aus der Ferne über Skype ihren nächsten Besuch in einigen Wochen ankündigt. „Warum filmst du mich?“, fragt die Mutter da aus dem Bildschirm, und die Tochter, ihre Kamera auf den Laptop-Monitor gerichtet, antwortet: „Um zu zeigen, dass es keine Distanz mehr gibt.“ Und da lacht die Mutter auf dem Bildschirm ganz ernsthaft: „Toll, was du immer für Ideen hast!“ Ein Moment, der so witzig ist, so rührend, so nachdenklich, dass er kurz glücklich macht. Auf andere Weise nimmt einen dagegen das expliziteste Gespräch des Films mit, das die Regisseurin mit der Haushaltshilfe ihrer Mutter führt – einer Latina, die sich ehrlich interessiert am Lebensweg der alten Frau zeigt, nach unschuldigen Fragen über Anzahl und Schicksal von Geschwistern Begriffe wie „Konzentrationslager“ oder „SS“ aber nicht so richtig in den Smalltalk eingebaut bekommt. Chantal Akerman bekommt diese Dinge auch nicht in einen Film eingebaut. Auch davon handelt No Home Movie.
Der Schmerz einer kleinen Schwester
Die Kamerafrau Sophie Maintigneux – diesjährige Protagonistin des Werkstattgesprächs Bildgestaltung im Rahmen des Festivals –, verwies in ihrer einleitenden Würdigung Akermans auf Deleuze’ Begriff des Territoriums, um dem Verhältnis von Akermans Protagonistinnen zu den ihnen zugewiesenen Räumen auf die Spur zu kommen; Räume, die ihre Bewohnerinnen einsperren und ihnen zugleich ein bescheidenes Reich der Freiheit sind. Man denkt daran, wenn – schon ganz am Ende des Wettbewerbsbeitrags Songs My Brothers Taught Me – Johnny sein Territorium verlässt, weil diese Bewegung eben auch zugleich nötige Flucht wie schmerzlicher Abschied ist: „It’s a hard place to leave, because it’s all you’ve got.“ „Territorium“, ein tragisch passender Begriff für diesen Film, spielt er doch vollständig auf einem Native-American-Reservat in South Dakota, einem zugewiesenen Stück Land nach der großen Landnahme.

Chloé Zhao, Regisseurin dieses Films, der im letzten Jahr bereits im Rahmen der Quinzaine des Réalisateurs in Cannes lief, hat mehrere Jahre in diesem Reservat verbracht, das eigentlich schon ausgefertigte Drehbuch wieder verwerfen müssen, die Geschichte mit ihren Laiendarstellern aufs Neue erarbeitet. Das Setting nutzt sie als soziales Milieu ebenso wie als erhabene Landschaft, die sie in Malick’schen Impressionsbildern aufsaugt. Im Zentrum stehen Johnny, der seiner Freundin nach L.A. hinterherziehen will, und seine kleine Schwester Jashaun, die vom Plan ihres Bruders erfährt und darüber herzzerreißend traurig wird. In einer wie magisch reduzierten Sequenz stehen sich großer Bruder und kleine Schwester mitten in der Bergwüste der Great Plains gegenüber, in großem Abstand zueinander, und Jashaun sagt: „Du lässt mich allein“, und weint.
Die Fragwürdigkeit authentischer Einblicke

Diese Einfachheit des Films ist manchmal toll, wie hier überhaupt der fiktionale Weltenbau im sozialrealistischen Milieu in einer rauen Poesie aufgeht, der man sich nur schwer entziehen kann. Allerdings bürdet sich Zhao mit dem dokumentarischen Buhlen um eine größere Intensität der Fiktion die üblichen ethischen Fragen auf. Das Leben im Reservat erscheint jedenfalls wahrlich unschön: Alkoholschmuggel, Drogen, Polizeiärger, kleine Kinder an düsteren Orten. Weniger eine moralisch zu ächtende Ästhetisierung des Elends ist hier das Problem als die konkreten Effekte eines Films, in dem allzu bekannte erzählerische Motive – die überforderte Mutter, die harte Gang von nebenan, die apathische Jugend – nicht mehr als fiktionale Setzungen erscheinen, sondern als authentische Elemente eines „schonungslosen Porträts“. So überträgt sich der Fluchtwunsch von Songs My Brothers Taught Me nicht nur durch den Pull-Faktor eines poetisch artikulierten Begehrens auf den Zuschauer, sondern auch durch den Push-Faktor des dokumentarischen Einblicks in eine so fremde wie augenscheinlich kaputte Welt. Das ist es vielleicht, was diesen Film so faszinierend wie problematisch macht.
Aufbruch der Autorinnen

Zhaos Film ist einer von acht Spielfilmdebüts, die um den Hauptpreis der Jury konkurriert haben, und ein bei Weitem aufregenderes Werk als Ana Cristina Barragáns ziemlich braver Alba, der von der Jury mit dem Hauptpreis bedacht wurde. Im Nebenprogramm Panorama waren in Köln und Dortmund darüber hinaus Filme zu sehen, die bereits auf anderen Festivals liefen, darunter etwa Athena Rachel Tsangaris herrliche Männlichkeitsstudie Chevalier, Ruth Beckermanns auf der Berlinale gefeierter Die Geträumten oder der Eröffnungsfilm des letztjährigen Cannes-Wettbewerbs La tête haute. Besonders schön war die Möglichkeit, den Blick von der Gegenwart in die Vergangenheit schweifen zu lassen, in weibliches Filmschaffen anderer Epochen. Schon im Vorfeld des Festivals wurden im Rahmen einer Zusammenarbeit mit den Kuratorinnen von „Aufbruch der Autorinnen“ Agnès Vardas Lions Love (... and Lies) (1969) und Věra Chytilovás großartiger früher Film Von etwas anderem (O něčem jiném, 1963) gezeigt, in dem die tschechische Regisseurin allein über eine so virtuose wie verspielte Montage das Leben einer Hausfrau und das einer professionellen Turnerin ineinander verschachtelt.

Während des Festivals selbst war in diesem Rahmen noch Lina Wertmüllers schöner Spaghetti-Western The Belle Starr Story (1967) zu sehen, in dem die Heldin nicht bloß als „starke Frau“ markiert, sondern über komplexe Rückblenden als proto-feministische Nein-Sagerin gefeiert wird. Die tollste Entdeckung gab es aber im Zuge des Mexiko-Schwerpunkts der diesjährigen Festivalausgabe zu machen: Adela Sequeyros La mujer de nadie (1937) aus der frühen Phase des Goldenen Zeitalters des mexikanischen Kinos. Die von Zeitgenossen nur Perlita genannte Filmemacherin schrieb hierbei nicht nur das Drehbuch, führte Regie und produzierte den Film, sondern übernahm auch die Hauptrolle der jungen Ana María, die irgendwann im 19. Jahrhundert einem Elternhaus entflieht, in dem außer väterlichen Peitschenhieben nichts mehr zu holen ist. Drei Junggesellen finden die Geschundene am Wegesrand und nehmen sie in ihre gemeinsame Wohnung auf – allerdings nur, bis sie wieder zu Kräften kommt, denn der strikte Schwur der drei Bohemiens lautet: keine Frauen.
Die unmögliche Viersamkeit
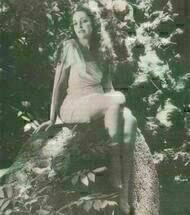
Dass aber Frauen nichts Gutes bedeuten können für Männerfreundschaften, das behauptet La mujer de nadie nicht bloß als ewige Wahrheit der Geschlechterverhältnisse oder nimmt es als Funktionsprinzip des Kinos hin, er bedauert diese Wahrheit und dieses Prinzip zutiefst. Einen Spaß macht sich Sequeyro zunächst daraus, die drei Männer in ihren jeweiligen Metiers – der Dichtkunst, der Musik und der Malerei – ihre Frauenskepsis verlieren und sich verlieben zu lassen in die neue Mitbewohnerin. Da werden Liebesgedichte geschrieben, Oden komponiert und Porträts gemalt, und Ana María ist ehrlich berührt von so viel Schmeichelei. Und mitten in diese Dreiteilung, die dem Film seine schlichte erzählerische Struktur verleiht, schenkt Sequeyro ihren Figuren ein paar Möglichkeitsbilder, die von ihrer nahenden Zerstörung gleichwohl schon zu wissen scheinen: Da singt man zusammen vor dem Feuer, da gleitet die Kamera über vier glückliche und verliebte Gesichter, als wäre dies ein Happy End, und verabschiedet sich dann doch in die melancholische Schwarzblende.
Denn drei Männer und eine Frau, das geht halt nicht, selbst wenn die Frau es gern anders hätte und sich eine solche WG ganz wunderbar vorstellen kann. Als schon längst klar ist, dass es kein Zurück mehr geben wird, als Neid und Eifersucht und Konkurrenz die Herren der schönen Künste längst ereilt haben, sitzt Ana María mit dem Maler unterm nächtlichen Sternenhimmel und beklagt, dass das Glück doch immer nur von so kurzer Dauer ist. „Aber die Nacht, sie ist doch so schön“, sagt der Maler. „Aber nein, die Nacht ist traurig“, sagt Ana María. Keinerlei Zweisamkeit wird sich aus dieser Konstellation herausschälen lassen, und die homosoziale Dreisamkeit ist ebenso dahin, weiß sie doch nun um ihre Abgründe. Die Frau wird weiterziehen, während die Männer ihre Gedichte, ihre Kompositionen, ihre Porträts ins Feuer werfen und die Feigheit ihres Schwurs erkennen.








Kommentare zu „Sichtbarkeit statt Schubladen: Internationales Frauenfilmfestival Dortmund|Köln 2016“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.