Sensationslust und Voyeurismus – Giallo-Reihe in Wien
Italienische Krimis, die ihre Kraft aus der Perversion schöpfen und sich ganz dem visuellen Exzess hingeben: Ein E-Mail-Gespräch auf der Suche nach der Essenz und dem besonderen Reiz des Giallo.
Im Giallo gibt es keinen unschuldigen Blick

Lukas: Eine meiner Lieblingsszenen in den Filmen, die wir die Woche über gesehen haben, ist aus einem wüsten Polizeifilm-Giallo-Crossover von Massimo Dallamano, der im Original La polizia chiede aiuto (wörtlich: Die Polizei bittet um Mithilfe) heißt. Eine Witwe soll ihren ermordeten Mann im Leichenschauhaus identifizieren. Er wurde vom Killer übelst zugerichtet, regelrecht in Stücke geschnitten. Deshalb wird er vom Gerichtsmediziner erst komplett zugedeckt, der Witwe wird dann lediglich sein Kopf gezeigt. Sie ist damit aber nicht einverstanden und meint, aggressiv und gierig: „Nein, ich will alles sehen, was sie ihm angetan haben.“ Dann wird das Laken beiseite geschlagen und es folgt eine Großaufnahme ihres Gesichts, wie sie entsetzt aufschreit.
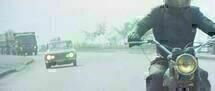
Der eigentliche Clou der Szene ist aber, dass sie ihren Mann eigentlich verabscheut. Die beiden leben schon längst nicht mehr zusammen, er schläft mit seiner Sekretärin und vorher hatte die Ehefrau noch gemeint, sie wolle „den Bastard“ nie wiedersehen. Wenn sie ihn dann kurz darauf, als Toten, trotzdem anschauen möchte und zwar so ausführlich wie möglich, dann vermutlich auch, weil das ihren Hassgefühlen entspricht, vielleicht sogar ihren eigenen Mordfantasien. Wobei man gleichzeitig nicht so recht weiß (vielleicht weiß sie es auch selbst nicht), was sie sich von dem Anblick erwartet. Schadenfreude passt ja nicht so recht zur Situation, weil sie nur noch eine verhackstückte Leiche vor sich hat und gar nicht mehr die Reaktion ihres gedemütigten, oder besiegten, Gegenüber genießen kann. Aber der offene Anblick des Schreckens ist dann sowieso so krass, dass alle ihre Vorüberlegungen hinfällig werden und sie sich dem reinen, absoluten Affekt hingibt. Dieser Reaction Shot ist der eigentliche Höhepunkt der Szene.

Irgendwie steckt in der Szene, glaube ich, viel vom Reiz des Giallo drin. Das ist zuerst der visuelle Exzess: Für eine Identifizierung würde ja tatsächlich der Kopf reichen, aber die Witwe will alles sehen, und wir natürlich auch. Die Motive der Witwe für ihre Schaulust sind zumindest ein wenig shady, und unsere sind es sowieso (schließlich schauen wir uns einen Film an, der auf deutsch Der Tod trägt schwarzes Leder heißt, und auf englisch noch schmieriger What Have They Done to Your Daughters?). Im Giallo gibt es keinen unschuldigen Blick. Aber gleichzeitig hat das Bild selbst eine irgendwie pornografische Qualität, es ist immer schon direkter, stärker als der Blick und weist über unsere Projektionen hinaus.
Ich muss dazu sagen, dass ich auf solche Ideen vermutlich nur komme, weil es gar nicht so einfach ist, aus den Filmen, die wir in Wien gesehen haben, eine Essenz des Giallo zu extrahieren, wie etwa wiederkehrende Erzählmuster und Motive. Das liegt sicher ein wenig an den Zufällen der Programmierung, aber vielleicht gibt es eine solche Essenz im strengen Sinne tatsächlich nicht? Selbst die verbreitetsten Klischees wie die Rasierklinge oder die behandschuhte Hand tauchen ja selbst in sehr vielen sogenannten kanonischen Beiträgen nicht auf.
Niedere Instinkte und der Reiz des Verbotenen

Michael: Ich glaubte eigentlich eine recht konkrete Vorstellung davon zu haben, wie ein Giallo zu sein hat. Gleich zur Eröffnung haben wir zum Beispiel Aldo Lados The Child – Die Stadt wird zum Alptraum gesehen, der genau diesem Prototyp entspricht und dir sogar etwas zu schematisch war. Im weiteren Verlauf der Reihe hat sich allerdings herausgestellt, dass es wohl doch mehr um die Abweichungen von diesem Muster geht. Müsste ich jemandem erklären, was einen Giallo ausmacht, würde ich es erstmal mit dem Wort Krimi versuchen (während in Italien genau das damit gemeint ist, bezeichnet man im Ausland eine besondere, meist stärker stilisierte Spielart). Aber selbst mit dieser Definition bin ich in den ersten Tagen nicht mehr weitergekommen, weil gleich mehrere Filme hintereinander liefen, die weniger Genre als gediegeneres Arthouse-Kino waren.

Da gab es zum Beispiel den morbiden und äußerst sparsam mit seinen Schauwerten umgehenden Verlorene Seele (1977) von Dino Risi, oder Elio Petris Das verfluchte Haus (1968), der mit seinen modernistischen Dissonanzen den Geist des Aufbruchskinos atmet oder, besonders schön, Luigi Comencinis Die Sonntagsfrau (1975), für den das Whodunit voll allem Vorwand für ein mit trockenem Humor angereichertes Turiner Gesellschaftspanorama ist.

Auch Der Tod trägt schwarzes Leder war eigentlich eher ein Poliziottesco, ein Polizeifilm. Ich würde aber auch sagen, dass er sehr gut das Reißerische verkörpert, das einen zentralen Reiz des Giallos ausmacht. Im Film stoßen die Ermittler zum Beispiel auf einen Prostitutionsring, der minderjährige Mädchen an Männer aus der Oberschicht verschachert. In einer längeren Szene hören sich die Polizisten Tonbänder an, auf denen die sexuellen Begegnungen in schmutzigster Ausführlichkeit dokumentiert sind. Obwohl hinter dieser Szene sicher erstmal Sensationslust und Voyeurismus stehen, folgt sie doch in erster Linie einer logischen Konsequenz: Sie erzählt von einem Missstand und zeigt ihn deshalb in einer rohen Form.

Tatsächlich finde ich es oft schlimmer, wenn Filme in solchen Situationen großes Aufhebens um ihre eigene Haltung machen, etwa betont den Blick abwenden und das etwas eitel als besonders pietätsvolle Geste ausstellen. Dazu passt ganz gut, dass wir einmal zufällig Michael Haneke vor dem Filmmuseum gesehen haben und uns gleich die Frage stellten, ob er sich gerade heimlich einen Giallo angeschaut hat. Auch wenn allein die Tatsache, dass so eine Reihe mittlerweile in einer angesehenen Kinemathek läuft, zeigt, dass das Genre nichts Anrüchiges mehr hat, schöpft es seine Faszination doch immer noch daraus, ein guilty pleasure zu sein, das mit unseren Instinkten und dem Reiz des Verbotenen spielt.
Vielleicht kann man den Giallo einfach als einen Krimi bezeichnen, in dem Obsessionen und Perversionen zum wichtigsten Antriebsmotor werden. Selbst ein Film wie Verlorene Seele, der eher bei einem bildungsbürgerlichen Publikum andockt und auch lange im Unklaren lässt, was er überhaupt erzählen will, wird am Ende ja richtig kinky.
Der voyeuristische Blick durchs Schlüsselloch

Lukas: Ich glaube, wir haben Haneke ins Taxi steigen sehen, nachdem wir Die Mühle der versteinerten Frauen (1960) von Giorgio Ferroni gesehen hatten, einen großartigen Gruselfilm, der ein Jahrzehnt vor der Giallo-Welle entstand und noch dem Gothic-Stil verpflichtet ist, aber bereits einige zentrale Motive vorwegnimmt, insbesondere die bereits erwähnten Obsessionen und Perversionen, verbunden mit einem hier besonders ausgeprägten Willen zur Ästhetisierung: Anstatt sie zu verstecken, stellt der Mörder die Leichen seiner Opfer als Attraktion aus und integriert sie in eine bizarre Maschinerie, die auf alle, die sich in ihre Nähe trauen, eine fatale, unwiderstehliche Sogwirkung ausübt. Letztlich ist das ein ultraromantischer Film, denn die Antriebskraft hinter dieser Maschinerie, die die Welt und am Ende sich selbst verschlingt, ist die – wie auch immer fehlgeleitete – Liebe.

Zu Haneke passt da freilich höchstens der Titel: Versteinerte Frauen gibt es in seinen Filmen auch, zermahlen werden aber im Allgemeinen nur wir Zuschauer_innen. Verlorene Seele, der Film, der direkt nach dem Ferroni zu sehen war, könnte, was die Ausgangssituation angeht, hingegen tatsächlich fast von Haneke sein: Ein bürgerliches Ehepaar macht sich gegenseitig das Leben zur Hölle, ein junger Verwandter gerät durch Zufall zwischen die Fronten und auf dem Dachboden lauert ein dunkles Geheimnis. Die Entwicklung, die das Ganze dann später nimmt, ist aber fast schon eine Antithese zu Haneke und der protestantischen Spielart von Ideologiekritik, für die er steht (oder sagen wir mal: zu deren Strohmann ich ihn hier aufbaue; auch in seinen Filmen gibt es bisweilen schließlich interessante Widersprüche und Zwischentöne): Wo bei Haneke die spekulativen, auf Schaulust abzielenden Aspekte der Illusionsmaschine Kino wieder und wieder phobisch abgewehrt und symbolisch zerstört werden müssen, stößt man bei Risi ganz im Gegenteil nur dann zur Wahrheit (oder jedenfalls in deren Nähe) vor, wenn man sich den eigenen Obsessionen und Fantasien stellt, und zwar ohne jede Scheu und ohne distanzierende Gesten. Der voyeuristische Blick durchs Schlüsselloch verzerrt zwar die Welt, aber gerade in der Verzerrung wird etwas Entscheidendes an ihr sichtbar. Das bittere an diesem großartigen Film ist dann allerdings, dass die Wahrheit am Ende niemanden befreit. Diese zynisch-resignative Schlusspointe scheint nicht nur in vielen Gialli, sondern überhaupt im italienischen Kino der 1970er allgegenwärtig zu sein.

Interessanterweise ist von allen Filmen, die wir in Wien gesehen haben, Petris Das verfluchte Haus der einzige, mit dem ich, einigen Oberflächenreizen und einer wunderschönen 35mm-Kopie zum Trotz, nicht allzu viel anfangen konnte. Der Film gibt sich zwar alle Mühe, jede Konvention zu sprengen, die nicht bei drei auf dem Baum ist, aber all das Geflirre und Rumgestyle steht letztlich doch im Dienst eines ziemlich unflexiblen linken Dogmatismus, der noch dazu eine latent frauenfeindliche Schlagseite hat. Ich zumindest hatte immer wieder den Reflex, die von Petri als neurotische Kapitalistenschlampe denunzierte Vanessa-Redgrave-Figur gegen diverse filmische Übergriffigkeiten in Schutz zu nehmen. Für mich ist das eine ziemlich repressive Form von Befreiungskino, die immer eh schon alles vorher weiß und wenig Interesse daran hat, sich auf die Widersprüchlichkeiten der Welt einzulassen. Tatsächlich finde ich da einen Film wie Der Tod trägt schwarzes Leder, der politisch wenn überhaupt eher von rechts kommt (etwa wenn die Polizisten sich mehrmals darüber beschweren, dass sie die Verdächtigen nicht einfach abknallen können), aber letztlich überhaupt nicht eindeutig verortet werden kann, viel interessanter. Der mischt einfach ein paar querbeet zusammengetragene Zeitungsschlagzeilen in sein Pulpgebräu und schaut, was sich damit machen lässt. Das Ergebnis fühlt sich an, wie als würde jemand zunächst ein Messer in den Leib der italienischen Gesellschaft rammen und anschließend genüsslich Salz auf die Wunde streuen.
Demut statt Narzissmus

Michael: Das verfluchte Haus war der einzige Film, der auch mir nicht wirklich gefallen hat. Wenn man den Giallo als Handlungsgerüst versteht, bei dem meistens die Aufklärung einer Mordserie im Mittelpunkt steht, dann ist Petri in erster Linie daran interessiert, dieses Gerüst einzureißen. Es gibt ja die recht verbreitete Vorstellung von einem klassizistischen Kino der Alten, in dem bewährte Traditionen weitergeführt werden, und einem progressiven Kino der Jungen, das zerstört oder zumindest in Frage stellt. Der Giallo wäre nach dieser Definition eher Papas Kino, wenn auch eine geil aufgemotzte Variante davon.

So ganz leuchtet mir diese Aufteilung aber ohnehin nicht ein, weil sie die bloße Erzählverweigerung schon zum revolutionären Akt erhebt. Gerade Das verfluchte Haus will zwar Regeln brechen, tut es aber streckenweise mit einem Narzissmus, der letztlich nur auf den Regisseur als Schöpfer verweist. Während es bei Petri so wirkt, als würde es vor allem um die Umsetzung einer künstlerischen Vision gehen, wirken jene Filme der Reihe, die auf den ersten Blick deutlich konventioneller gestrickt sind, flexibler und dynamischer, weil sie sich zwar bewusst sind, dass die Geschichte und die Figuren wichtiger sind, dabei aber trotzdem noch genug Handlungsspielraum bleibt, um sich auszutoben.

Überhaupt lädt die Reihe dazu ein, die Einteilung von jungem und altem Kino einmal gründlich zu überdenken; auch weil Petri Das verfluchte Haus mit fast 40 drehte, während zum Beispiel Dario Argento bei seinem zweiten, ebenfalls in Wien gezeigten Spielfilm gerade mal 30 war. Und obwohl Die neunschwänzige Katze (1971), abgesehen von den bei Argento üblichen Abschweifungen, eigentlich einen klassischen Krimiplot erzählt, scheint mir der Film doch deutlich besser gealtert zu sein und zum Beispiel auch ein deutlich offeneres und moderneres Verhältnis zu Sexualität zu haben. Vielleicht liegt es nur an dem Suspiria-Remake, aber das mit großem Abstand jüngste Publikum saß dann auch nicht bei Petri, sondern in Argentos Tenebre (1982).

Argento ist das beste Beispiel dafür, dass eine gewisse Demut gegenüber der Erzählung keineswegs mit falscher Bescheidenheit oder Puritanismus gleichzusetzen ist. Es gibt wohl kaum einen Regisseur, der sich derart unverblümt dem visuellen Exzess hingibt. Tenebre ist dementsprechend ein Feuerwerk der Schauwerte in schillerndster 80er-Ästhetik. Die Frauen – unter ihnen die mir bis dahin unbekannte Trans-Schauspielerin Eva Robins – sehen alle unheimlich toll aus: perfekt gestylt, aufreizend gekleidet und selbst beim Sterben noch schön. Jeder Mord wird zu einem schaurigen Ballett über die Vergänglichkeit des Menschen zerdehnt.

Und die berühmte Kamerafahrt um ein Haus ist in Tenebre noch nicht einmal das Spektakulärste. Richtig umgehauen hat mich eine aus dem Nichts kommende Verfolgungsjagd, bei der ein äußerst bedrohlicher, scheinbar mit Superkräften ausgestatteter Dobermann eine junge Frau durch ein Villenviertel scheucht. Als sie sich schließlich in einen benachbarten Keller flüchten kann, realisiert sie plötzlich, dass sie sich im Haus des Killers befindet. Ein wunderbarer Schockmoment und auch eine typische Argento-Szene, in der die schwerelos wirkende Kamera auf Erkundungstour geschickt wird, um uns an ungeahnte Orte zu bringen.
Eine grundsätzliche Geilheit

Lukas: Argento, von dem in Wien insgesamt sieben Filme gezeigt werden, ist tatsächlich noch einmal ein besonderer Fall. Aber nicht nur, weil er das Genre vermutlich am obsessivsten und, über seine gesamte Karriere hinweg, auch am originellsten bearbeitet hat, und deshalb heute der mit Abstand bekannteste Giallo-Auteur ist; sondern eben auch, weil sich in seinem Werk die Spannung zwischen Kunstwillen und kinematografischem Populismus ganz besonders deutlich spiegelt. Mir persönlich gefallen die extrem durchgestylten, fast schon ein wenig gespreizten Gesamtkunstwerkversuche der späten 1970er Jahre wie vor allem Suspiria (1977) und Profondo Rosso (1975) tatsächlich weitaus weniger gut als Tenebre oder auch zum Beispiel Vier Fliegen auf grauem Samt (1971), den ich in Wien zum ersten Mal gesehen habe. Beides Filme, in denen Argento erst einmal recht geradlinige Pulp-Geschichten entwirft, die er dann als Sprungbrett für seine größeren und kleineren Verrücktheiten benutzt.

Was Argentos Filme auch aus der Menge der Gialli abhebt, ist, dass sie ganz offen lustbetont sind. Das Düstere, Klaustrophobische, das in vielen anderen Filmen des Genres mitschwingt, gibt es bei ihm fast überhaupt nicht. Zwar geht es handlungslogisch oft um verdrängte Traumata, aber die Verdrängung ist genauso in your face wie das Verdrängte. Jemand, der den Absatz eines roten Fetischstöckelschuhs in den Mund gedrückt bekommt, muss einfach in seine darauffolgenden Mordtaten genau dieselbe fetischistische Energie investieren. Dazu passt, dass die Filme hochsexualisiert, aber letztlich nicht voyeuristisch sind. Gerade in Tenebre gibt es eine grundsätzliche Geilheit, die alles gleichermassen im Griff hat, die Kamera genauso wie die Figuren. Wenn im Verlauf des berühmten, schon erwähnten tracking shots übers Haus hinweg Mirella Bantis Brust unter dem Handtuch, das sie sich nicht allzu sorgfältig umgebunden hat, hervorquillt, dann fühlt sich das keineswegs invasiv an; eher hat man das Gefühl, dass die libidinöse Energie der Kamera direkt auf die Darstellerin überspringt.

Außerdem hat Argento eine fast kindliche Freude daran, Hohes und Niedriges, Populärkultur und Modernismus zu vermischen. Vier Fliegen auf grauem Samt ist einerseits fast schon eine Neuerfindung des Kinos: Die Insekten des Titels werden zu Wiedergängern der Pferde aus Muybridges Phasenfotografie-Experimenten. Nur dass es bei Argento, anders als bei Muybridge, zwar um Bewegung, nicht aber um Kontinuität geht. Die ziemlich wahnwitzige Szene, in der in einem Polizeilabor die Netzhaut eines isolierten, aus dem Schädel entfernten Auges abfotografiert wird, könnte man zu einer Medientheorie des subjektlos delirierenden Horrorfilmblicks ausbauen. Aber daneben gibt es fröhlichen Unfug wie diesen immer wieder in die Handlung hereinstolpernden Briefträger, der einem Franco-und-Ciccio-Film entsprungen sein könnte.

Schön ist die sehr umfangreiche Auswahl aber auch, weil sie Platz lässt für kleinere, obskurere Filme, die vielleicht nicht in jeder Hinsicht gelungen sind, aber auf ihre Weise zeigen, wie lebendig das italienische Kino der 1960er und 1970er Jahre war. Zum Beispiel Das Auge im Labyrinth (1972) von Mario Caiano, der sich bis zu seinem Twist-Ende, das freilich letztlich mehr Fragen aufwirft als beantwortet, fast mehr wie ein Film von Jess Franco denn wie ein Giallo anfühlt. Lange Zeit ist das ein ziemlich entspannter Film, in dem schöne junge Leute leichtbekleidet am Mittelmeer herumliegen, oft in Formation nebeneinander drapiert, manchmal regelrecht ornamental, wie menschliche Blütenblätter.
Ein Genre der Täuschungen

Michael: Das Auge im Labyrinth passt vielleicht auch gerade deshalb sehr gut in die Reihe, weil er erst in den letzten zehn Minuten seine wahre Natur offenbart. Täuschungen scheinen mir ein zentrales Merkmal des Giallo zu sein: Menschen geben darin vor, jemand anderes zu sein oder manchmal ist auch gleich die ganze Erzählperspektive verzerrt. Der Giallo spielt zwar offensiv mit dem Zuschauer, aber der ist gut genug mit den Konventionen vertraut, um zu wissen, dass er hinters Licht geführt wird. Deshalb besteht auch die Kunst vieler Filme darin, dass das Publikum ständig mit Überraschungen rechnet, am Ende aber doch unvorbereitet von ihnen getroffen wird. Der Giallo sagt: Sei dir da mal nicht so sicher! Er stört unsere Weltordnung, aber eben nicht so didaktisch und überheblich wie es mitunter im sogenannten Autorenkino geschieht, sondern in Komplizenschaft mit dem Zuschauer. Selbst das An-der-Nase-herumgeführt-werden ist hier noch lustbetont.
Gialli kann man vielleicht deshalb auch als Filme in drag bezeichnen – nicht nur weil es oft auch um Crossdressing oder andere Formen der Verkleidung geht. Sie machen uns auf Ansage etwas vor, provozieren damit unsere Wachsamkeit und öffnen unseren Blick für ungeahnte Möglichkeiten. Wenn der kinderliebe Priester ebenso der Mörder sein kann wie die unscheinbare ältere Dame oder auch der Held beziehungsweise die Heldin selbst, dann mag die Erzählweise noch so klassisch sein, man kann sich nie in Sicherheit wiegen. Dementsprechend enden viele Gialli auch weniger erlösend als verstörend. Die ursprüngliche Ordnung kann nicht wieder hergestellt werden, weil die Unschuld bereits verloren ist, aber auch – das lehren uns die Filme mit jedem, in der Vergangenheit begrabenen Trauma aufs Neue –, weil selbst diese Ordnung von Anfang an nur ein Trugbild war.















Kommentare zu „Sensationslust und Voyeurismus – Giallo-Reihe in Wien“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.