Schreiben über Film (3): "Waldheims Walzer"
In ihrem Dokumentarfilm Waldheims Walzer zeigt Ruth Beckermann anhand der Waldheim-Affäre den Umgang Österreichs mit seiner Vergangenheit im Nationalsozialismus. Drei Kritiken, verfasst von Studierenden des Seminars „Schreiben über Film – Berlinale 2018“ (Stiftung Universität Hildesheim).
Nur sein Pferd

Offizier der Wehrmacht, das sei ein anständiger Beruf gewesen. Das Unterzeichnen von Dokumenten, die die Hinrichtung von 2000 Menschen anordneten, eine ganz normale Tätigkeit. Behauptet Kurt Waldheim. Jahre zuvor gab der UN-Generalsekretär noch an, sich nicht daran erinnern zu können, was er in der Zeit zwischen 1941 und 1945 gemacht habe. Eine Lücke im Lebenslauf, die lange Zeit nur von wenigen hinterfragt wurde.
Als Waldheim jedoch 1986 für das Amt des österreichischen Präsidenten kandidiert, steigt der Druck, über seine Vergangenheit zu sprechen. Vor allem der World Jewish Congress fordert Klarheit über die Machenschaften des Kandidaten, der in Österreich als Familien- und Landesvater gefeiert wird. Auch als belastende Fotos und eine Wehrstammkarte auftauchen, die belegen, dass er Mitglied der SA und des NS-Studentenbunds war, beteuert Waldheim weiterhin, 1938 aus der Armee entlassen worden zu sein und von Kriegsverbrechen nichts gewusst zu haben. Sein Image als Vertreter von Moral, Ethik und Nächstenliebe gerät ins Wanken, und die Waldheim-Affäre spaltet Österreich. SPÖ-Bundeskanzler Sinowatz bemerkt spöttisch: „Ich nehme zur Kenntnis, dass Waldheim nicht bei der SA war – nur sein Pferd.“
Mit Archivmaterial zeichnet Ruth Beckermann die Affäre um Waldheims Präsidentschaft und seine NS-Vergangenheit nach. Zwischentitel mit Daten und Jahreszahl verorten die Fernsehbilder: Aufnahmen von Waldheim, die ihn bei politischen Empfängen, in Interviews und in seiner New Yorker UN-Wohnung zeigen. Ergänzt werden sie von Aussagen und Konfrontationen österreichischer Bürger, die im Frühjahr 1986 auf der Straße ihre Meinung zu dem Politiker äußern.
Einige dieser Konfrontationen wurden von Ruth Beckermann selbst gefilmt, die früh der Protestbewegung gegen Waldheim angehörte. Halb demonstriert, halb dokumentiert habe sie damals. Jetzt ist es ihre Stimme, die die Bilder kommentiert, in einen Zusammenhang bringt und deutlich macht, dass es bei der Waldheim-Affäre nicht nur um die Frage nach Schuld ging, sondern vor allem um den Umgang eines Landes mit seiner NS-Vergangenheit.
(Hannah Kattner)
Die Weigerung, sich zu erinnern
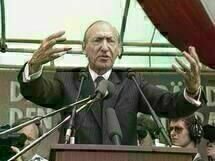
Mit 53,8 % wird er dann doch gewählt. Kurt Waldheim, ehemaliger UN-Generalsekretär und nach eigenen Angaben kein Nazi, gewinnt im Juni 1986 die Stichwahlen und wird österreichischer Bundespräsident. Für die Ansprache, die es für das Fernsehen aufzuzeichnen gilt, setzt sich Waldheim an einen kleinen Tisch vor einer roten Seidentapete. Er lobt den gemütlichen Stuhl und die Beinfreiheit, trinkt noch ein paar Schlucke Tee. Dann wird sein Gesicht für die Kamera präpariert, sein Anzug mit einer Fusselrolle bearbeitet. Jemand fegt den letzten Staub vom Tisch und rückt die österreichische Fahne, die links im Bild steht, zurecht. Der neue Bundespräsident lächelt. Trotz massiver Proteste gegen ihn sowie eines Einreiseverbots in die Vereinigten Staaten wird er noch bis 1992 im Amt bleiben.
Mit der Archivaufnahme und der folgenden Einblendung schließt Waldheims Walzer, der Beitrag der österreichischen Dokumentarfilmerin Ruth Beckermann. Chronologisch zeichnet sie den Wahlkampf von 1986 nach, in dessen Verlauf die Diskussion von Waldheims möglicher Beteiligung an Kriegsverbrechen während der NS-Zeit in Gang kam. Waldheim soll als Wehrmachtsoffizier eine aktive Rolle bei Deportationen und Ermordungen am Balkan und in Griechenland innegehabt – oder zumindest von den Deportationen gewusst haben. Der Kandidat bestreitet das jedoch vehement. „Der Mann, dem die Welt vertraut“, so der Slogan auf seinen Wahlplakaten, bezeichnet die Bestrebungen nach Aufklärung der Medien im In- und Ausland lieber als Verleumdungskampagne.
Bewiesen ist vieles bis heute nicht. Aber wie in der damaligen Debatte geht es auch in dem Film irgendwann nicht mehr um Waldheim und die konkreten Anschuldigungen. Im Fokus steht vielmehr der Umgang mit einer Figur, deren Weigerung, sich zu erinnern, exemplarisch für das systematische Vergessen von Geschichte steht. Indem sie kontinuierlich nationales und internationales TV-Archivmaterial (Montage: Dieter Pichler) verwendet, fragt Regisseurin Beckermann danach, wie medial auf Waldheim geblickt wurde und welche Mechanismen und Institutionen seine Karriere erst möglich machten. Zugleich positioniert sie sich sowohl durch Einspielungen ihrer Stimme, die das Geschehen kommentiert, als auch durch die Verwendung eigener Filmaufnahmen in den Verhältnissen, die sie zu analysieren versucht. Waldheims Walzer erzählt deshalb auch eine persönliche Geschichte der politischen Identitätsfindung.
(Anne Küper)
Beckermanns Ballett

„Er schien sein Volk umgreifen, umschlingen zu wollen.“ Regisseurin Ruth Beckermann kommt dem titelgebenden Protagonisten ihres Dokumentarfilms Waldheims Walzer mit der Kamera nur ein einziges Mal nah. Sie ist fasziniert von seinen Händen, den Gesten, die sie ausführen.
Kurt Waldheim erlebte nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine politische Karriere wie aus dem Bilderbuch, war Außenminister, UN-Generalsekretär, um sich schließlich in seinem Heimatland Österreich als Bundespräsident zu Wahl zu stellen. Zum Auftakt dieses Wahlkampfes allerdings muss er sich plötzlich mit seiner Vergangenheit beschäftigen. Neue Dokumente legen offen, dass er zwischen 1942 und 1945 als Mitglied der SA an Kriegsverbrechen des NS-Regimes beteiligt gewesen sein könnte; seine Unterschrift findet sich auf Deportationsbescheiden, sein Gesicht auf Fotos an Kriegsschauplätzen, an denen er nach eigener Aussage nie gewesen ist.
Ruth Beckermann, Kind zweier Holocaust-Überlebender, gehörte damals zu denen, die die Ausflüchte Waldheims nicht hinnehmen wollten. Die Zahl der Protestierenden wuchs, während die Anschuldigungen zahlreicher und lauter wurden; und wenn es auf der Straße zu Konfrontationen kam, hielt Beckermann mit der Kamera darauf. Sie verknüpft ihre eigenen Filmbilder mit dem Archivmaterial verschiedener Fernsehsender zu einer Montage, die Aufschluss über einen politischen Skandal gibt.
(Margarete Rosenbohm)










Kommentare zu „Schreiben über Film (3): "Waldheims Walzer"“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.