Reich, schön, kaputt – Bret Easton Ellis im Kino
Sein neuer Roman The Shards zeigt einmal mehr, dass American-Psycho-Autor Bret Easton Ellis ein ziemlich cinephiler Schriftsteller ist. Schon darum liegt die Adaption seiner Werke für die Leinwand nahe. Ein Essay über Kurzschlüsse zwischen Literatur und Film sowie Autobiografie und Fiktion.
Im Januar 2023 erschien Bret Easton Ellis’ erster Roman seit dreizehn Jahren: The Shards. Die Handlung ist angesiedelt am Buckley College im Los Angeles des Jahres 1981, in dem es die Clique des damals siebzehnjährigen Autors als Ich-Erzähler mit einem Serienkiller zu tun bekommt, den die Medien „The Trawler“ nennen.
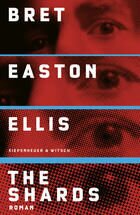
Zu den Markenzeichen seines bisherigen Schaffens, die Ellis in The Shards erneut aufgreift, zählt neben der gegenseitigen Durchdringung von autobiografischer Realität und Fiktion auch der Kurzschluss zwischen Literatur und Film: Zum einen versucht er, filmische Ausdrucksmittel in seine Romane zu übertragen. Zum anderen spielen diese immer wieder teilweise in der amerikanischen Filmindustrie. Der Erzähler von The Shards reflektiert nun so ausführlich über einzelne Filme der frühen 1980er Jahre, wie man es bislang nur aus Ellis’ Essayband Weiß (2019) kannte. Wer sich für Filme und Filmgeschichte interessiert, für den ist die Beschäftigung mit Ellis schon deshalb lohnenswert, weil sein neuer Roman einmal mehr zeigt, dass er ein ziemlich cinephiler Schriftsteller ist.
Verstörendes Sittengemälde: Unter Null

Bret Easton Ellis wurde 1964 in Los Angeles geboren. Mit seinem ersten Roman Unter Null (Less than Zero) gelang ihm 1984 ein Überraschungshit, der ihn fast über Nacht zum Literaturstar machte. Mit einigen anderen Autor*innen – vor allem Jay McInerney und Tamara Janowitz – bildete er das sogenannte Literary Brat Pack. Ihre Romane und Kurzgeschichten über junge, erfolgreiche Menschen, die in den Metropolen L. A. und New York ein Leben voller Alkohol, Kokain, Partys, Sex und Verzweiflung fristen, erzählen wie vielleicht kein anderes kulturelles Artefakt dieser Zeit vom Lebensgefühl der ersten Yuppie-Generation.

Schon aufgrund seiner Filmaffinität liegt es nahe, Werke von Ellis, der bis heute sieben Romane, eine Kurzgeschichtensammlung und eine Essaysammlung veröffentlichte, für die Leinwand zu adaptieren. Bereits 1987 nahm sich Marek Kanievska mit der Verfilmung von Ellis’ Debütroman dieser Aufgabe an. Seine Adaption bietet in der Ausstattung und vor allem der Musikauswahl einiges an schönem Zeitkolorit und ist überdies mit Jami Gertz, dem ziemlich jungen Robert Downey Jr. und Andrew McCarthy in der Hauptrolle des ziellos durchs L. A. der Schönen und Reichen driftenden Jugendlichen Clay gut besetzt. Sonderlich gelungen ist sie dennoch nicht: Ellis’ gerade in seiner sehr losen narrativen Struktur verstörendes Sittengemälde einer Generation, die ohne Ziel oder erwähnenswerten moralischen Kompass auf Alkohol, Koks und Valium von Party zu Party und Affäre zu Affäre mäandert, wird in ein relativ geradliniges Hollywood-Teenager-Drogendrama überführt, das so konventionell ausfällt, dass kaum Spannung oder Interesse an den Figuren aufkommt.
Niemand weiß mehr, mit wem er redet: American Psycho

Wohl nicht zuletzt wegen des ausbleibenden Erfolgs dieser ersten Adaption ließ die zweite Verfilmung eines Ellis-Werkes dreizehn Jahre auf sich warten. Erst im Jahr 2000 nahm sich Mary Harron dem Buch an, mit dem Ellis 1991 der Welthit gelang, mit dem sein Name bis heute hauptsächlich in Verbindung gebracht wird: American Psycho. Im Kern eine bitterböse Satire auf Zeitgeist und Lebensgefühl der Reaganomics, der späten amerikanischen 1980er, löste das Buch mit seinen expliziten Darstellungen von Sex und Gewalt in der Geschichte um den Wall-Street-Broker und Serienkiller Patrick Bateman schon lange vor der eigentlichen Veröffentlichung einen riesigen Skandal aus, insbesondere warfen ihm Kritiker*innen vor, es sei misogyn.
Harrons Verfilmung war nicht zuletzt deshalb besser, aber auch fordernder für das Publikum, weil die Regisseurin vor den stilistischen und narrativen Eigenheiten des Romans nicht zurückschreckte. Ihr Verständnis für die Vorlage zeigt sich bereits darin, dass sie mit der Chronologie der im Buch beschriebenen Ereignisse relativ frei umgeht. So überführt sie die Begebenheiten, die dort eher nebeneinander stehen, als dass sie kausal aufeinander bezogen wären, zwar in die Struktur eines Serienkillerthrillers. Doch gelingt es ihr dabei, den düsteren Pessimismus und die vielfältigen satirischen Spitzen der Vorlage in ihren Film zu übertragen.

Christian Bale brilliert in der Rolle des Patrick Bateman, der bei Ellis ein sonderbar gesichtsloser Killer war, der seinen Körper im Fitnessstudio zum Panzer stählte und sich stets in Designerklamotten von Armani und Co. hüllte. Die Inventur sowohl seiner eigenen Klamotten als auch derer der Menschen, die ihn in seinem Wall-Street-Umfeld umgeben, macht einen nicht unbeträchtlichen Teil des vierhundertseitigen Romans aus. Durch die bedingungslose Andienung an die Schönheitsideale ihrer Zeit gleichen sich die Männer (und Frauen) dieses Milieus irgendwann so sehr, dass niemand wirklich weiß, mit wem er gerade redet – ein Running Gag, der sich durch den Roman zieht. Die Verwechslung des Gegenübers gehört zum Alltag wie die Verabredungen in den angesagten Restaurants, Clubs und Bars im Manhattan der späten 1980er.
Der Aufhebung der Unterschiede zwischen den Individuen im Roman begegnet Harrons Film nicht zuletzt damit, dass sich die Figuren so ähnlich sehen, wie das bei teuer gekleideten weißen Männern in ihren Zwanzigern nur irgend möglich ist. In der Nebenrolle eines Polizisten ist ein gewohnt überzeugender Willem Dafoe zu sehen, dessen Ermittlungen wegen des Mordes, den Bateman an einem seiner Kollegen begangen hat, letztlich erfolglos bleiben. Dass Bateman, der seine Taten immer wieder beiläufig in Gesprächen gesteht, immer obsessiver versucht, die Menschen um ihn herum von seinem monströsen Treiben wissen zu lassen, schließlich aber davonkommt, weil niemand ein wirkliches Interesse daran zu haben scheint, ihn zur Rechenschaft zu ziehen, ist in Buch und Film die bittere Pointe. Um vom Ende der Geschichte von Patrick Bateman zu erzählen, eignet sich ein berühmtes Zitat von Walter Benjamin: „Dass es ‚so weiter‘ geht, ist die Katastrophe.“
Ich-Erzähler-Polyfonie: Die Regeln des Spiels

2002 adaptierte Roger Avery, der aus dem Dunstkreis Quentin Tarantinos kommt, einen weiteren Ellis-Roman für die Leinwand: Die Regeln des Spiels (The Rules of Attraction). Das Buch von 1987 spielt am fiktiven Camden College und lässt eine Reihe verschiedener Ich-Erzähler*innen von ihrem sex- und drogengeschwängerten Uni-Alltag berichten. Die Hauptrollen gaben James Van Der Beek, der zu der Zeit Dawson Leery in der Meta-Teen-Soap Dawson’s Creek (1998–2003) spielte, und Shannyn Sossamon. Van Der Beck spielt Sean Bateman, Patricks Bruder, der sich am Camden College Exzessen aller Art hingibt und sich dabei in eine seiner diversen Gespielinnen, Lauren Hynde (Sossamon), verliebt.

In einem Film, der deutlich in der Tradition des in den 1990ern boomenden US-Independentkinos steht, begegnet Avary der Vorlage und ihrer Ich-Erzähler-Polyfonie mit einigen für die Zeit typischen Gimmicks. Etwa wenn zu Beginn längere Sequenzen komplett rückwärts ablaufen oder wenn er in einer Montagesequenz Victor (Kip Pardue), eine weitere zentrale Figur, im Zeitraffer durch Europa reisen lässt. Auch wenn das mitunter ziemlich anstrengend ist, gelingt es auch Avary in Die Regeln des Spiels, für Ellis’ Pessimismus, die Verzweiflung und Perspektivlosigkeit seiner Figuren, denen es materiell an nichts mangelt, überzeugende Bilder zu finden.
Die schimmernde Kälte L. A.s: Die Informanten

Die vierte und bis heute letzte Adaption eines Ellis-Stoffs, Gregor Jordans Die Informanten (The Informers, 2008), basierend auf der Sammlung lose zusammenhängender Kurzgeschichten, die Ellis bereits in den 1980ern schrieb, aber erst 1994 veröffentlichte, ist zugleich die freieste und mit Abstand beste. Das liegt nicht zuletzt an der Besetzung, in der gerade die alternden Stars Mickey Rourke, Kim Basinger, Winona Ryder und Billy Bob Thornton überzeugen, während die Nachwuchsdarsteller*innen um Amber Heard und Jon Foster etwas blass bleiben. Das passt allerdings auch zu einem Film über das Lebensgefühl von Menschen mit makelloser weißer Haut und schwarzen Ray-Ban-Sonnenbrillen, die ausgiebig feiern, am Strand rumhängen, Sex haben und sich auch in mancherlei krimineller Tätigkeit ergehen. Aber trotz der Struktur eines Thrillers, dessen Finale den überlebenden Figuren genau die Menge Hoffnung gibt, die es braucht, um weiterzuleben, trifft Jordan den Geist der Vorlage gerade darin, dass es ihm eher darum geht, Bilder für ein bestimmtes, zeitlich genau verortetes Lebensgefühl zu finden, als eine Geschichte zu erzählen.

Die entspannte, wohltemperierte Musik dazu stammt von Hellraiser-Komponist Christopher Young. Die Kamera von Petra Korner fängt das Los Angeles des historischen 1980er-Settings als einen Ort ein, dessen Lichtermeer sich funkelnd unendlich in die Nacht zu erstrecken scheint und in dem man sich tagsüber am Pazifikstrand sonnen oder einen Drink nehmen kann. Trotz des Wetters geht von dieser Stadt aber auch, Einstellung für Einstellung, eine bläulich schimmernde Kälte aus, die sich aus dem Seelenleben ihrer Bewohner*innen auf ihr Umfeld zu übertragen scheint.
Autobiografie und Fiktion: The Shards

Die literarische Welt des Bret Easton Ellis begleitet mich seit nunmehr über zwanzig Jahren – also durch mein Abitur und mein gesamtes literaturwissenschaftliches Studium hindurch. Mein erstes Buch, im Sommer 2019 geschrieben, war eine Studie zu American Psycho. Erst bei der Arbeit an dem Text ergab sich, dass es in ihm letztlich auch um die Beziehung zu meiner Mutter und einen schwerwiegenden Konflikt mit ihr, der in seine Entstehungszeit fallen sollte, gehen würde. Aufgrund der persönlichen Dinge, die im autobiografischen Rahmen, den Vor- und Nachworten des Buches, verhandelt wurden, die eben nicht nur mich, sondern auch meine Mutter betrafen, veröffentlichte ich die Arbeit, die den Titel Personal (Cliff) Notes on a Man Who Never Was – Marginalien zu Bret Easton Ellis' American Psycho trägt, unter dem Pseudonym Nici G. (in der Autorenvita findet sich mein echter Name nur noch minimal entstellt, hinzu kommt ein letztes Jahr geschriebener Disclaimer zur Beziehung zu meiner Mutter früher und heute).
Die Verknüpfung von Literaturwissenschaft und persönlicher Erfahrung in meinem Buch korreliert dabei auch mit dem Kurzschluss von autobiografischer Realität und Fiktion, die sich von jeher durch Ellis’ Schaffen zieht. In The Shards ist dieser Zusammenhang expliziter, offensichtlicher denn je: Der Ellis der Gegenwart blickt zurück auf seine eigene Jugend, deren Konflikte mit frei erfundenen Begebenheiten angereichert werden; wie bereits im vorvorletzten Roman Lunar Park, in dem sich eine fiktionalisierte Version des erwachsenen Ellis der Gegenwart des Jahres 2005 in ein nobles Anwesen in den Vororten New Yorks zurückgezogen hat, um mit ihren Ehe- und Drogenproblemen zu kämpfen. Doch bald sieht sich der Protagonist dabei auch mit seinen fiktiven Schöpfungen, darunter Patrick Bateman, konfrontiert, und findet sich schließlich in einer stark an Stephen King gemahnenden Genregeschichte um verschwindende Kinder wieder.
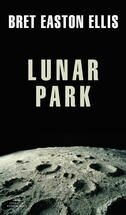
Sind seit Lunar Park das eigene Leben, aber auch sein bisheriges Schaffen wichtige Referenzpunkte in Ellis’ Werk, so greift The Shards einerseits eine Vielzahl seiner bekannten Themen und Motive auf. Andererseits eröffnet er dabei neue andere Perspektiven auf sie: Besteht die Tragödie der privilegierten Teenager, die alt genug sind für den Exzess, aber nicht alt genug, um stabile Beziehungen zu sich selbst und zueinander aufzubauen, gar nicht darin, dass sie nicht erwachsen werden können, sondern es viel zu früh sein mussten? Findet Ellis durch die Reflexion über seine Vergangenheit zur Katharsis, deren bloße Möglichkeit Patrick Bateman kategorisch ausschloss? Ist für den jugendlichen Ich-Erzähler, der versucht, seine Homosexualität zu verbergen, der begehrte Kommilitone, der vielleicht ein Serienkiller ist, Agent seines schmerzhaften Coming-outs?
Während Ellis diese Fragen im Epilog des Romans zwar selbst aufwirft oder zumindest anreißt, bleibt er uns konkrete Antworten genauso schuldig wie die Auflösung seines Whodunit-Plots. Bietet The Shards einerseits die Quintessenz seiner vorherigen Bücher, schlägt dieser Schluss zugleich leise und subtile Töne an, wie man sie bisher von ihm nicht kannte. Bret Easton Ellis bleibt sich treu in der Art, wie er sich an seiner eigenen Geschichte, seinen Lebensthemen abarbeitet, aber entwickelt sich dabei doch künstlerisch weiter. Das macht ihn, nicht nur für Filminteressierte, zu einer der interessantesten literarischen Stimmen seiner Generation.















Kommentare zu „Reich, schön, kaputt – Bret Easton Ellis im Kino “
Stiglegger, Marcus
Müsste man nicht Paul Schraders THE CANYONS noch würdigen, zu dem Ellis das Drehbuch schrieb?
Nicolai Bühnemann
THE CANYONS zu berücksichtigen, wäre in der Tat interessant gewesen, auch im Hinblick auf Ellis' Arbeit in und für Hollywood.
Hatte ich schlicht nicht dran gedacht. :)
Thomas
Danke für den Hinweis, Nicolai, ich schau mir die Kritik mal an