Pasolinis Traum – Die Oper “San Paolo” in Osnabrück
Pier Paolo Pasolinis Manuskript für einen Film über den heiligen Paulus blieb bis zu seinem Tod unvollendet. In der Opern-Adaption des Komponisten Sidney Corbett steht nun aber vor allem Pasolini selbst im Zentrum.

Die Arme in die Höhe gerichtet, hilflos oder vielleicht hilfesuchend, weil das Pferd, auf dem er sitzt, gestürzt ist. Die ihn begleitenden Soldaten, wie der gestürzte Reiter in Rüstung, blicken erschrocken auf Gott, der über der Szene schwebt, hinabblickt und einen Lichtstrahl sendet. So imaginierte Lucas Cranach der Ältere 1549 in einem Tafelgemälde die Bekehrung des Saulus zum Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Seiner Zeit gemäß rekonstruiert Cranach die Episode aus der Apostelgeschichte nicht als ein Geschichtsbild, sondern malt die Reiter in Rüstungen seiner Zeit, lässt sie durch eine mitteleuropäische Landschaft ziehen, und Damaskus erscheint als Schloss Mansfeld im Hintergrund.
Die physische Präsenz des Paulus

Diese aus der Renaissance bekannte Überführung neutestamentarischer oder mythischer Geschehnisse in ein zeitgenössisches Milieu findet sich auch im Werk Pier Paolo Pasolinis. Der italienische Filmemacher entschied sich etwa dagegen, seinen Das 1. Evangelium – Matthäus (Il vangelo secondo Matteo, 1964) in Israel und Palästina zu drehen und suchte stattdessen die bäuerlichen Gegenden in Kalabrien und Apulien auf. Für ein zeitgleich entstandenes Projekt über das Leben des Apostel Paulus wollte Pasolini die Lebensstationen des Heiligen gar an konkrete Schauplätze des 20. Jahrhunderts verlagern: Paulus sollte im besetzten Frankreich ein Kollaborateur sein, auf dem Weg ins faschistische Spanien von Gott berufen werden und schließlich in Paris und New York predigen. Was bei Cranach sich noch als ein Stil seines Jahrhunderts erklären lässt, als Umgang mit der Bibel ohne historisches Bewusstsein, wird im Reproduktionsmedium Film zur Irritation, gibt uns doch der Film ein Bild von der Materialität der Welt – eine Welt, in die die Paulus-Handlung sich nicht nahtlos einfügt.
Pasolini betonte in seinem Drehbuch die Gegensätzlichkeit zwischen den Handlungsorten und den Figuren – deren Texte nahezu ausschließlich aus Zitaten aus der Apostelgeschichte und den paulinischen Briefen komponiert sind – durch Verweise auf die Notwendigkeit, an realen Orten zu drehen. Nicht nur seine Theologie, sondern Paulus selbst sollte physisch im 20. Jahrhundert anwesend sein. Doch es bleibt eine Kluft zwischen dieser körperlichen Präsenz und der ihn umgebenden Welt, und hätte Pasolini den Film drehen können, wären wir Paulus wohl in einem solchen Zwischenbereich begegnet. Pasolini kam es auf die Ambivalenz dieser Figur an, der Apostel ist immer auch der Christenverfolger Saulus, ein selbstbewusst-charismatischer Prediger, der zugleich mit einem „Stachel“ von Gott bestraft wurde, der die Berufung zur persönlichen Freiheit durch Jesus in den Vordergrund stellte und gleichzeitig als Gründer der gebieterischen Kirche gilt.
Aus dem geplanten Film wurde allerdings nichts, überliefert ist nur ein umfangreiches Manuskript zum „Drehbuchentwurf für einen Film über den heiligen Paulus (in Form von Notizen für einen Produzenten)“, das im Mai 1968 entstand. 1974 überarbeitete Pasolini das Material noch einmal, als sich einige Produzenten interessiert zeigten, aber der Stoff blieb dennoch in der Schublade. Der gewaltsame Tod des Regisseurs in im November 1975 beendete die Arbeit am Manuskript dann endgültig.
Paulus im Weltkrieg, Paulus in New York

Am Theater Osnabrück bringt dieser Tage Alexander May die Opern-Adaption dieses Drehbuch-Entwurfs durch den US-amerikanischen Komponisten Sidney Corbett unter dem Titel San Paolo auf die Bühne. Pasolini unterteilte seine episodenhaften Erzählung in zehn Zeitabschnitte, die Corbett auf sieben Szenen strafft. Nach einem Prolog ohne Musik, der zwei Pauli vorstellt, den jungen und den kranken, springt die Handlung der Oper in das besetzte Paris (Jerusalem) im Jahr 1941. Paulus wird Zeuge der Erschießung (Steinigung) eines Résistance-Kämpfers (Stephanus). Daraufhin wird er zur weiteren Verfolgung von Anti-Faschisten (Christen) nach Barcelona (Damaskus) geschickt. Auf dem Weg kommt es zum Damaskus-Erlebnis: „Warum verfolgst Du mich?“, fragt ihn Gott, und Paulus wird blind. Anania heilt Paulus im Auftrag Gottes und der frühere Verfolger wird zu einem Anhänger der Anti-Faschisten, die ihm begreiflicherweise zunächst ablehnend gegenüberstehen. Er geht für einige Jahre in die Wüste und kehrt schließlich nach Paris zurück, wo er der kleinen Gemeinde offenbart, dass Jesus ihn aufgefordert habe, nicht nur Juden, sondern auch Heiden zu bekehren.
Von dieser Stelle an wird die direkte Übertragung der biblischen Handlung auf die Verhältnisse des 20. Jahrhunderts in San Paolo zunehmend schief. Die heftigen Diskussionen, wer Christ sein dürfe und wer nicht, ob also der Glaube auch für Nicht-Juden offen sei, fügt sich in kein Narrativ der Kriegs- und Nachkriegszeit. Konsequenterweise wird die Oper zunehmend traumhaft: Paulus träumt zum einen im Haus seiner Eltern von seiner Kindheit, unter der Pflege von Timoteus erscheinen ihm zum anderen Bilder aus einem Konzentrationslager, ein Hilferuf aus dem Norden, analog zu der Vision Paulus von einem Mann aus Mazedonien. In der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft predigt Paulus auf einer schicken Bonner Cocktailparty und vor Intellektuellen in einem Buchladen. Schließlich wird er von Neonazis verprügelt. Nach weiteren Predigten, Demütigungen und Verhaftungen gelangt Paulus schließlich in die Hauptstadt der Macht, die nicht mehr wie im ersten Jahrhundert Rom ist, sondern New York. Dort predigt er den Ausgestoßenen der Gesellschaft: Schwule, Prostituierte, Hippies. Sie sind von ihm begeistert, bis er von der Treue zum Staat spricht. Am Ende sitzt Paulus alleingelassenen in einem kleinen New Yorker Hotelzimmer.
Oper über Paulus, Oper über Pasolini

Die Inszenierung von May und die Musik von Corbett gehen von dem ambiguen Zwischenbereich aus, in dem sich die biblischen Körper und die Orte des 20. Jahrhunderts befinden. Anstatt die realen Schauplätze auf dem Bühnenraum zu rekonstruieren, ist auf der Drehbühne ein vier Räume umfassender Kubus aufgebaut, dessen leere Wände als Projektionsflächen dienen. So findet San Paolo eine überzeugende, operngerechte Lösung für Pasolinis intendierte Kollision von Realität und Mythos. Dies führt nach der ersten Szene zur Irritation: Während der Raum sich wegdreht, bleibt die Textur stehen, es handelte sich bei der Holzstruktur nur um ein projiziertes Bild. Dieser mediale Einsatz dient aber nicht nur für ein Delirium fester Raumstrukturen, über ihn wird auch ein Außen hineingeholt. Mit dokumentarischen Bildern aus einem Konzentrationslager und Bildern von Papst Pius XII., der von einer Sänfte aus mit goldener Tiara bekrönt Gläubige segnet, während Paulus gegen kultischen Pomp predigt, integriert May ein realistisches Gegenstück zur Bühnenrealität in die Oper.
Über diese Projektion kommt schließlich auch der Autor selbst ins Stück: May überblendet dokumentarische Aufnahmen Pasolinis mit Großaufnahmen des Paulus-Darstellers, und an dieser Stelle wissen wir, dass die Oper über Paulus eine Oper über Pasolini ist, fernab eines bloß biografischen Musiktheater-Versuchs wie etwa Walter Haupts Pier Paolo. Autor und Figur werden durch diese Inszenierung und auch durch die Musik einander angeglichen. Während Pasolini in seinem Drehbuch-Entwurf der Musik nur eine marginale, kommentierende Funktion zukommen ließ, wird sie in San Paolo zur Hauptsache. Das Libretto ist in Italienisch gehalten, der Sprache des Originalmanuskripts. Eine breite Instrumentierung trifft auf eher kammermusikalische Arrangements, sodass die Singstimmen gut hörbar bleiben. Die sich immer wieder in die Höhe schraubenden Glissandi, das schicksalhafte Klopfen in den Schlägerbereichen und der Sopran Gottes („Una voce“), untermalt von hohen Querflöten und Piccoloflöten, verwandeln Paulus Leben in ein nicht abgeschlossenes. Statt physisch präsent zu sein, wie Pasolini es vorsah, verwandelt die Oper Paulus’ Gegenwart in einen Traum, in eine potenzielle Präsenz im 20. Jahrhundert und sieht von gesellschaftlichen Verhältnissen – gegen Pasolinis Intentionen – völlig ab.
Pasolini gärt noch immer
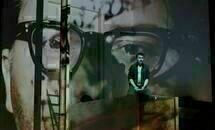
Corbetts Oper ist also der Versuch, Pasolini auf der Bühne zu aktualisieren. Dass er am Ende dort als ein Vereinsamter zurückbleibt, die Musik immer stärker reduziert wird, das Orchester sich auf ein Quartett verkleinert, bevor es schließlich vollkommen verstummt, liegt auf dieser Linie. Paulus ist Pasolini geworden, und sein isolierter Tod ist der Antonio Gramscis, der italienische Marxist, den Pasolini so bewunderte. In seinem Gedicht „Le ceneri di Gramsci“ blickte Pasolini auf Gramsci als den „eingekerkerten Gramsci, der umso freier ist, je mehr er, von der Welt abgeschlossen, sich außerhalb der Welt, in einer unfreiwilligen leopardischen Lage befindet“. Hier decken sich Paulus, Gramsci und Pasolini. Das Versprechen von Pasolinis Paulus-Projekt kann Corbett dagegen nicht einlösen, dafür ist er zu sehr eingenommen von der Gestalt des Autors und blind gegenüber dessen scharfsinnigem Blick für die Vereinzelung des Menschen im 20. Jahrhundert. Seit dem Tod des Regisseurs sind viele Ausstellungen, Filme, Bühnenwerke und Bücher entstanden – und San Paolo ist eine weitere Hommage. Aber eine Hommage, die uns, trotz fehlender Konkretisierungen, durch den „offenen Intensitätsraum der Musik“, wie Ernst Bloch einmal über die Gattung der Oper schrieb, das Potenzial und das noch immer Gärende Pasolinis vor Augen und Ohren führt.
Uraufführung am 28. April 2018
Besuchte Vorstellung 01. Juni 2018
Musikalische Leitung: Daniel Inbal
Inszenierung: Alexander May
Bühne: Wolf Gutjahr
Chor: Markus Lafleur
Solisten: Jan Friedrich Eggers (Paolo), Daniel Wagner (Stefano/Timoteo), Lina Liu (Una voce), Genadijus Bergorulko (Anania/Barnaba), Klaus Fischer (Un uomo anziano), Rhys Jenkins (Pietro), Susann Vent-Wunderlich (Giovanni detto Marco), José Gallisa (Un secondino) u.a.













Kommentare zu „Pasolinis Traum – Die Oper “San Paolo” in Osnabrück“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.