Munter, munter in die Krise – Weimarer Tonfilmoperetten
Von der Operette zum Propagandafilm: Das Hamburger Cinefest legte einen Schwerpunkt auf dem deutschen Musikfilm. Ein Bericht über Genderbending, königliche Wechselspiele und perfekte Klangmontagen.

Das Cinefest, das 2004 ins Leben gerufen wurde, stellt man sich vielleicht am besten wie die etwas gediegenere Version von Film:Restored vor, mit deutlich weniger Restaurationen. Das Publikum ist eher um die 50, der Ton akademischer, die Lesarten der Filme sehr autorenlastig. Das Festival wird vom CineGraph – Hamburgisches Centrum für Filmforschung e.V. und dem Bundesarchiv in Hamburg organisiert und vor allem im Metropolis ausgetragen, mit einer Preview im Abaton und einer Zugabe im Lichtmess Kino, bevor das Programm auf Reisen geht und im nächsten Jahr u.a. in Berlin, Wiesbaden, Koblenz und Prag gezeigt wird. Zeitgleich mit dem Festival findet der Internationale Filmhistorische Kongress statt, der thematisch auf das Programm des Festivals abgestimmt ist. Der filmarchivarische Fokus wurde in den bisherigen Programmen dabei dezidiert auf Deutschland vor und während dem Zweiten Weltkrieg und die damit einhergehenden emigrantischen Bewegungen gelegt, was es auch durchaus bewusst zu einem Festivals des jüdischen Filmerbes macht.

In diesem Jahr hieß das Motto „Achtung! Musik: Zwischen Filmkomödie und Musical“. Was den frühen deutschen Tonfilm dabei auszeichnet und wie er zu definieren ist, das ist eine durchaus komplexe Frage, die über die zwölf Filme, die ich sah, nicht ganz beantwortet werden konnte. Auch weil jede Frage automatisch auch eine Gegenfrage auslöst: Wenn die Gesangsnummern motiviert sind, was löst sie aus? Wenn die deutsche Tonfilmoperette politisch agiert, wie zeigt sich das in seinen musikalischen Arrangements? Was sich festhalten lässt, ist ein besseres Verständnis der Produktionsmechanismen, und wie diese ihre Stars definierten. Die UFA ließ zwischen 1930 und 1938 ihre Filme mit einem wechselnden Support an US-amerikanischen und französischen Schauspielern ebenfalls auf Französisch und Englisch drehen, um diese in den dortigen Märkten abzusetzen. (Die dementsprechenden Prints sind dabei eher schlecht überliefert, weil die Nationalarchive sich nicht für die Produktionen eines deutschen Studios zuständig fühlten.) Lilian Harvey, die alle drei Sprachen beherrschte, wurde nicht zuletzt deshalb zu einem der gefragtesten Stars.
Das Tonfilmlustspiel als urbane Romanze

Trotz ihrer auch filmischen Allgegenwärtigkeit (u.a. auch gesichtet in Die Keusche Susanne, Capriccio, auf den ich noch zurückkommen werde, und der englischen Version The Love Parade) dauerte es bis Paul Martins Ein blonder Traum (1932), dass Harvey für mich klickte. Dieser zählt zu den Filmen, die Lukas Foerster in seinem entsprechenden Programm für die letztjährige Ausgabe von Il Cinema Ritrovato als Tonfilmlustspiel bezeichnete, ein Musikfilm, der sich abseits der Graustarkian Hofpossen abspielte, urbaner und damit näher dran an den Arbeitern und dem ökonomischen Umschwung während der Weimarer Zeit.

Harvey spielt Jou-Jou, eine Zirkuskünstlerin, die von einem Betrüger über den großen Schwindel von Hollywood reingelegt wurde und nun von Los Angeles träumt, aber verarmt auf der Straße lebt. (Harvey sollte ein Jahr später wirklich nach Hollywood auswandern, wo sie zwischen 1933 und 1934 erst für Fox und dann für Columbia vier Filme drehte.) Sie gerät in eine Dreiecksbeziehung mit zwei Fensterputzern, die beide Willy heißen und von Willy Fritsch – der zusammen mit Harvey das vielleicht bekannteste Filmduett des Weimarer Musikfilms bildete – und Willi Forst gespielt werden. Jou-Jou kommt in einer aus alten ausrangierten Bahnwagons geschaffenen Vorstadtoase unter und die drei versuchen sich als Throuple, was aber an den männlichen Konkurrenzgedanken scheitert. Die Freundschaft zwischen den Männern ist komplex, navigiert persönlichen Ehrgeiz und sexuelle Unsicherheiten mit einer Sanftheit, die immer leicht tragischere Züge annimmt. Miniaturmontagen lassen von Hollywood träumen, während die Willys die Glasfassaden der neuen Hochhäuser putzen. Am Ende erbettelt sich Jou-Jou eine Audition, die Harveys Gesicht zwischen Ekstase, Showmanshipsmile und purer Verzweiflung wechseln lässt. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass Martin and Harvey damals frisch verheiratet waren, aber kein Film gab Harvey so viel Platz, so unterschiedliche Emotionen zu spielen oder stellte ihre tänzerische Ausbildung so in den Vordergrund.

Nachdem Wilhelm Thiele zusammen mit Erich Pommer bei der UFA mit Die Drei von der Tankstelle (1930) – conspicuously absent vom Festival, aber auf YouTube zu sichten – den deutschen Tonfilm etablierte und ihm die Form der Operette gab, zerstritt er sich mit Pommer und wechselte von der UFA zu kleineren Produktionen, nahm die Form jedoch mit sich und drehte Die Privatsekretärin (1931). Es ist ein Film, der wie Ein blonder Traum dichter an der Lebensrealität dran ist, aber dennoch den Realismus immer der Romantik opfert. Renate Müller spielt Vilma Förster, die nach Berlin reist, um Arbeit zu finden und sich eine Stelle als Sekretärin in der Wirtschaftsbank erkämpft. Die sexuelle Ausbeutung durch den Bereichsleiter ist hier einfach als Fakt dargestellt, der bewusst miteinkalkuliert wird. Es ist 1931 und das Geld ist knapp. Frau arbeitet für 127 Reichsmark, Mann für mehr, was die Ehe zu einer rein wirtschaftlichen Institution macht, um das Leben etwas erträglicher zu gestalten. Das Drehbuch ist sich dieser ökonomischen Zwänge sehr bewusst und zieht daraus dramaturgische Konsequenzen: Nachdem Vilma ein Meet-Cute mit ihren Kollegen an der Mercedes-Schreibmaschine hat und sich danach dem Hedonismus des Nachtlebens hingibt, weist sie ihn zurück, weil seine Stellung zu niedrig ist. Der Kollege (Hermann Thimig) enttarnt sich jedoch bald als Direktor und es entspinnt sich eine Beziehung, in der beide Machtverhältnisse und Geschlechterdynamiken austesten, ohne sie komplett umzudenken.

Der wahre Standout ist jedoch Felix Bressart als Bankdiener Hasel. Bressart ist eine Bohnenstange, die mit preußischer Strenge gekleidet ist, wobei sein rheinischer Akzent eine Lockerheit zeigt, die sein Körper aufnimmt. Er schlackst und stolpert und tanzt durch das Bild mit einer Freiheit und Improvisationslust, die auf den Film selbst zu reagieren scheint, der sich seinerseits mit großer Freude von Dolly zu Dolly bewegt. Einmal übernehmen die Instrumente den Dialog, und überhaupt wird der Song nicht mehr als zeitlich und örtlich fixierte Performance – Personen singen an einem Set für mehrere Kameraeinstellungen – verstanden, sondern in die Montage überführt. Das musikalische Thema findet sich in der Partitur wieder, wird angespielt, dann wieder angesungen, dann wieder angespielt, bis es wie hier mit „Ich fühle mich so glücklich“ den Film zu strukturieren beginnt und seinen Rhythmus prägt. Bressart bleibt jedoch das freie Radikal und Thiele schenkt ihm den Film, dehnt die Szenen aus, um ihm Platz zu geben, und fädelt ihn immer wieder in den Plot ein.
Krieg den Palästen, Küsse dem Volk

Diese beiden Filme bilden im Programm eher die Ausnahme. Viele der anderen Filme bedienen sich jener königlichen Wechselspiele, in der ein Bürger in den Kreis einer erfundenen Königsfamilie eintritt und sich in die Königin oder Prinzessin verliebt. Die sozialen Strukturen sind dabei so fluide, dass auch eine Annäherung nach unten möglich ist. Der beste Twist dieser Formel ist Ihre Hoheit befiehlt (1931) von Hanns Schwarz, neben Thiele einer der wichtigsten Regisseure des frühen deutschen Musikfilms. Der Film beginnt mit einem Meet-Cute auf dem Gesindeball, beide flirten miteinander und basteln sich ihre Identität, bevor man auf die Brüderschaft antrinkt. Dann schleicht sich die Prinzessin Marlene-Christine (Käthe von Nagy) in ihren Palast zurück und der Leutnant Conradi (Willy Fritsch) erscheint nächsten Morgen betrunken zum Appell und wird prompt, aber ungesehen von der Prinzessin befördert. Es entspinnt sich eine Romanze, in der die Initiative von der Frau ausgeht und erwidert wird, bis die Emotionen gekränkt werden, Conradi verhärtet und die Frau für die Liebe ihre Macht aufgeben muss.

Die noch extremere Variante dieser Erzählung ist Ernst Lubitschs The Love Parade (1929), in der Maurice Chevalier, die charmanteste slut, die jemals einen Screen segnete, wegen seinen Affären zurück an den Hof bestellt wird und prompt eine Affäre mit der Königin beginnt, wobei diese die komplette Kontrolle über ihre Beziehung sowie die Politik des Landes behält, woraufhin Chevaliers Graf Renard mit kindischer Bockigkeit und gezieltem Sadismus reagiert, bis die Machtbalancen zu seinen Gunsten gekippt sind. Das ist weniger rational erklärbar, als dass es etwas über eine Zeit aussagt, in der Geschlechterdynamiken für einen Film lang ins Wanken geraten konnten, solange sich gegen Ende die Waage wieder auf der männlichen Seite senkt.
Tanz im Exil und Italotrash in der Heimat

Die letzte Spannung, die angesprochen werden muss, ist der deutsche Musikfilm als Exilfilm, nachdem mehr und mehr Juden begannen, das Land zu verlassen, und seine Vereinnahmung während dem Zweiten Weltkrieg. Ball im Savoy (1935) von Steve Sekely (damals als Stefan Székely) ist eine Ungarisch-Österreichische Co-Produktion, die in Budapest gedreht wurde. Der gesamte Cast sowie die meisten Personen, die an der Produktion mitwirkten, waren jüdisch; überhaupt waren diese Produktionen oftmals Auffangbecken und Arbeitsmöglichkeit für geflüchtete Filmeschaffende. Die Handlung ist eine der üblichen Verwechslungsspiele, der Film eine anscheinend freie Interpretation der entsprechenden Operette, was bedeutet, dass es mehr Dialogszenen gibt und mehr Spielraum für die einzelnen Performer, ehe Gitta Alpár in ein noch glamouröseres Kleid schlüpfen muss und Leute erneut um sie herumtanzen. (Es ist allgemein interessant, wie wenig dieser Songs hängen bleiben und wie unerheblich diese für den Genuss der Filme sind.) Felix Bressart kämpft sich mutig durch die Tücken der Sprache, während Willi Stettner sich eine Romanze erdreistet. Ball im Savoy steht stellvertretend für die Lockerheit dieser Filme, in denen alles passieren kann, aber auch alles reflektiert werden muss – in Song, Tanz oder gar auf der Metaebene, wie in Max Ophüls Die verliebte Firma (1932).

In Nazideutschland wurde Ball im Savoy nie gezeigt, man gab den Musikfilm als dezidiert jüdische Form des Unterhaltungskinos aber nicht auf, sondern überführte ihn in den Propagandafilm. Das Ergebnis von einem Film wie Rolf Hansens Die große Liebe (1942) ist dabei ernüchternde Langeweile. Viktor Staal – ein lebender Holzspatel mit dem Charm einer CSU-Tagung – spielt einen Oberleutnant, der von der Nordafrikafront nach Berlin versetzt wird und sich dort in die bekannte Sängerin Hanna Holberg (Zarah Leander) verliebt. Aber die Wehrmacht ruft nach Polen, und so lernt Frau zu leiden und zu hoffen, dass doch die Invasion schnell und erfolgreich zu Ende gehen möge. Dazwischen singt sie noch Schlager für Soldaten und navigiert ihre Beziehung mit ihrem kreativen Partner (Paul Hörbiger, so etwas wie ein Herz, wenn man es diesem Film schenken will). Der Film zieht sich und zieht sich mit Zarah Leanders verrauchter, fragiler Stimme als einzige interessante Textur. Was hier an Ideologie gezeigt wird, ist so offensichtlich und so brechreizerzeugend in seiner Offensichtlichkeit, dass es schon fast wieder kitscht. Ein Film, der abseits von akademischen Arbeiten wahrscheinlich vergessen werden kann.
Punktgenauer Tonschnitt
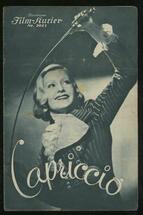
Interessanter ist Capriccio (1938), inszeniert von Karl Ritter, der vor allem Kriegsfilme für das Dritte Reich drehte, aber hier einen für sich selbst machte. Capriccio bezeichnet als eine Kunstform das lustvolle, spielerisch Überschreiten der Grenzen des Geschmacks. Anything goes, aber hier vor allem in den Takten der Partitur, die Alois Melichar zu gut 80 Prozent geschrieben hatte, bevor auch nur ein Frame gedreht wurde. Der Film eröffnet dementsprechend auch auf einem Kostümball, in dem die Paarungen vorgestellt und mit wenig versteckten Schnitten in Schwung gebracht werden. Lilian Harvey spielt Magdalene, die einzige Enkelin eines Generals, die dieser allerdings wie einen Jungen im Schwertkampf und Saufen erziehen lässt, damit sie sich, sobald er stirbt, gegen die Hofintrigen selbst zur Wehr setzen kann. Harvey spielt große Teile des Films dementsprechend auch als Don Juan De Casanova.

Damit beginnt ein konstantes Genderbending, das sich durch den ganzen Film zieht. Wegen der Dominanz der Partitur werden viele Passagen im Sprechgesang vorgetragen. Es findet sich hier auch die vielleicht reinste Form des Tonbilds. Magdalene wird in ein Kloster eingeliefert, wo die Nonnen ihr die Vergebung singen und sie mit einer Bibel als Mitgift in eine Zelle zwingen. Wann immer Magdalene das Buch öffnet, ertönt der Chorus der Nonnen als lautstarker Callback. Der Tonschnitt ist dabei punktgenau an die Bewegungen im Bild angepasst, sodass der Chorus durch das ständige Öffnen und Schließen der Bibel bald zur Kakophonie geschnitten wird. Es ist eine der bemerkenswertesten Szenen im ganzen Programm. Dass sie möglich ist und auch technisch abspielbar war, spricht auch für die raschen technischen Neuerungen bei den Tonsystemen und Experimenten mit dem Lichttonverfahren.
Ritter inszeniert das Ganze bewusst so frei von irgendwelcher Ideologie wie irgend möglich. (Hitler und Himmler waren nicht überzeugt und schickten ihn zu den Kriegsfilmen zurück.) Aber der Film spielt sich schnell in eine Sackgasse; wenn nichts eine Konsequenz trägt und jede Szene im Schabernack endet, gibt es wenig Momentum oder gar Emotionen. Es ist bis auf die oben beschriebene Szene die Art von Kinokuriosum, die man hofft, auf Festivals zu entdecken, die aber auch kaum außerhalb von diesen spezifischen Räumen programmiert werden könnte.












Kommentare zu „Munter, munter in die Krise – Weimarer Tonfilmoperetten“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.