Kurzfilmtage Oberhausen 2019: Viele Versprechen
Was ist das für eine Magie, wenn die richtigen Kurzfilme aufeinander folgen? Kein Trailer kann diese Erfahrung bewerben. Über Oberhausener Verheißungen und ihre Verkehrung ins Gegenteil.

Die Tasche ist schon gepackt, in ein paar Stunden geht der Zug, auf dem Weg zum Bahnhof schleppe ich mich nochmal ins Kino. Es ist das für mich vorletzte Programm. Kurz male ich mir aus, wie es wäre, wenn ich statt dem Sparpreis einen Flextarif gebucht hätte und nun nicht nur automatisch, sondern mit vollem Willen in die Oberhausener Lichtburg ginge. Würde ich dann andere Filme sehen, gar keine oder dieselben Filme nur anders?
Gedankenspiele, die den verwöhnten Festivalgast manchmal ereilen, wenn er in kurzer Zeit zu viele Filme gesehen hat und nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht. Mir geht es häufig so, wenn ich ohne größere Pausen von morgens bis abends im Kino sitze. Was für viele wie ein Luxus klingen mag oder wie ein absurder Job, ist natürlich beides. Kurzfilmfestivals machen diese Erfahrung nur sichtbarer und spürbarer, weil sie eine besondere Form der Anspannung provozieren und einfordern, sich in kurzer Zeit auf viele unterschiedliche Ansätze einzulassen. So wirken die Kurzfilmtage Oberhausen mit ihrer großen Bandbreite an Experimentellem und Narrativem, Ernstem und Albernem, Wichtigem und Läppischem wie eine Toleranzfabrik.
Minoritäten auf einen Schlag

Bei Kurzfilmen ist das Diskursive in der Programmierung angelegt. Unterhält man sich mit anderen – Oberhausen synchronisiert die Pausen der bis zu sechs parallel laufenden Vorstellungen geschickt fürs Miteinander-ins-Gespräch-kommen –, geht es schnell darum, wie die Filme zueinander in ein Verhältnis treten, mehr um die Erfahrung als um das einzelne Werk. „Das war jetzt doch voll das Minoritäten-Programm“, regen sich zwei Freunde von mir über einen der Wettbewerbs-Blöcke auf, bei dem sie erkannt zu haben glauben, dass die Filme aufgrund ihrer Sujets zusammen gezeigt werden.
„Das war schon letztes Jahr so. Im deutschen Wettbewerb gibt es immer einen Block mit Migrant*innen und Queeren!“ Gemeint ist in diesem Fall der DW3, wie es im Oberhausener Lingo heißt, also das dritte der vier deutschen Programmen. Und tatsächlich, ich blättere im Katalog und meiner Erinnerung: Im Gegensatz zu den anderen Blöcken, die weniger leicht als Ergebnis thematischen Denkens zu erklären sind, finden sich hier überwiegend Migrationsgeschichten zusammen mit einem Film über Dragqueens und Ideen von Männlichkeit. Mir war es nicht aufgefallen, und prompt fühle ich mich ertappt. Ist mein Radar für die Vernischisierung von (oftmals) diskriminierten Minoritäten nicht gut genug? Dass ich den Blick für thematische Verknüpfungen zugunsten ästhetischer Wahrnehmung vernachlässige, ist keine gute Ausrede. Und dass schwule Liebe und koloniale Geschichte auch in Filmen anderer Programme eine Rolle spielen, ändert nichts daran, dass nur Minoritäten thematisch gebündelt erscheinen.
Knepperges persönlich

Als Gegengift zu den Meta-Fragen nach der Programmierung versuche ich mich treiben zu lassen. Ich erhoffe mir einen anderen Bezug zu den Filmen, eine spontane Reaktion oder eine subjektive Eingebung für die richtige Balance. Schließlich haben Spekulationen über die Logik der Zusammenstellung (statt Eindrücke ihrer Wirkung) früher oder später immer etwas Frustrierendes, weil sie nicht nur in der Regel zu kurz greifen, sondern auch entlarven, wessen Geistes Kind die Unterstellungen sind. Oft genug steckt im diskursiven Zeitgeist am meisten Ideologie. Die aktuelle angelsächsische Filmkritik zeigt die Auswüchse davon. Nicht Naivität ist die Antwort, aber Begeisterungsfähigkeit gehört schon dazu. Eine der besten Vorstellungen in diesem Jahr stiftet dazu an: Rainer Knepperges hat eine Carte Blanche erhalten, sie nennen es hier „NRW persönlich“.
Zusammen mit eigenen Filmen hat Knepperges ein raffiniert wildes Programm erstellt, bei dem die Sprünge groß sind, die inspirierenden Verbindungen aber noch größer. Der älteste Film stammt von 1953, der jüngste von 2017. Eine Art Lehrfilm für oder über das Wirtschaftswunder (Sie heirateten in Gretna Green von Fritz Illing) steht neben einem hinreißenden Actionfilm, der von einem 13-jährigen Amateur stammt (Autojagd von Robert Führer); Komödiantisches, wie einen tollen Kurzfilm von Franz Müller (Leichtmatrosen von 2010), in dem Knepperges eine der peinlich-stolzen Hauptrollen spielt, stellt der Kölner Filmemacher neben Experimentelles (Serge Rippenanker), wie man es selten auf der Leinwand sieht. Selbstironie spielt bei Knepperges eine große Rolle, was es ihm erlaubt, eine Hommage an sich selbst zu inszenieren, die ganz uneitel wirkt (obwohl sie es natürlich nicht ist), weil sie die Mechanismen der Selbstdarstellung mit dickem Pinsel sichtbar macht.
Karaoke ohne Kino
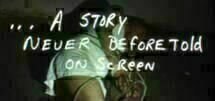
Apropos Selbstdarstellung: Zwar ist Oberhausen wie fast alle größeren Festivals (und hier laufen laut Selbstauskunft mehr als 600 Filme) nur so gut wie die Auswahl, die jeder Zuschauer für sich trifft. Doch die Kurzfilmtage haben Schwerpunkte, ihr Leiter Lars Henrik Gass setzt welche in seinen wie immer sehr hörenswerten Reden (hier die diesjährige Eröffnungsrede zum Nachlesen), und die Lenkung der Aufmerksamkeit erfolgt vor allem durch die wiederkehrenden kuratierten Programme: das Thema, die Profile, das Conditional Cinema. 2019 waren sie nicht meins.
Das Conditional Cinema, das als dreijähriges Projekt angelegt ist, ist mir so sympathisch wie unangenehm. Dazu gehört dieses Jahr ein seltsames Karaoke, bei dem Leute aus dem Publikum vor die Leinwand treten, um große Kinoreden nachzusprechen. Einsame Höhepunkte sind Daniel Kothenschultes Imitation von Werner Herzogs Englisch und Markus Mischkowskis phonetischer Imitation von Aki Kaurismäkis Finnisch. Schade ist vor allem, dass es sich gar nicht um Reden aus Filmen handelt, sondern überwiegend um Reden über Filme, also Manifeste, Analysen, Making-of-Kommentare. Das Ergebnis: Es gibt kein Filmmaterial dazu, bei der wir die Person den Text sprechen sehen. Doch so wie ohne Instrumentalversion der Musik Karaoke kein Karaoke wäre, so bleibt ohne passendes Bild das Film-Reden-Karaoke ziemlich schal.
Tiefpunkte des Sprechens übers Kino

Doch wo es sich hier nur um ein lässliches Experiment handelt, da ist der diesjährige Schwerpunkt auf Trailer leider eine ziemliche Luftnummer. Gerade im Vergleich zu früheren Jahren, in denen die Themen meist sehr vielschichtig und mit aufwändiger Recherche aufbereitet wurden, ist in diesem Jahr gewissermaßen Sparflamme Programm. Vielleicht hätte mich schon die Kurzbeschreibung skeptisch stimmen müssen, denn die Gefahr schneller Ermüdung und Überforderung ist groß bei Programmen mit Film-Trailern, die ja in aller Regel keine drei Minuten dauern. Erst mal ist es aber toll, 35mm-Kopien von alten Vorschauen etwa aus den 1940er und 1950er Jahren zu sehen. Entwicklungen in der Machart zu erinnern und zu entdecken, von der direkten Ansprache des Publikums durch den Produzenten oder den Regisseur über verschiedene Arten von Texttafeln und Voice-overs.
Aber warum zeigen die Kuratoren, beides Konservatoren beim Academy Film Archive, eher so etwas wie ein Best-of ihres Archivs statt einer kuratierten Auswahl, bei der Zusammenhänge und Kontraste sichtbar würden? Auch in ihren Beschreibungen klingt es so, als hätten sie Programme aus dem Hut gezogen, die sie regelmäßig zeigen. Kein Wunder also, dass mit wenigen Ausnahmen die Trailer alle US-amerikanisch sind, auch die von Filmen wie Fellinis 8 ½ (Otto e mezzo, 1963) und Truffauts Sie küßten und sie schlugen ihn (Les Quatre Cents Coups, 1959). Die Podiumsdiskussion, die das Thema flankiert, gesellt sich zu den vielen Tiefpunkten in der Kultur des Sprechens übers Kino, zu der ich bekanntlich auch einige beigetragen habe.
Das Set-up: Links sitzen zwei Wissenschaftler, die Trailer studiert haben und viel erzählen, in der Mitte zwei Filmemacher, die nicht recht zu wissen scheinen, wieso sie da sind, rechts die beiden Kuratoren, die das Ganze laufen lassen. Heraus kommt eine Ansammlung an Anekdoten, einige historische Allgemeinplätze, flankiert von wenigen Analysen. Von dem, was im Titel anklingt, dem Nachdenken über die Funktion von Trailern zwischen Werbung und Kunst und dem „Kino der Verheißungen“, ist natürlich kaum die Rede. Ja, es ist ein Standard des Panelgesprächs, dass es um alles außer um das Angekündigte geht, ganz im Gegenteil zum Trailer.
Erfüllung eines Versprechens
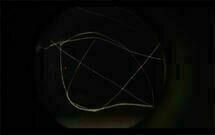
Im Trailer zu diesem Text, wir nennen das da oben in Fettschrift genau genommen Teaser, habe ich ja auch ein Versprechen gemacht – und natürlich gibt es am Schluss, im eingangs erwähnten vorletzten Programm, wie bei jeder guten Party just im Moment des Aufbruchs, einen Moment, da packt mich die Lust am Kurzfilm, das Vergnügen an der Aneinanderreihung so unterschiedlicher Stimmungen und Ansätze, als wäre es das Erste, was ich je in diese Richtung sehe. Ich weiß nicht einmal, ob diese Filme genauso in einem anderen Rahmen funktionieren würden. Jetzt gerade aber sind sie genau das, was ich brauche: Erst 47 Storeys und dann Perfect Cut.
Ersterer schneidet zwei Nacherzählungen und eine Nachsynchronisation ineinander. Der Regisseur steht vor der Kamera, einmal damals, vor vielen Jahren, wie wir an seinem Gesicht vor allem sehen, einmal heute. Ein bisschen mysteriös, was er erzählt, es geht um einen dramatischen Moment, er ist auf einem Hochhaus auf der Terrasse und plant wohl zu springen. Er erzählt das ziemlich detailliert, das Faszinosum ist die Erzählweise, sind Mimik und Gestik, ist, das Jetzt mit dem Damals zu vergleichen und sich nur langsam ausmalen zu können, worauf beides sich bezieht.
Perfect Cut ist einer von vielen kurzen experimentellen Filmen. Vor der Linse (oder direkt in die Linse?) werden Kratzer ins Glas geschnitten. Irgendwie ist das nichts, aber es dauert recht lang. Die über acht Minuten sind eine Erholung, ja wie eine Meditation, natürlich auch eine Anstrengung in der so anderen Einfühlung, oder nennen wir es besser Emphase für das Gezeigte, denn es spricht in so großartig konträrer und dadurch komplementärer Weise meine Wahrnehmung an, dass ich innerlich jubiliere. Was auf nichts anderes zurückzuführen ist als auf die dichte Aufeinanderfolge dieser beiden so unterschiedlichen Ästhetiken und Erzählweisen. Ich fahre versöhnt nach Hause, und der Zug hat nicht mal Verspätung.











Kommentare zu „Kurzfilmtage Oberhausen 2019: Viele Versprechen“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.