Kino der Sünder – Retrospektive Abel Ferrara
In seinen unaufgeräumten Filmen versetzt sich Abel Ferrara in Männer, die an sich und ihren Obsessionen scheitern – und reißt sein Publikum gleich mit in den Abgrund. Ein Rundgang durch das Werk des US-amerikanischen Regisseurs.

Zwei Momente der Erstsichtung von Bad Lieutenant (1992) stecken mir bis heute in den Knochen. Ich war 18 und hielt mich für abgeklärt, erwartete einen coolen Copthriller – es waren die Tarantino-Heydays –, doch nur wenige Minuten dieses Films zeigten mir, wie unschuldig ich noch war. Einmal die ikonische Szene, in der Harvey Keitel als der titelgebende Lieutenant auf Crack nackt vor der Kamera schwankt. Der Ort des Geschehens wird mit zwei nackten Frauen eingeführt und mit Sex konnotiert. Der kink kippt aber schnell, und Keitel vollführt einen statischen Tanz, der in Tränen und Verzweiflung übergeht. Wenn er mit seinen Armen hilflos wie ein Vogel flattert, dann ist ein erster Höhepunkt seiner geistigen und emotionalen Zerrüttung erreicht. Und Bad Lieutenant hat zu dem Zeitpunkt kaum angefangen. Keitels Oberkörper sieht in seiner muskulösen Fleischlichkeit völlig irreal aus, auf den Unterleib wie artifiziell aufgesetzt. Ein Bild, das es ansatzweise vergleichbar schafft, Verletzlichkeit, Monstrosität, Potenz und Kläglichkeit gleichzeitig auszudrücken, habe ich bis heute nicht gesehen.
Der andere Moment ist derjenige, als der Lieutenant ein paar Jugendliche anhält, die den Wagen ihrer Eltern entwendet haben. Alles würden sie tun, wenn er sie nur nicht verhafte und ihren Eltern übergebe, sagen sie schmerzhaft vorschnell. Nach etwas Hin und Her fordert er die eine auf, ihren Arsch zu entblößen, und die andere, ihren Mund zu einem O zu formen, als ob sie ihm einen blasen würde. Er holt sich dazu nachts auf offener Straße im Regen einen runter. Von allen Formen von Machtmissbrauch und Perversion, die ich bis dahin in Literatur, Film und Fernsehen erlebt hatte und die ich mir vorstellen konnte, war das die genügsamste und traurigste. Die Schreie in meinem Kopf, dass dies komplett unrealistisch sei, wurden unterdessen immer flehentlicher.
Bis ans Ende des Kaninchenbaus

Bad Lieutenant erzählt in seinen anderthalb Stunden im Grunde keine Geschichte, sondern reiht Tiefpunkt an Tiefpunkt. Nur nebenher wird ein Weg zu einer Erlösung eingestreut, der Katholizismus und Selbstmord aufs Halsbrecherischste verbindet. Das Kino des Abel Ferrara ist das der Sünder. In Mary (2005), einem etwa ein Jahrzehnt später entstandenen Film, der als zivilere und schluderigere Variation von Bad Lieutenant gesehen werden kann, buchstabiert er es thematisch aus. Jesus ist nicht für die schon Seligen auf die Erde gekommen – die benötigen ihn nicht. Ferrara, erzkatholisch erzogen, erzählt von jenen Verlorenen, für die der Messias kam. Bei dem aus der Bronx stammenden Regisseur heißt das, dass sich seine Filme vor allen der Ausgestoßenen annehmen, derer, die von der Gesellschaft als Lumpen und Abschaum wahrgenommen werden.
Exemplarisch verliert Mary denn auch seine zeitweilige Hauptfigur (gespielt von Forest Whitaker), einen obsessiven, fremdgehenden Fernsehmoderator, der wohl zu Gott und in den Hort seiner Familie zurückgefunden hat, aus den Augen und fokussiert sich auf einen Regisseur (Matthew Modine), der einen Film über Maria Magdalena gedreht hat. Vor der Premiere gibt es Proteste und Bombendrohungen, und er antwortet darauf, indem er in den Vorführraum stürmt, sich einschließt und nahe am Nervenzusammenbruch seinen Film abspielt, egal ob da ein Publikum ist oder das Bombenkommando der Polizei. Das Maß für seine Taten hat er spätestens jetzt verloren.

Abel Ferrara erzählt von Männern, die tatsächlich das Gute tun wollen, aber immer wieder an sich und ihren Obsessionen scheitern. Sie ringen mit und leiden an sich – und die Perspektive, die die Filme konsequent einnehmen, ist die ihre. Die eingangs erwähnten Bilder aus Bad Lieutenant gewinnen ihre Intensität gerade daraus, dass er seinen Sündern bis ans Ende des Kaninchenbaus folgt und dort Verzweiflung, Gewalt und Traumata/Traumatisierendes findet, uns dabei mit in ihre Abgründe reißt. Und zugleich bleiben die klebrigen (Selbst-)Romantisierungen und Selbstfixierungen der Protagonisten bestehen.
In einem der aufwühlendsten Momente seiner Filmografie sehen wir einen von Forrest Whitaker gespielten Militärpsychiater, der von Körperfressern umringt ist und der wie der ganze Film von einer eklatanten Angst vor Konformität befallen ist. In Hysterie scheint er sich aufzulösen, weil er nicht entscheiden kann, ob er die Waffe gegen die Massen oder doch besser gegen sich richten sollte.
Bildgewaltiger Horror des Selbst
Mit Samuel Fuller teilt Abel Ferrara die fehlende Dezenz, aber auch, dass seine ganze Seele in seinen Filmen zu stecken scheint. Doch sind sie unendlich viel unaufgeräumter. Wissen wir nach einem Fuller-Film zumeist, wo der Feind lauert, so ringen Ferraras Filme um Klarheit, scheitern aber daran wie die Protagonisten. Gebrochenheit, Selbsthass und innere, im Laufe der Karriere zunehmend selbstreflexive Widersprüche stehen dieser Klarheit eklatant im Weg, und einfache Antworten tragen schon immer einen Makel in sich.

Dissoziative Momente, in denen die Welt und die Figuren nicht mehr im Einklang miteinander zu bringen sind, sind entsprechend zentral. Mal brechen sie sprunghaft ein, mal bestimmen sie den ganzen Film. Auch wenn er nur selten Horrorfilme im engen Sinne dreht, so sind sie es trotzdem fast alle. Mal ausgelassener, mal selbstzermürbender, aber immer bildgewaltiger Horror des Selbst.
Zwei Brüche machen Ferraras reichhaltige und alles andere als geradlinige Laufbahn aus. Beide vollziehen sich in den 90er Jahren. Einer ist eher inhaltlicher, einer ästhetischer Natur. Als Snake Eyes 1993 auf Bad Lieutenant folgt, verlässt Ferrara die Straße mit ihren Gangstern, Vigilanten und Serienmördern, die in den 1980ern sein Werk bestimmten. Es folgen Filme über Regisseure, Vampire, Politiker und Körperfresser. Der nasse, schmutzige Asphalt weicht universelleren Themen, der Dreck und das Ungesittete bleiben. Aber vor allem setzt die Selbstreflexion im Werk Ferraras ein und verdrängt die Genreregeln, in denen die persönlichen Problematiken bisher aufgelöst wurden.
Wird in Ms. 45 (1981) einer allgegenwärtigen männlichen Übergriffigkeit ein weiblicher Racheengel gegenübergestellt, der Rache an Ferrara – hier selbst in der Rolle eines Vergewaltigers – und seinesgleichen nimmt und so die bösen Geister in den Männern und der Gesellschaft exorzieren möge, dann folgt das noch den klaren Formeln eines Rape-&-Revenge-Films. Was folgt, ist dann aber oft viel offensiver und persönlicher.

Manchmal endet alles in geradezu sadistischer Selbstbezogenheit. In Snake Eyes wird beispielsweise ein Film im Film gedreht. Bezeichnenderweise heißt er The Mother of Mirrors. Der von Harvey Keitel gespielte Regisseur dieses Films fungiert ziemlich offensichtlich als Stand-in für Ferrara. Der Job, die Frisur, der Fakt, dass er seine tatsächliche damalige Frau als die Frau seines filmischen Ablegers besetzt: Es sind diverse Parallelen, die diese These mehr als nahelegen. In einer Sequenz beschimpft er nun seine vor der Kamera stehende Hauptdarstellerin (Madonna), um mehr Gefühl aus ihr herauszuholen. Wenn sie ihm daraufhin die Zeilen seines Drehbuchs entgegenätzt, mit dem er die Heuchelei in seinem eigenen Leben angehen möchte, dann ist bald nicht mehr zu unterscheiden, ob sie diese innerhalb ihrer Rolle ausspricht oder als zunehmend gekränkte und verletzte Darstellerin. Die Grenzen zwischen den Ebenen verschwimmen, und wir sehen dabei einen Regisseur, der mit seinen eigenen Worten aus einem anderen Mund beschimpft wird und dabei für einen Regisseur einsteht, der das alles verantwortet. Wir sehen also in einem Spiegelkabinett, wie jemand sich selbst beschimpft.
Einzug der Gelassenheit
Der andere Bruch ist aber möglicherweise der bedeutendere. The Funeral soll 1996 der letzte Film sein, bei dem Ferrara das Drehbuch seines langjährigen Gefährten Nicholas St. John verfilmt. Das, was folgt, wirkt, als ob Ferrara die letzten Ketten von Handlungsdramaturgie abwirft und den schon vorher latent vorhandenen impressionistischen Stil nun vollends auslebt. Die unmittelbar folgenden The Blackout (1997) und New Rose Hotel (1998), zwei durchaus unterschiedlich gelagerte, aber ähnlich bilderstürmerische Metafilme über Erinnerungen, Bildschirme und Videoaufnahmen, kündigen an, was kommen wird. Und doch sind sie nur Vorboten einer anderen Entwicklung, die durch diesen Impressionismus bedingt ist. Gelassenheit, Versöhnlichkeit und auch mal der Blick auf Probleme außerhalb des Subjekts halten Einzug.
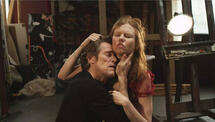
4:44 (2011) beispielsweise ist einer der entspanntesten Weltuntergangsfilme, die denkbar sind. Der dissoziativste Augenblick scheint darin zu liegen, dass die Leute sich im Angesicht der Katastrophe nicht grundlegend ändern. Überraschenderweise ein Film des Alltags. In einem anderen Höhepunkt dieser neuen Ruhe, in Pasolini (2014), ist das Klaustrophobische des Selbst fast ganz verschwunden. Wir sehen einen Tag im Leben eines Mannes, der sich gefunden hat. Sein Tod ist umso sinnloser. Ferraras Filme zuletzt machen vor allem Lust, noch mehr Facetten dieses Getriebenen zu entdecken, der selbst in dieser neuen Ruhe bei seinen Sündern geblieben ist.
Zum Programm der Retrospektive geht es hier











Kommentare zu „Kino der Sünder – Retrospektive Abel Ferrara “
Es gibt bisher noch keine Kommentare.