Jacques Rivette - Wir sind nicht mehr unschuldig
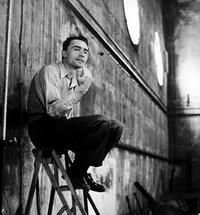
„Nous ne sommes plus innocents“, 1950 in der Zeitschrift Arts erschienen, ist die erste Publikation Jacques Rivettes. Dieser Artikel, dessen Titel wie das Manifest einer Generation klingt, spinnt eine in den Schriften André Bazins und Eric Rohmers häufig wiederkehrende Idee weiter: Das Kino, diese „Sprache“, die es neu zu erfinden gilt, ist in Wirklichkeit gar keine Sprache mit formalen Regeln und Konventionen, sondern vielmehr eine Sprache ohne Gesetz, die permanente Improvisation und künstlerisches Abenteurertum verlangt.
Wir sind nicht mehr unschuldig
Es ist frappierend, heute bestimmte Filme von Stiller, Murnau oder Griffith wiederzusehen; man bemerkt, wie außergewöhnlich wichtig darin die Gesten der Menschen sind, alles, was in jedem empfindsamen Universum sich ereignet: dem einfachen Akt des Trinkens, Gehens, Sterbens eignet darin eine Dichte, eine Fülle von Bedeutungen und die verworrene Evidenz des Zeichens, die immer alle Interpretationen und Beschränkungen transzendiert – die daher im Film aufspüren zu wollen zwecklos wäre; wohl kaum jemand außer Vigo und Renoir suggeriert in gleicher Weise eine unablässige Improvisation des Universums, eine beständige und ruhige und sichere Erschaffung der Welt. Das Schweigen erklärt nichts.
Das Übel begann mit den Epigonen der ‚Pioniere‘, mit der Reflexion über das Wunder; jede Reflexion impliziert eine Analyse – die natürlich mit dem Summarischsten beginnen musste: man machte Synthese-Filme, unerfahren noch und naiv, aus denen alle Kraft gewichen war. Die ungeschickte Systematisierung einer Sprache, einer Syntax, die Griffith ungeordnet sich hat erarbeiten müssen, um sich auszudrücken, die aber nur die äußerliche Konsequenz seines ganz eigenen Universums war, brachte den Wurm in die Frucht, der nicht aufhören sollte, auf immer verborgenere und subtilere Weise, das Kino buchstäblich zu devitalisieren: allmähliche Erschaffung einer Rhetorik, immer feiner und nuancierter, aber auf immer unerbittlichere Weise auch analytisch.
Denn: Jede Entdeckung, ausgehend von einer ‚einzigen Einstellung‘ oder dem ‚Tableau‘ der Primitiven, konnte fast immer nur in Richtung Analyse gehen, genauer: in Richtung Ellipse, räumlicher wie zeitlicher (eine Naheinstellung ist Ellipse des räumlichen Kontextes); im Namen der vortrefflichen Überlegenheit der bloßen Andeutung verlangten die bald systematische Weigerung, anderes zu zeigen als Blut- und Kraftloses, sowie der panische Rückzug vor dem lebendigen Akt, im konkreten Raum, und dessen stiller Unkeuschheit, nach einem fatalen und unerbittlichen Ausdörren des Realen. Der filmische Raum – ‚geschnitten‘, zerstückelt, bald orientierungslos durch die Anhäufung seltener und gegensätzlicher Einstellungswinkel und durch Kamerabewegungen – verliert jede Realität, jede Existenz gar; man gelangt schließlich zu einem puren Kino der Zeit, in dem es nichts gibt als die reine Dauer der Handlungsabfolge [succession d’actes] ohne Dichte oder Realität: Geburt der gefährlichen – und ganz unbegründeten – Begriffe von Rhythmus und Geschwindigkeit, die nur der Versuch sind, Sand in die Augen zu streuen, indem sie Existenz und Präsenz durch Anhäufung ersetzen, in der Hoffnung, aus der fanatischen Multiplizierung flüchtiger Schatten Gewinn zu schlagen.
Ein Kino des rhetorischen Diskurses, wo alles sich den gebräuchlichen und vielseitig verwendbaren Formeln, zu Stereotypen für jeden Zweck erstarrt, beugen muss: das Universum wird eingefangen und zerstört in einem Netz formaler Konventionen.
Diese entsprechen kinematographischen Verstandes-, folglich Seinskonventionen: ein Universum, befallen von Oberflächlichkeit, Irrealität, Atonie, Unwirksamkeit, Bedeutungslosigkeit, das auf Grund der konventionellen Formen, durch die es in Erscheinung tritt, unweigerlich das allergrößte Misstrauen hervorruft; weniger noch als sonst gibt es hier eine Trennung zwischen Form und Inhalt: das Objekt ist ganz in seinem Akt des äußeren Erscheinens; Vorsätzlichkeit und Routine verurteilen es automatisch und unwiderruflich.
Der große Irrtum liegt folglich in einer geläufigen Sprache, gleichgültig gegenüber ihrem Objekt, einer ‚Grammatik‘, die für jede Erzählung gilt, statt eines notwenigen Stils, für eben diese erforderlich, besser noch: von ihr erschaffen im Zuge ihres Sich-Ausdrückens.
Der Realismus kann keine Lösung sein, versteht man darunter nur, in präexistenten, auswechselbaren und unantastbaren Rahmen, den Ersatz konventioneller Zeichen (die letztlich doch ihrer Funktion und ihrem Kontext angepasst sind) – denn andere sind nur von Bedeutung in Bezug auf ein anderes Universum, das keine Gemeinsamkeiten hat mit dem der Leinwand. Sondern allein, wenn realistisch derjenige ist, der sich weigert, seine Vision a priori mit Hilfe der üblichen Schemata und Skalpelle zu analysieren und sezieren, und sie als solche und unvermittelt aufs Filmmaterial transkribiert, im direkten Kontakt der Kamera mit seiner Realität.
Der ‚Inhalt‘ wird in seinem natürlichen Bemühen Ausdruck finden, Form und Sprache; das lebend Organische ist nicht ungestalt (sondern nur, was künstlich animiert ist). Ein Akt des Glaubens drängt sich auf: in die natürliche Gewalt, die Lebenskraft des inneren Universums, das in eine empfindsame Welt geboren werden und naiv sich ausdrücken muss: die Tatsache zum Sein, zur äußeren Erscheinung überzugehen, formuliert das automatisch, wenn keine ‚Reue‘, kein Vorurteil, kein Komplex oder lähmendes Überbleibsel der alten Rhetoriken das Spiel, das Magnetfeld des natürlichen Wunders verfälschen – und wenn keine Furcht, keine Ungeduld oder fehlender Glaube die Hand, die die Kamera führt, erzittern lassen.
Wie siechen dahin an Asphyxie und rhetorischer Intoxikation: wir müssen zurück zu einem Kino der ‚Transkription aufs Filmmaterial‘: einfache écriture; Fixierung eines Universums und seiner konkreten Realitäten, ohne persönliches Eingreifen der todbringenden, ausdörrenden Mechanik hinderlicher Instrumente … Einfach auf dem Film die Ereignisse, die Art zu leben und zu sein, des kleinen individuellen Kosmos festschreiben; kalt-dokumentarisch filmen; das Universum soll von sich aus leben; die Kamera soll nur mehr Zeuge sein, Auge; und Cocteau hat zu Recht den Begriff der Indiskretion eingeführt; am deutlichsten. Man muss sich zum ‚Voyeur‘ machen. Visuelle Trouvaillen kommen pausenlos zum Vorschein, wenn man erst einmal nicht mehr nach ihnen sucht („Du fändest mich nicht, hättest du nach mir gesucht“), durch die sukzessiven Beziehungen der beobachteten Phänomene untereinander, und bezüglich eines Blicks, von dem sie nichts wissen: sie handeln nicht im Hinblick auf diesen, sondern im Naturzustand.
Die Persönlichkeit des Schaffenden äußert sich natürlich in seiner ‚Wahl‘ der Kamerawinkel, in seinem Spiel bezüglich der üblichen Rhetorik – insoweit als das, was er zeigen will, sich von einem anonymen Spektakel unterscheidet und, um ganz in Erscheinung zu treten, einen neuen Blick notwendig macht, neugieriger und frei von Vorurteilen, der allein in vollem Umfang Zeugnis davon abzulegen vermag.
Und das Universum befiehlt diesen Blick, doch der Blick setzt dieses Universum ein und erschafft es zugleich; das Universum des Schaffenden ist nur die Manifestation, das konkrete Erblühen seines Blicks und seiner Art, in Erscheinung zu treten – dieser Blick, der selbst nur Erscheinung des Universums ist.
Daran zu erinnern geziemt sich, am Schluss einer Analyse, deren innere Notwendigkeiten uns zu einer künstlichen Teilung des Realen mögen verleitet haben; dessen Existenz selbst, absurd und widersprüchlich, nicht unmittelbar Objekt zu sein vermag, sondern am Ende der Untersuchung als natürliche Krönung, und ihr Beweis, sich herausstellen muss. – Universum und Blick, beide eine einzige und selbe Realität; die nur existiert durch den Blick, den man von ihr aufnimmt, und dieser wiederum hat nur Sinn in Bezug auf sie; – unteilbare Realität, wo Erscheinung und Erscheinen sich vermischen, wo die Vision die Materie zu erschaffen den Anschein erwecken kann (Kamerafahrten bei Renoir), wie auch die Materie die Vision zu beinhalten; ohne Vergangenheit, ohne Kausalitätsbezug. Eine einzige und selbe Realität mit zwei Gesichtern, vermischt und eins im erschaffenen Werk.
Alles andere ist Spektakel.
Post-scriptum: Gemeinplätze und Binsenweisheiten.
Der Film ist Sprache, gewiss, und grundlegend bedeutend, aber eben aus konkreten Zeichen gemacht, und er lässt sich nicht auf Formeln reduzieren; es scheint unnötig, an die Einzigartigkeit einer Einstellung, einer Aufnahme zu erinnern; Einfangen eines unwiederbringlichen Augenblicks. Darin liegt der Fehler aller literarischen Ansätze: von Grammatiken, Syntaxen, Morphologien, wie gut auch immer sie gemeint sind. Die Systematisierung vernachlässigt a priori immer die Komplexität der wahrnehmbaren Realität, um ihre theoretischen Konstrukte zu errichten; es kann keine gesetzmäßigen Grammatiken und Syntaxen geben, sondern allein empirische Routinen, hastige Verallgemeinerungen in einem solchen Ausdrucksmittel: keine Einstellung lässt sich auf eine Formel zurückführen, die nicht gleich den komplexen Reichtum, alle verworrenen Virtualitäten und noch unentdeckten Möglichkeiten außer acht lässt, die ihre eigentliche Realität und ihre Existenz sind; bestenfalls kann man einige Kraftlinien unterscheiden, die darauf abzielen, die empfindlichen (aber ebenso imponderablen) Teilchen des magnetischen ‚Feldes‘ in gewisse Lagen auszurichten. Nichts ähnelt dabei den Worten, abstrakten und konventionellen Zeichen, die nach festen Regeln organisiert sind; eine Einstellung bleibt immer im Bereich des Zufälligen, des einmaligen Gelingens ohne Zurück; ein Satz lässt sich nach Belieben neu schreiben. Die Konventionen der Syntax und der Rhetorik sind wesensgleich mit dem Wort und teilen dieselbe Art sozialer Konvention, die dem gegenseitigen Verstehen dient; der Kreuzzug Paulhans gegen den literarischen „Terror“ findet in diesen Fakten seine Rechtfertigung. Syntax und Rhetorik kommen jedoch vor im Film, künstlich dem Lebendigen aufgepfropft, das ihnen entgleitet oder das sie paralysieren, einfrieren und töten: kein Paulhan ist denkbar, wo allein der Terror Gesetz ist. – Der natürliche Ausdruck, der in einer künstlichen und konventionellen Sprache darin besteht, sich den Konventionen und Kunstgriffen zu beugen, verlangt in dieser Sprache ohne Gesetz – immer improvisiert, neu geschaffen, immer abenteuerliche Unternehmung – durchgehende Improvisation, die enden wollende Kreation.
Jacques Rivette, „Wir sind nicht mehr unschuldig“, in: Jacques Rivette, Schriften fürs Kino, dt. Übers. Heiner Gassen, Fritz Göttler, CICIM n° 24/25 (1989), S. 8-12
Mit freundlicher Genehmigung von Fritz Göttler und Heiner Gassen

















Kommentare zu „Jacques Rivette - Wir sind nicht mehr unschuldig“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.