IndieLisboa 2019: Undurchlässige Bilder
Das portugiesische Kino blickt im Nationalen Wettbewerb des Festivals IndieLisboa zurück in die Kolonialgeschichte und zum Walfang, während die Gegenwart durch rätselhafte Figuren verkörpert wird.

Während sich die aktuelle Erfindungsgabe des portugiesischen Kinos – die magischen Verwandlungseffekte von Miguel Gomes oder die traumartigen Landschaften von João Pedro Rodrigues – verstreut auf den Festivals in Cannes, Locarno, Rom oder Rotterdam erleben lässt, bietet der nationale Wettbewerb des kleinen Lissabonner Filmfestivals IndieLisboa die Gelegenheit einer verdichteten, vergleichenden Schau der Jahresproduktion dieses Filmlands. Eine Schau, an die man doch befangen herantritt, mit großer Erwartung an die künstlerische Erfindungsgabe dieses Landes. Und freilich wird diese Voreingenommenheit enttäuscht — blendet doch das Gerede von einer Nationalkinematografie aus, dass das Kino eines Landes immer im Plural stattfindet. Und dennoch lassen sich Trends feststellen, die in den Langfilmen des Wettbewerbs als auch in den Kurzfilmen und den Arbeiten der Studierenden von Filmhochschulen auftauchen.
Schockierender Moment

Es sind zumeist opake Erzählungen von rätselhaften, doppeldeutigen Figuren, die die Kamera bei ihrem Tun beobachtet, von deren Motivationen wir indes nichts erfahren. Zu den krassesten dieser Figuren gehört Alva, der Protagonist von Ico Costas gleichnamigen Film. Der Regisseur ist mit seiner Handkamera immer nah an dem etwas verwahrlosten Henrique (Henrique Bonacho) dran, folgt ihm geduldig, wie er bei strömenden Regen seine Schafe in den Stall bringt. Die körnigen 16mm-Bilder, die das satte Grün der Wälder plastisch modellieren, geben ein Gefühl für seine Lebenswelt, die uns zunehmend unheimlich wird. Je mehr wir mit seinem Alltag vertraut werden, umso rätselhafter erscheint uns Henrique. Eine Frau erkundigt sich nach seiner Tochter. Er nimmt ein Gewehr, fährt in die Stadt, positioniert sich vor einem Haus und erschießt ein Ehepaar. Ein schockierender, verwirrender Moment. In der zweiten Hälfte folgen wir ihm bei seiner Flucht in die Berge, aber er bleibt für uns ein Unhold ohne Motivation. Eher nebenbei erfahren wir am Ende einen Grund für die Tat, die dadurch aber nicht gerechtfertigt wird.
Zwischen Screwball und Horror

Ähnlich undurchsichtig sind die Figuren, die Margarida Gil auf einer Yacht in Mar vereint. Eine EU-Funktionärin chartert ein Boot, bandelt mit dem verwegenen Skipper an, ist mit dem Bootsinhaber vertraut, der auf internationalen Gewässern illegal mittelalterliche Kunstwerke handelt. Schließlich stoßen noch eine Fado singende portugiesische Erasmus-Studentin und ein Bootsflüchtling aus Mali hinzu. Mit den sozialen Dynamiken an Bord ruft der Film zugleich verschiedene Genre-Muster ins Gedächtnis, von der Screwball-Komödie bis zum Horrorfilm. So öffnet der Film sich immer wieder für komödiantische Momente. Wie in ihrem Film Adriana, der 2005 als bester portugiesischer Film bei IndieLisboa ausgezeichnet wurde, versteht es Gil. eine Gruppe von Menschen in der Isolation zu zeigen. Doch leider verheddert sie sich in ihrem Versuch, sich mit der Figur des Flüchtlings einer aktuellen gesellschaftlichen Debatte zuzuwenden. Der künstlichen, zuweilen spielerischen Welt von Mar kann sich dieses Thema nur aufsetzen. Als der Flüchtling zur Yacht schwimmt, blicken wir mit seinen Augen auf das Boot, das bisher Spielort war. Es ist, als ob er aus einer anderen Welt Hilfe in der Fiktion Gils sucht. Als Maria de Meidores durch ein Flüchtlingslager läuft, hat man das Gefühl, sie habe sich versehentlich im falschen Film verirrt. Ein harter Schnitt bringt sie dann zurück in ihre Welt.
Costas und Gils visuelle Strategien erscheinen einander entgegengesetzt. Wo der eine einen realistischen, unmittelbaren Eindruck der Lebenswelt seines Protagonisten sucht, wählt die andere die Künstlichkeit, das Bühnen- und Typenhafte. Doch beiden bleiben die Figuren unerklärlich. Tiago Hespanha verbindet in seinem Essayfilm Campo, für den er den Preis für die beste Regie erhalten hat, gleichsam beide Tendenzen. Das titelgebende Feld ist das Übungsfeld der portugiesischen Luftwaffe Campo de Tiro de Alcochete, das größte seiner Art in Europa. Behutsam spürt Campo die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Felds auf, nicht nur Militärs, sondern auch Anwohner, ein Ornithologe und verschiedene Tiere. Was auf den ersten Blick allein durch seine schiere Größe zu interessieren vermag, offenbart langsam eine ungeahnte Komplexität. Hespanha verschmilzt seine Bilder von gelangweilten Soldaten, konzentrierten Vogelbeobachtern und vom Jungen, dessen Fantasie von den donnernden Kampfjets beflügelt wird, mit einem quasi mystischen Rahmen, in dem Fragen nach Ursprung und Ende der Menschheit gestellt werden.
Portugiesisches Gegenstück zu Thomas Heise

Zwei andere rätselhafte Figuren tauchen in den neuesten Arbeiten Catarina Ruivos sowie des Regie-Duos Catarina Wallenstein und Felipe Bragança auf. Während Wallenstein und Bragança sich bei ihrer recht unentschiedenen Exploration der unbekannten Seiten der Schauspielerin Carmen Miranda, Tragam-me a cabeça de Carmen M. (Bring Me the Head of Carmen M.), zwischen einer erwartbaren Verehrung der Kitschikone und geschmäcklerischen Gesten queerer Pseudo-Radikalität verlieren, schafft Ruivo mit A minha avó Trelotótó (My Grandmother Trelotótó), der als bester portugiesischer Spielfilm ausgezeichnet wurde, ein essayistisches Erinnerungsmonument, das als portugiesisches Gegenstück zu Thomas Heises Heimat ist ein Raum aus Zeit gelten kann. Ruivos Großmutter ist zunächst die offenkundig Abwesende. Die Haushälterin öffnet den Vorhang, bringt das Frühstück und redet ihrer Herrin gut zu. Doch das Bett ist leer. In alten Videoaufnahmen tritt sie uns allmählich entgegen. Als Apothekerin beobachtet sie aufmerksam, wie ihr Mitarbeiter Medikamente einsortiert. Sie erklärt den Familienstammbaum, spaziert am Strand…
All diese privaten Erinnerungen entfalten in drei Stunden Laufzeit allmählich ihre gesellschaftshistorische Dimension. Nicht nur war die Großmutter eine selbstständige Frau, sie verweigerte sich auch einer katholischen Hochzeitszeremonie und zog in den 1940er Jahren in die damaligen portugiesischen Kolonien, erst nach Angola, dann nach Mosambik. Ruivo sucht diese Ort auf, vergleicht die Briefe ihrer Großmutter mit jener Realität, die sich über 60 Jahre später dort vorfindet. Ein Apotheker verteilt Medikamente — ist es die gleiche Apotheke, in der bereits Ruivos Großmutter arbeitete? Die privaten Aufnahmen aus dieser Zeit zeigen schwarze Hausangestellte, in ihren Briefen berichtet die Großmutter von Grausamkeiten der Kolonialbehörden. Die Idylle der Bilder wird mit dem Abstand der Jahre brüchiger, aber Ruivo wagt es nicht, hinter die falsche Harmonie zu blicken.
Fragen ans Archiv
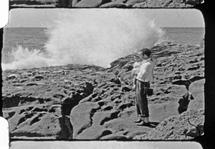
Der vorsichtige, nicht beurteilende Blick auf die Vergangenheit des eigenen Landes bleibt eines der bestimmenden Themen des portugiesischen Kinos. Er ist vergleichbar mit der abwartenden, nicht vollkommen durchlässigen Einstellung auf rätselhafte Charaktere, die nicht erklärt werden sollen. Auch verschiedene Kurzfilme klopfen Bewegtbilder aus dem Archiv nach ihrem doppelten Boden ab. Nahezu programmatisch entlarvt Catarina Mourão in O mar enrola na areia (The Hissing of Summer Sands) das Bild einer glücklichen Kindheit in den 1950er Jahren. Jener ältere Herr, aufgenommen in wackeligen Super8-Einstellungen, der die Kinder mit seinem Flötenspiel unterhielt, missbrauchte sie offenkundig auch.

Und auch die Bilder vom einst für die Azoren wirtschaftlich wichtigen Walfang gewinnen in Paulo Limas Memória e Dicionário eine Funktion, die über sie hinausgeht. Melancholisch erinnern sich die ehemaligen Walfänger an ihre aufregenden Abenteuer, an die Ansammlung Schaulustiger im Hafen, der heute leer und ungenutzt ist, demonstrieren die Arbeit auf einem Fangboot, das heute nur noch zu Dekorationszwecken in einer Mall steht. In atemberaubenden Einstellungen des Meeres verbinden sich Vergangenheit und Gegenwart zu einem Kontrast zwischen alter Größer und gegenwärtiger Bescheidenheit, in dem durchaus ein Bild von Portugal liegt. Ob die Bilder aus den intimen Familienarchiven weiterhin vorsichtig befragt werden, bleibt ungewiss. In seinem in der Sektion „Novissimós“ präsentierten Kurzfilm O despiste (The Skid) bohrt Francisco Noronha bei seinem Großvater nach, als sie sich gemeinsam die Aufnahmen von Dorffesten aus der Zeit des Estado Novo ansehen. Dass er es sich nicht vorstellen könne, wie die Atmosphäre unter der Diktatur Salazars gewesen sei, akzeptiert der junge Filmemacher nicht als Schluss einer Debatte. Die Bilder des Familienarchivs sollen für seine Fragen durchlässig werden.







Kommentare zu „IndieLisboa 2019: Undurchlässige Bilder“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.