In neuem Licht: Forum Special 2022
Das Musical West Indies von 1979 ist nicht nur eine farbenfrohe Analyse kolonialer Beziehungen, sondern stellt auch einen angemessenen Rahmen für die Reihe Fiktionsbescheinigung dar, die weiterhin den Finger in eine Wunde namens Deutschland legt.

Bewegungen durch die Geschichte und die Resilienz der Herrschaft: Med Hondos Musical West Indies von 1979, dessen Restauration im Rahmen des diesjährigen Forum Special gezeigt wird, ist einerseits eine komplexe, anspielungsreiche Interpretation der Geschichte der französischen Antillen, basierend auf dem Theaterstück Les négriers von Daniel Boukman. Andererseits bricht der Film diese Geschichte herunter auf ein Nebeneinander von Veränderung und Kontinuität, von Bewegung und Stillstand.
Doppelte Hysterie

Hondo verquickt zwei historische Migrationen miteinander: die Verschleppung versklavter Menschen aus Afrika auf die karibischen Inseln einerseits und die durch die französische Migrationsbehörde aufgrund von Arbeitskräftemangel angefachte Wanderungsbewegung von den Inseln in die Metropole andererseits. Bewegungen über ganze Ozeane, zwischen denen ganze Jahrhunderte liegen, aber das Setting bleibt dasselbe: ein Sklavenschiff als Musical-Bühne, inmitten einer Fabrik; dieses Schiff ist zugleich blutgetränktes Artefakt der Sklavereigeschichte und mit seinen unterschiedlichen Ebenen Metapher für eine über diverse Zuschreibungen hierarchisierte Gesellschaft. Die Kontinuität wird auch durch das Personal gewährleistet, das stets in mehreren Rollen zu sehen ist.
Das Musical erweist sich als durchaus passende Form für die politische und geschichtsphilosophische Intervention von West Indies, vor allem wenn es in aufwändigen Choreografien eben keine individuellen, sondern kollektive Dramen zum Ausdruckstanz bringt. Wie meist bei Hondo sind Bilder und Körper von einer doppelten Hysterie durchzogen: die Hysterie die Macht in der Darstellung einiger klarer Typen – dem Priester, der Sozialarbeiterin, dem Souverän, dem Lokalpolitiker – und die rechtmäßig hysterische Wut der Unterdrückten, die unter dem Film selbst brodelt. Die doppelte Hysterie bewahrt die Analyse vor fatalistischen Abkürzungen und der Darstellung einer bloßen Wiederkehr des Gleichen, die tanzenden Körper sind auch Widerstand, in der Revolte gegen die Sklaverei ebenso wie in einem noch kommenden Aufstand, der in der zwischen Resignation und Trotz changierenden Schluss-Choreografie aufscheint.
Archivieren, Kuratieren
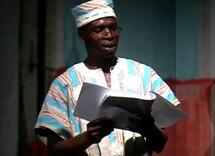
Gerade in einem Film, in dem viel gesungen und getanzt wird, geht es also nicht um Kultur. Rassismus ist bei Hondo niemals Frage individueller Vorurteile oder ethnischer Identitäten, sondern erst einmal eine von Macht und Herrschaft – und die können ziemlich divers aussehen, wie ein Blick in die Riege der Inselelite zeigt. Mit dieser Lust an der parteiischen, alles andere als nüchternen historisch-politischen Analyse bildet West Indies auch ein schönes Leitmotiv für die Fortsetzung der Reihe Fiktionsbescheinigung, die ebenfalls im Rahmen des Forum Special stattfindet und sich erneut anschickt, Blicke auf Deutschland aus dem Archiv zu fischen, die nicht aus dem stabilen Zentrum der weißen Mehrheitsgesellschaft gemacht sind.
Hinter dieser Fortsetzung, dieses Mal hauptsächlich kuratiert von Enoka Ayemba und Biene Pilavci, steht ein Gedanke, der jüngst von Forums-Leiterin Cristina Nord während der Programmvorstellung nochmals betont wurde: Fiktionsbescheinigung soll mehr sein als eine einmalige Sonderreihe, die ein „Thema“ be- und damit abhandelt, aber die Strukturen, die es überhaupt erst nötig machten, die hier gezeigten Filme erstmal mühevoll zu suchen, letztlich unverändert lässt. Im besten Fall also, so stelle ich mir das vor, gibt’s hier ein Wechselspiel zwischen der archivarischen und der kuratorischen Arbeit: Die durch die Archivarbeit vermittelte regelmäßige Bestandsaufnahme vergangener Ein- und Ausschlusskriterien (für Festivals, Verleihprogramme, Förderungen und filmkritischen Kanon) schärft den Blick für aktuelle, wohlmöglich für selbstverständlich gehaltene Programmatiken. Und die alten, neu entdeckten Filme ergänzen den etablierten Kanon nicht, sondern lassen ihn in einem neuem Licht erscheinen.
Lebenskünstler aus Rassismus

Auch den elf Kurz- und Langfilmen selbst geht es weniger um eine kulturelle Erweiterung Deutschlands als um eine kritische Befragung deutscher Geschichte und Gegenwart. Das beginnt zum Beispiel bei Ricardo Bacallaos The Maji-Maji-Readings (2006) über eine Theateraufführung, die sich mit dem Aufstand gegen die deutsche Kolonialherrschaft im damaligen Deutsch-Ostafrika zwischen 1905 und 1907 beschäftigt, in dessen Zuge die lokale Bevölkerung um ein Drittel dezimiert wurde. Und das endet zum Beispiel bei 77sqm_9:26min, der durch das Kollektiv Forensic Architecture unternommenen und filmisch aufbereiteten Rekonstruktion des NSU-Mords an Halit Yozgat, die nicht nur an den Aussagen eines mittlerweile berüchtigten hessischen Verfassungsschützers erhebliche Zweifel aufkommen lässt, sondern auch an der Arbeit der Ermittlungsbehörden insgesamt.
Eine wirklich ganz wunderbare Entdeckung ist Rafael Fuster Pardos DFFB-Abschlussfilm In der Wüste (1987), in dem sich ein chilenisch- und ein türkischstämmiger Künstler, beides Kinder der ersten Gastarbeitergeneration, durch ein karges und abweisendes Kreuzberg schlagen. Mithilfe einer Blutspende kommen sie zu etwas Geld, mithilfe dieses Gelds zwar nicht in die türpolitisch rassistische Disko, aber immerhin zu einem Konzert von Jocelyn B. Smith, von dem der Film so überwältigt wird, dass er irgendwann völlig vergisst, dass er doch eigentlich was erzählen wollte. Das zugleich gebrochene und eigentümlich gestelzte Deutsch, das die Figuren sprechen, ist hier nicht Leitkultur, sondern notdürftige Vermittlungsinstanz zweier Menschen, die Lebenskünstler nicht nur wegen geringer finanzieller Mittel sind, sondern auch weil das Land, in dem sie leben, sie nicht mitspielen lassen will.
Lieber nicht zu viel erinnern

Pardo kam mit zehn Jahren nach Deutschland, studierte schließlich an der DFFB, wo in den 1980er Jahren auch niemand Geringeres als Raoul Peck gelandet war. Aus dieser Phase des Schaffens des haitianischen Regisseurs, dessen Kolonialismus-Dokuserie Rottet die Bestien aus! derzeit auf Arte zur sehen ist, zeigt das Forum den 18-minütigen Merry Christmas Deutschland oder Vorlesung zur Geschichtstheorie II (1985), einen Essayfilm, in dem Peck einen ganz eigenen Blick auf Deutschland wirft. Zwei Filme von Hito Steyerl mit ähnlichem Anliegen – Normalität 1 – 10 (2001) und Die leere Mitte (1998) – ergänzen das Programm ebenso wie Thomas Arslans Abschluss seiner Berlin-Trilogie Der schöne Tag (2001).
Ein weiteres Highlight ist Serpil Turhans Dilim dönmüyor – Meine Zunge dreht sich nicht, in der die Regisseurin ihre Familie zu Vergangenheit und Gegenwart befragt und auch ins osttürkische Heimatdorf reist, wo noch die Großeltern leben, wo ihre Mutter seit der Migration aber nicht mehr war. Nicht nur die Inhalte des Erzählten interessieren hier, auch das, was verschwiegen zu werden scheint, und auch die Form, in der es erzählt wird. Die Eltern reden kaum noch Kurdisch und können selbst nicht so richtig erklären, warum. Die Zunge dreht sich eben irgendwie nicht.
Vergessen, verlernen, lieber nicht zu viel erinnern: Damit tritt der Film auch in Dialog zu einem weiteren Film des Forum Specials, der jenseits der Fiktionsbescheinigung als Weltpremiere einer kürzlich restaurierten Fassung läuft: Beirut The Encounter (1981) von Borhane Alaouié, in dem sich ein Mann und eine Frau, vom Bürgerkrieg getrennt, im Beirut der späten 1970er Jahre ein letztes Mal begegnen, bevor die Frau in die USA auswandert, allerdings nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern nur vermittels zweier Kassettenrekorder, mit denen sie sich gegenseitig zwei Tonbänder besprechen. Am Ende des Films findet sich eines der Tonbänder zerstört, aus der Kassette gefriemelt und aus einem Taxi auf den Beiruter Asphalt geworfen. Ein Schicksal, das zumindest die im Forum Special gezeigten Filme bislang zum Glück noch nicht ereilt hat.








Kommentare zu „In neuem Licht: Forum Special 2022“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.