In einem Duisburg vor unserer Zeit – Duisburger Filmwoche 2020
Die legendäre Dokumentarfilmwoche galt als Augen- und Ohrenöffner, wie Filme geschaut und besprochen werden können. Dieses Jahr wird sie digital ausgerichtet und feiert die Inszenierung von Nähe. Ist das möglich, wenn Körper nicht mehr im Kino zusammenkommen?

Es scheint wie ein Kommentar auf das Festival selbst, als der Programmauftakt der 44. Duisburger Filmwoche sich aufgrund technischer Störungen verschiebt. Anderthalb Stunden nach der angegebenen Zeit ist Aufzeichnungen aus der Unterwelt von Tizza Covi und Rainer Frimmel online abrufbar. Derweil habe ich in der Annahme, die Verspätung liege bei mir, diverse Browser durchprobiert und aktualisiert, damit sich endlich doch ein Festivalprogramm und sein Personal auf dem Screen meines Laptops versammeln kann. „Ein Großteil der Filme, die in Duisburg gezeigt werden, ist für die große Leinwand konzipiert, gedreht und montiert. Diesen ästhetischen und rezeptiven Anspruch gilt es für uns als Festival bei allen erwartbaren Einschränkungen einzulösen“, hatte das Leitungsteam um Gudrun Sommer und Christian Koch noch im Juli erklärt, ein Satellitenprogramm eingerichtet, mit dem sechs weitere Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz neben dem Duisburger Standort bespielt werden sollten. Nun bleiben die Projektionen auf den Leinwänden aus, sind die Lichtspielhäuser pandemiebedingt wieder geschlossen. Und die oldschool daherkommende Duisburger Filmwoche musste vollständig ins Netz umziehen, einen Umgang damit erproben.
Zu spät, aber noch rechtzeitig. Bevor ich am ersten Festivaltag enttäuscht schlafen gehen will, versuche ich es noch einmal an meinem Laptop, und es klappt. Aufzeichnungen aus der Unterwelt ist ein auf 16 mm gedrehter Abgesang auf eine vergangene Epoche, von der ihre Relikte Kurt Girk (der „Frank Sinatra aus Ottakring“) und Alois Schmutzer (der „Stoßkönig“) vor der Kamera erzählen: von Glücksspielen, Verrat, Freundschaft, fragwürdigen Methoden der österreichischen Polizei, von Bandenkämpfen der 1960er Jahre, an denen die dandyhaften Ganoven Girk und Schmutzer beteiligt waren. Sie räsonieren in bestem Wiener Schmäh, holen weit aus wie der Film selbst. Covi und Frimmel nehmen die beiden Männer in ihrer Zeitzeugenschaft ernst, lassen sie über (Nach-)Kriegserfahrungen und eine von Gewalt geprägte Kindheit sprechen. Dabei sind die Erzähler Girk und Schmutzer mal mehr, mal weniger verlässlich, weshalb ihre Berichte um weitere Perspektiven wie die von Schmutzers Schwester Heli oder Zuständigen der Kriminalpolizei ergänzt werden.
Faszination am Sprechen und Zuhören
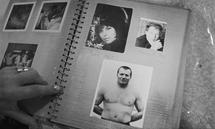
Lippen, Zähne, Augen, die Falten neben ihnen beim Lachen. Hände, nein, Pranken sind es, die hier Zigaretten halten und gestikulieren. Aufzeichnungen aus der Unterwelt ist Zeitdokument wie ethnografische Studie, ein Film, in dem sich Sprachhandeln beobachten lässt. Die Faszination am Sprechen und Zuhören wiederum teilt sich der Eröffnungsfilm mit dem Festival selbst. Sie ist das, wovon Besuchende früherer Ausgaben erzählen: Duisburg als Augen- und Ohrenöffner dafür, wie Filme geschaut werden können und sich über sie verständigt werden kann. Denn das in den 1970er Jahren gegründete westdeutsche Pendant zum DOK Leipzig will kein Premieren-, sondern ein Besprechungsfestival sein. Der Diskussion zwischen Publikum und Filmemachenden wird dabei stets fast mehr Raum eingeräumt als den gezeigten dokumentarischen Formen selbst. Die Duisburger Woche will Kommunikationsangebot sein, ein analoger Ort für Begegnung und kritischen Austausch, für leidenschaftliches Streiten – wobei gefragt werden muss, ob das, erstens, in den letzten Jahren überhaupt noch so dort passiert ist und, zweitens, inwiefern es möglich ist, wenn Körper nicht mehr in einem Raum, der Kino heißt, zusammenkommen.
Es lässt sich in diesem Jahr nicht mitsprechen, aber mitlesen. Highlight der Festivalausgabe 2020 ist ein Relaunch der protokult.de-Website, auf der sich alle Protokolle der in Duisburg geführten Filmgespräche seit 1978 inklusive Schlagwort-Suchfunktion finden lassen. Das Archiv, in dem es auch Beiträge zum aktuellen Programm gibt, lässt eine Duisburger Tradition mitlaufen. Derweil sind die obligatorischen Gespräche mit den Regisseur*innen der Beiträge vorab aufgezeichnet, geführt von Mitgliedern der Auswahlkommission. Die Qualität der Dialoge variiert frappierend mit der Moderation wie mit der Fähigkeit der Interviewten, ihre Filme, Arbeitsprozesse und ästhetischen Entscheidungen zu reflektieren (was bei der Ausbildung an Filmhochschulen nicht unbedingt gelernt wird, wie sich zeigt). Flankiert wird das diskursive Angebot durch Essays, Podcasts und die Protokolle, die die Beiträge in einen größeren Diskurs um Fragestellungen des Dokumentarischen einordnen. Bemerkenswert ist außerdem, dass die ausgewählten Filme nicht permanent verfügbar sind, sondern zu bestimmten Zeitpunkten für 72 Stunden freigeschaltet werden. Es gibt also eine Art Reihenfolge, die zur Sichtung empfohlen wird, und eine Zeitstruktur, um die Konstruktion Kino im Home Office aufrechtzuerhalten.
Wohnhaft Erdgeschoss von Jan Soldat ist vielleicht das, was sich als Aufregerfilm der diesjährigen Ausgabe beschreiben ließe. Zumindest bietet die Online-Plattform des Festivals stark divergente Sichtweisen auf Soldats Film an. Während Matthias Dell über den Begriff des Bloßstellens nachdenkt, der den Umgang von Wohnhaft Erdgeschoss mit seinem Protagonisten Heiko gar nicht treffend beschreibe, notiert Rembert Hüser: „Seidl-Filme sind gegen das hier Micky Mouse.“ Kommissionsmitglied Alejandro Bachmann spricht im aufgezeichneten Gespräch mit dem Regisseur über Widerstände, die der Film produziere und die für Bachmann häufig Teil der Sichtung von Soldats Filmen seien, „von Unwohlsein bis zu einer starken Abwehrhaltung“. Die Website präsentiert diese Positionen in einem Nebeneinander, sie finden nicht zusammen. Hier lässt sich am deutlichsten merken, dass der Filmwoche ein Kinosaal fehlt, in einem Duisburg vor unserer Zeit, wo sich Menschen mit unterschiedlichen Meinungen begegnen, diskutieren, erklären oder wahlweise auch mal anschreien können.
„Ich wollte dieses Pissen sehen“

Ein Bett mit einer Mulde, ein nackter Mann daneben. Seinen Penis hält er demonstrativ in der Hand. Der Mann sieht zur Kamera, fragt: „Kann ich?“. Dann pinkelt er auf das Bett, in die Mulde, stöhnt vor Erleichterung und Befriedigung. Heiko, 51, Jahre alt, war Blechumformer in der DDR. Jetzt ist er arbeitslos und wohnt mit seinem Hund Rex in einer kleinen, engen Wohnung in Berlin. Wie schon das Personal seiner früheren Filme hat Regisseur Soldat Heiko über ein Online-Datingportal kennengelernt. In seinen Kurz- und Langfilmen erkundet er sexuelle Neigungen, die häufig als „nicht normal“ oder „abseitig“ beschrieben werden, und versucht darüber nachzudenken, welche Bedürfnisse in der Gesellschaft Raum haben, welche überhaupt sichtbar sind. Seine Filme arbeiten sich an dieser Fragestellung ab und versuchen sich an der Herstellung von Repräsentationen für das, was sonst im Versteckten liegt. Die Einblendung „Jan Soldat zeigt“ stellt er seinen Aufnahmen voran, auch Wohnhaft Erdgeschoss beginnt mit ihr. Danach wird direkt losgepinkelt. „Ich wollte dieses Pissen sehen“, benennt Soldat im Gespräch mit Bachmann als Motivation für den Film.
Dass die Rohheit des offensiven Pinkelns, das sich durch den Film und Heikos Alltag zieht, Zuschauende womöglich irritiert, ist auch dem Protagonisten klar. „Normalerweise, im Grunde genommen, ist das ’ne Sauerei, ’ne Ferkelei, weiß der Geier“, beschreibt Heiko in einer der vielen Interviewsequenzen in Wohnhaft Erdgeschoss, wo er nackt und rauchend auf seinem Schreibtischstuhl gegenüber von Kamera und Regisseur Soldat sitzt. Aber er ergänzt: „Ich bin ich, und ich mach einfach das, was mir gefällt.“ Der Geruch von Heikos Wohnung als Schauplatz für den ultimativen Lustgewinn im Pissen vermittelt sich über die Bilder im 4:3-Format. Und dennoch schafft Soldat in der Nüchternheit, mit der er Heiko Fragen stellt, und dem darunter liegenden offenen, vielleicht naiven und tatsächlich nicht verurteilenden Interesse für diesen Mann und die prekären Verhältnisse, in denen er lebt, ein sanftes Porträt, das der Seidel’schen Gefahr des Ausstellens entgeht. Wohnhaft Erdgeschoss ist Dokument eines Austauschs auf Augenhöhe, wo ein selbstbewusster, bisexueller Protagonist die Bildproduktion mitbestimmt.
Dennoch geht es in Wohnhaft Erdgeschoss nicht nur um Heikos Neigung, auf sein Bett oder den Teppich zu machen. Soldat verbindet sie mit dessen DDR-Biografie, einer Erzählung von Einsamkeit, der schwierigen Familiengeschichte. Einmal fahren sie zusammen in das Heimatdorf in Sachsen-Anhalt, aus dem Heiko kommt, schauen sich die zerfallene Disko an, die Heiko noch als Kino kennt, das Haus der toten Großeltern, vor dem er bitterlich zu weinen anfängt. Auch seine Mutter sieht er nach langer Zeit wieder, sie regt sich darüber auf, dass er sich einen Bart hat wachsen lassen. Fast hätte sie ihn doch deswegen nicht erkannt. „Du hast eine bessere Kamera. Ich hab bloß ’nen Camcorder“, meint Heiko fast neidisch zu Soldat auf ihrem Trip, wo beide Männer parallel filmen. Die Familienzusammenführung kriegt nur wenig screentime in Wohnhaft Erdgeschoss, und das ist gut so. Denn sie ist ein massiver Eingriff von Regisseur Soldat in die Welt, die er filmt, bezahlt er Heiko doch das Zugticket, das er sich sonst nicht hätte leisten können. An diesem gestalterischen Moment, dieser krassen Grenzüberschreitung, hängt sich eine kritische Diskussion des Films auf dieser Duisburger Filmwoche dann aber erstaunlich wenig auf.
Eine Feier der Flüchtigkeit

Den Preis der Duisburger Filmwoche gewinnt schließlich ein Film, der sich der Frage nach Bedürfnissen aus Wohnhaft Erdgeschoss auf poetische Weise annimmt. Patric Chihas If It Were Love begleitet die Proben der Choreografin Gisèle Vienne zu ihrem Tanzstück Crowd, in dem es um die Inszenierung einer Party geht. In Zeitlupe bewegen sich die Tänzer*innen zum Beat, kommen sich nah und sind sich doch fern, stampfen auf die Erde, die die Bühne bedeckt, tappen durch den Nebel. Die Aufnahmen der Proben setzt Chiha mit Gesprächssituationen backstage in Beziehung. If It Were Love lebt davon, dass zunehmend unklar wird, aus welchen Positionen die Tänzer*innen sprechen und wann eine Fiktion beginnt; eigene Sichtweisen und vorgegebene Biografien der Rollen aus dem Stück verschmelzen. Der Dancefloor wird zum queeren, utopischen Ort, an dem kollektiv Zuneigung verhandelt wird. Chihas Film ist eine Feier der Flüchtigkeit, von Körpern in Bewegung, von Nähe und ihrer zerstörerischen Kraft. Es ist eine Auszeichnung, die gut zu einem Festival passt, das genau das alles gerade schmerzlich vermisst, und sich an dem abmüht, was es ganz vielleicht selbst einmal war.












Kommentare zu „In einem Duisburg vor unserer Zeit – Duisburger Filmwoche 2020“
wesWalldorff aka michaelBischoff
meine Güte, Frau Küper, wie wäre es mit Genauigkeit? Also wirklich...
Einen ''Preis der Duisburger Filmwoche'' gibt es nicht - es gibt zwei Haupt- u. diverse Nebenpreise! Der oben von Ihnen erwähnte Film ''If It Were Love'' hat einen der beiden Hauptpreise (nämlich den von Arte verliehenen) erhalten. Der andere (von 3Sat verliehene Hauptpreis ging an ''Kunst kommt aus dem Schnabel wie er gewachsen ist'' von Sabine Herpich.
Nix für Ungut...
werner herzog
"(was bei der Ausbildung an Filmhochschulen nicht unbedingt gelernt wird, wie sich zeigt)" ?