Frühes Gespür fürs Bewahrenswerte – Cinephilie und „Filmerbe“
Was Kulturpolitiker vom Hofbauerkongress lernen können und wie ein Schreibkombinat das Spiel mit Gegenkinotraditionen in den Tatort schmuggelt: Ein Gespräch zwischen Lukas Foerster und Matthias Dell.
Lukas Foerster: In den fürs Kracauergeld verfassten Essays habe ich mich vor allem mit Elementen der zeitgenössischen Filmkultur beschäftigt, die eher peripheren, manchmal gar klandestinen bis illegalen oder auch Verfallscharakter haben. Wobei ich gleichzeitig einige dieser Phänomene – besonders die Hofbauerkongresse und ihr Umfeld sowie die Internettauschbörsen – für die lebendigsten und auch am meisten Hoffnung stiftenden Ausprägungen von Cinephilie halte, die zur Zeit zu haben sind.
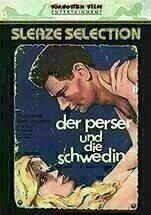
Dein Thema, „Sicherung des Filmerbes“, verweist nun aber auf einen Bereich, bei dem es mit amateurischem Enthusiasmus nicht getan ist. Dank dem im Umfeld des Nürnberger KommKinos entstandenen DVD-Label Forgotten Films Entertainment werden zwar inzwischen einige der zentralen Kongressentdeckungen digital gesichert und distribuiert; die Schließung der Kopierstraße im Bundesarchiv-Filmarchiv kann dadurch aber selbstverständlich nicht wettgemacht werden.
Wie siehst du den Stand der Dinge in diesem Bereich? Gibt es eine Möglichkeit, dass die Energien, die der Hofbauerkongress und ähnliche Veranstaltungen (samt zugehöriger Diskurssphäre) mobilisieren, auch auf institutionelle Strukturen zurückwirken? Oder sind das nach wie vor zwei getrennte Welten?
Matthias Dell: Es sind eher zwei Seiten einer Medaille. Dass es so was wie den Hofbauerkongress gibt plus die dazugehörigen Satelliten-Veranstaltungen, dass die Filmclubs als Orte von Arbeit an der Filmgeschichte plötzlich wieder von Interesse sind – das hat in meiner Wahrnehmung zu tun mit dem Einbruch des Digitalen in die Filmkultur. Im Moment des Verschwindens des analogen Materials wird sich heftig eben darauf besonnen. Alexander Horwath, der lange das Wiener Filmmuseum geleitet hat und meines Wissens nach noch nie auf einem Hofbauerkongress war, hat das einmal schön gesagt: dass die Analogaffinität des Hofbauerkongresses sich einem ästhetischen Hipstertum verdankt, Leuten mit frühem Gespür dafür, was bewahrenswert ist. Und er hat die Hofbauerleute in einer Linie mit Henri Langlois gedacht, dem Gründer der Pariser Cinémathèque, dessen Sammlung auch „superdubios“ zustande gekommen sei und sich eben nicht an so einer Idee von Kanon orientiert habe, wie das die offiziellen deutschen Stellen in der Filmerbediskussion mit ihren Top-500-Listen tun.

Wo sich Hofbauerkongress und Bundesarchiv dann wieder ähnlich sind: im Pragmatismus des Digitalisierens. Forgotten Film Entertainment engagiert sich ja nicht für neue Kopien, sondern macht schön ausgestattete DVD-Boxen. Das meine ich gar nicht kritisch, das entspricht ja auch den heutigen Rezeptionsbedingungen. Und das Bundesarchiv argumentiert, nicht zu Unrecht, dass die Politik, damit: die Gesellschaft eben mehr Geld aufbringen müsste, wenn es ihr an der Überlieferung des Filmerbes liegt. Beide arbeiten mit Provisorien und wissen darum, wenn man es streng denkt.
LF: Aber eine Bruchstelle, die bleibt, ist doch die Frage des Repräsentationellen. Ich möchte gar nicht zu lange auf dem mir immer noch unangenehmen Begriff „Filmerbe“ und dessen fast stets mindestens mitgedachten Attribut „nationalen“ herumreiten, aber es ist doch kaum zu übersehen, dass die teils schon angelaufenen, teils nur beschworenen Digitalisierungs-, Umkopierungs- und sonstigen Initiativen fast immer nicht nur eine enttäuschende kanonische und eben auch nationalkinematographische Schlagseite haben, sondern auch in anderer Hinsicht hinter den Stand der Diskussion in den Fachdisziplinen zurückfallen, zumindest in der begleitenden Rhetorik.
Mich irritiert beispielsweise, dass als das Ideal filmarchivarischer Arbeit nicht die Sicherung oder Konservierung, sondern die Restaurierung angesehen zu werden scheint. Dahinter steht meiner Meinung nach das Phantasma von Filmgeschichte als einem Reservoir an allzeit problemlos zugänglichen Bildern, die in dieser phantasmatischen Zurichtung ihrer Materialität und Geschichtlichkeit beraubt werden. Oder vielmehr: Materialität und Geschichtlichkeit sind höchstens noch Datenpunkte, auf die sich künftige Forscher*innen beziehen können, aber nichts mehr, was sinnlich erfahrbar wäre.

Erst recht geht dabei die Erkenntnis verloren, dass Archivgeschichte immer eine Geschichte des Verlusts und des Schwunds ist. Es gibt ja durchaus einen Diskurs, der sich genau an solchen Fragen abarbeitet, in Berlin wäre das beispielsweise das Living-Archive-Projekt – das aber eben auch hauptsächlich diskursive Energien bündelt und nur in sehr überschaubarem Rahmen Filme langfristig sichert. Wäre nicht das auch eine Lektion, die die kulturpolitisch Verantwortlichen von den Kongressen lernen könnten: dass nicht die Re-(Konstruktion) eines imaginären Idealfilmerbes Zentrum der Anstrengungen sein sollte, sondern eine Bestandaufnahme dessen, was überhaupt noch da?
MD: Das wäre es! Aber ich bin mir nicht sicher, wie man das, was die Kongresse machen, in die Sphäre von realer Politik vermitteln kann. Immerhin gibt es ja einen Mitarbeiter aus dem Ministerium der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der da hinfährt, der weiß, worum es sich dabei handelt. Ansonsten, ist meine Erfahrung, wird das schnell ernüchternd: In den letzten Jahren haben nur Linkspartei und Grüne – auch durch die Lobbyarbeit der wenigen Material-Aktivisten – erkennen lassen, dass es ein Bewusstsein für das Problem gibt. Zwei Oppositionsparteien, dazu ein Thema, das unter „ferner liefen“ rangiert. Am heftigsten war das Gespräch mit dem CDU-Mann, der den Vorsitz im Kulturausschuss hatte in der letzten Legislaturperiode: Der hat das Problem überhaupt nicht verstanden. Für den war alles geritzt, weil: Digitalisierung macht doch jetzt alles neu und gut, also auch was Projektionstechnik angeht. Der hat darüber geredet wie über Innenstadtsanierungen in Halle nach 1990. Man kann von der Politik, gerade an den Spitzen der Repräsentation, sicherlich nicht immer die fachlich tiefste Expertise verlangen. Aber diese kultur- und geschichtslose Argumentation war schon erschütternd.
Zumal, darauf weisen deine Schwierigkeiten mit dem Begriff „Filmerbe“ ja hin, die Bewahrung des Filmerbes, eine konservatorische Idee, ja etwas sein könnte, womit doch gerade die CDU sich in der Kulturpolitik profilieren könnte, wenn nicht müsste. Aber da wird dann von Digitalisierung geschwärmt, wogegen es an vielen anderen Stellen quasi natürliche Reflexe gibt. So ist das analoge Filmerbe ein weiteres Thema, das die Konservativen der AfD überlassen. Der Begriff selbst ist – das ist zumindest meine Erfahrung – als Schlagwort ganz tauglich, weil dann die Redaktionen wissen, worum es geht.
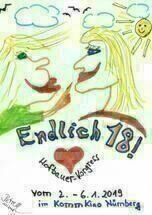
Was zu dem ganzen Komplex aber dazugehört: dass die Frage medial kaum beschäftigt. Beim letzten Pressetermin im Bundesarchiv waren wir zu viert – und ich formal der einzige Journalist. Mein Eindruck ist, dass über die Fragen der Archivierung breiter nur berichtet wird, wenn es einen Anlass gibt: das Film:ReStored-Festival im Arsenal zum Beispiel, das ja eigentlich auch nur erfolgreich erstellte Digitalisate vorführt. Oder wenn vor der Berlinale mal wieder ein Klassiker fertig geworden ist, der seine 4K-„Welturaufführung“ erlebt, oder wie das dann heißt. Dabei wäre eine größere mediale Öffentlichkeit sicherlich hilfreich. Dass die Kassationspraxis gestoppt wurde vor ein paar Jahren, dass alle die Originale nicht mehr weggeworfen werden, wenn sie umkopiert oder digitalisiert sind, das hatte auch mit Veröffentlichungen dazu zu tun.
Wie hast du das denn wahrgenommen in deinem Kracauerjahr, diesen Raum Filmkritik drumherum, in den man ja hineinschreibt: Gibt es da Resonanz für den Begriff von Cinephelie, um den es dir ging? Mein vorsichtiges Gefühl wäre, dass etwa die Hofbauer-Kongresse und ähnliche Festivals auf niedrigem Level etabliert sind, nicht nur als Kuriositäten gelten.
LF: Ich glaube auch, dass nicht nur die Kongresse selbst wachsen, sondern auch ihre Sichtbarkeit im Diskurs. Für die einen sind sie immer noch so etwas wie Sehnsuchtsorte, für die anderen eine aus der Ferne mit skeptischer Neugier beobachtete fremde Welt und für wieder andere vielleicht eine nicht unbedingt allzu gern gesehene Konkurrenz; schließlich führen sie vor, dass es nach wie vor möglich ist, auch jenseits des lärmenden, von schnelllebigen Hypes geprägten Festivalbetriebs, viele junge Menschen ins Kino zu locken und dabei der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Kino ein – durchaus ganz klassisch cinephil – von Lust und Enthusiasmus geprägtes Umfeld zu schaffen. Insofern wirken die Kongresse auch dem Rückzug des Filmdiskurses in universitäre Fachdisziplinen entgegen. Dass inzwischen auch eine Reihe von Filmwissenschaflter*innen und auch Leute aus der Filmpraxis da hinfahren, ist eine ziemlich tolle Sache. Was es, glaube ich, nicht mehr so oft gibt, höchstens sehr vereinzelt, ohne allzu große Reichweite, ist das grundsätzliche Ressentiment gegen das Niedere, Populäre, auch das sexuell Freizügige und das, entschuldige den Kampfbegriff, politisch Unkorrekte. Das liegt, glaube ich, zum einen daran, dass die Veranstalter gut kommunizieren, worum es ihnen geht, zum anderen vermutlich auch an einer allgemein gestiegenen Toleranz für Abweichungen vom Kanon bürgerlichen Kunstschaffens. Negativ formuliert, dürfte es auch damit zu tun haben, dass der Autorenfilm, der lange das Kulminationszentrum der Filmkultur war, an Anziehungskraft eingebüßt hat.
Ein Problem für das, was man cinephilen Diskurs nennen könnte, ist auf jeden Fall, dass vor allem, aber nicht nur durch die Digitalisierung Strukturen wegbrechen oder instabil werden. Was ist, zum Beispiel, von der Blogosphäre, die es vor 10 bis 15 Jahren einmal gab, übriggeblieben? Nicht gar nichts, aber doch, nicht nur im cinephilen Bereich, recht wenig. Es gibt natürlich auch neue Seiten wie etwa „Jugend ohne Film“, aber so etwas hängt immer an ein, zwei Personen. Auch deshalb sind, glaube ich, diese Off-Festivals wichtig, auf einer anderen Ebene ebenso die cinephilen Tauschbörsen im Internet: weil sie wenigstens etwas stabilere Strukturen schaffen, Treffpunkte, ob reale oder virtuelle, bei denen man sich einigermaßen sicher sein kann, auch noch in sechs Monaten, einem Jahr, drei Jahren auf Leute zu stoßen, die dieselbe Sprache sprechen wie man selbst.
Aber einmal eine ganz andere Frage: Du hast ja, glaube ich, nach wie vor einen recht guten Überblick über das aktuelle deutsche Filmschaffen, zumindest einen deutlich besseren als ich. Mich würde interessieren, ob das, worüber wir bisher hier gesprochen haben, sich irgendwie im Gegenwartskino niederschlägt. Damit meine ich nicht nur ؘ– aber auch – direkte Thematisierungen des Medienumbruchs, der Archivproblematik und so weiter, sondern auch allgemeiner ein Bewusstsein für das filmhistorische Terrain, in dem man sich bewegt. Gibt es zum Beispiel im deutschen Gegenwartskino Versuche, an gewisse Gegenkinotraditionen anzuschließen? Oppositionen, die nicht nur „thematisch“ und punktuell sind, sondern die direkt, sozusagen als Film, versuchen, eine andere deutsche Filmgeschichte zu schreiben? Als jemand, der das konsequent und mit einer gewissen Breitenwirkung macht, würde mir tatsächlich nur Dominik Graf einfallen.

MD: Was das deutsche Gegenwartskino angeht, sind im letzten Jahr meine Lücken größer geworden. Da würde mir aktuell nur der Versuch einfallen, Genre zu erzählen – der Thriller Das Ende der Wahrheit von Philipp Leinemann. Da geht es um den BND, die Politik und Auslandsgeschäftte, aber der Film misslingt, weil er seinen Konflikt nicht plastisch genug herausarbeitet. Und auch wegen der Schauspieler, die entweder zu blass wirken als fiese Bösewichte einer privaten Sicherheitsfirma, die an einem See auf den von Ronald Zehrfeld gespielten Helden einreden, oder zu sehr in ihren Fernsehroutinen stecken, um glaubhaft Amtsträger zu performen; mit Ausnahme von Alexander Fehling.
Dass einem bei dieser Frage immer nur Dominik Graf einfällt, ist einerseits logisch, andererseits aber auch ein bisschen ungerecht. Weil etwa beim Tatort, bei dem ich das ganz gut überblicke, schon immer mal wieder bemerkenswerte Filme vorkommen – gerade in dieser jetzt zu Ende gehenden Saison. Da gab es so viele gelungene Episoden wie selten zuvor. Und damit meine ich nicht nur die geglückte Adaption von Und täglich grüßt das Murmeltier für einen Tukur-Tatort von Dietrich Brüggemann, die Furore gemacht hat. Obwohl ich das auch interessant fand, zu sehen – bei Christian Petzold ist das in gewisser Weise ähnlich –, wie der Zwang zum Krimi, der Druck, ein paar Konventionen einzuhalten, zu überzeugenden Filmen führt; bei Brüggemanns Kinofilmen war meines Erachtens immer schon zu erkennen, dass er etwas probiert, ungewöhnliche Formen sucht, sich selbst Setzungen macht, auch wenn die dann irgendwann nicht mehr zur Geschichte passten und man den Film vor lauter Konzept nicht mehr sieht.
Was mich ebenfalls überrascht hatte, war die Missbrauchsgeschichte Für immer und dich von Julia von Heinz. Sie erzählt das Ende eines Falles, in dem sich ein minderjähriges Mädchen aus der Beziehung mit einem älteren Mann emanzipiert, die sie wohl halb verführt, halb fasziniert eingegangen war. Da gibt es ja reale Fälle, und das hat Julia von Heinz hinbekommen: das so genau und eben real zu zeigen, dass es vielen Leuten zu viel wurde. Die konnten die Ambivalenz nicht aushalten, dass der Böse ein richtiger, scheinbar ganz gewöhnlicher Mensch war, kein Monster, von dem man sich leicht distanzieren kann; ich habe das beim Drüberschreiben selbst gemerkt, dass einen dieser Film wirklich an die Grenzen der Begriffe führt, dass es juristisch natürlich Missbrauch ist, dass der Film aber die Übergänge anschaulich und spürbar macht, wo Abhängigkeiten beginnen, das Ausnutzen und der Missbrauch. Der Hass, den der Film zu spüren bekommen hat, hatte auch damit zu tun, dass die Leute da Bilder von Nacktheit reinprojiziert haben, die Heinz gar nicht gezeigt hat. Oder dass tatsächlich Gewalt zu sehen ist oder besser: nur evoziert wird, weil die Szene, in der der Mann den Hund des Mädchens totschlägt, auch wahnsinnig gut geschnitten ist. Der Film delektiert sich nie an den Schauwerten, dem Grusel, der Nacktheit, die mit seiner Geschichte verbunden sind, aber er erzählt so clever, dass viele das automatisch darin sehen wollten.

Und was das filmhistorische Interesse angeht: Da bezieht sich Heinz am Ende auf Reifezeugnis, den Tatort mit Nastassja Kinski, der vielleicht auch noch mal gut wäre für eine Revision bei den Hofbauern, weil Kinski da dauernd anlasslos oben ohne durch die Gegend tigert und die Supermusik von Nils Sustrate, vom ersten Ton an, so eine slipperne Softsex-Lolita-Innerlichkeit verströmt. Für immer und dich nimmt den Satz, mit dem sich der Lehrer vom Mädchen verabschiedet in Reifezeugnis, legt ihn aber dem Mädchen in den Mund, das am Ende geht, aus eigener Kraft – während der Mann, den Andreas Lust ungemein plausibel spielt, seine innere Leere und Gewalt nicht dazu mobilisiert bekommt, ihr noch gefährlich zu werden. Das hätten schlichtere Filme wohl gemacht, dass er ihr dramatischerweise nochmal ein Messer an den Hals gehalten hätte. Aber der kann das nicht mehr, konnte es noch nie.
Und daneben gibt es die Tatort-Folgen aus dem Autorenverbund „Schreibkombinat Kurt Klinke“, die das Spiel mit den Gegenkinotraditionen wohl am buntesten treiben, in den Grenzen, die die Redaktionen ihnen lassen. Bei Erol Yesilkaya gibt es in der Dresdner Folge Das Nest einen Arzt, der mordet und die Leichen dann für irgendwelche Installationen in einem abgelegenen Haus drapiert, worauf der Film aber auch nicht weiter eingeht. Schon die Exposition ist super, weil sie zufällig geschieht: Eine Frau hat einen Unfall auf der Straße nachts und irrt dann zu diesem Haus, in dem gerade wieder jemand seziert wird. Oder dass als Begründung für das Morden des Arztes nur gesagt wird, ich mach das halt, ich werde es immer machen, es steckt in mir drin.
Ein anderes Beispiel wäre Wir kriegen euch alle, ein Münchner Tatort von Michael Proehl, der die eigene B-Movie-Affinität in eine fast zu elegante, fast zu perfekte Erzählung übersetzt, die am Ende sogar noch nebenher politisch ist. In dem Film kommen einem zum Beispiele zwei chinesische Nannys entgegen, von denen die eine sich dann als Kampfkünstlerin entpuppt. Das sind eigenwillige Momente, weil einem auffällt, dass man eigentlich nie sinodeutsche Charaktere sieht im Tatort, und dann ploppen die final auch noch als Kinobild aus tausend ungesehenen Hongkong-Reißern auf.

Die Pointe ist, dass Proehl, Yesilkaya und die anderen „Kurt Klinke“-Leute sich in dieser Hofbauer-Szene bewegen; die waren noch nicht beim Kongress, aber da gibt es Berührungspunkte; die gucken auch ähnlich cinephil wie du, also eigentlich alles, mit großer Lust am Abseitigen, Schmutzigen, Übersehenen, ohne dass das auf der Kiffer-Begeisterung von „So schlecht, dass es schon wieder gut ist“ hängenbliebe. Der Tatort ist vermutlich der Raum, der da mehr zulässt an Abweichungen, Schönheiten, allein schon, weil konstant viel produziert werden muss; da wären die Ängste beim deutschen Kinofilm vermutlich größer, der würde das nicht so leicht wagen. Wobei die Vorstellung auch absurd ist, wie da jemand, der für die knallig-trüben Perlen des koreanischen Kinos schon distinktiv unempfänglich ist wie die MDR-Spielfilmchefin Jana Brandt, plötzlich einen Tatort hingestellt bekommt für das von ihr verwaltete Geld, in dem eine so offene, begeisterungsfähige Form von Filmsozialisation verdaut ist (oder eben auch nicht ganz) wie in Yesilkayas Das Nest.
LF: Das interessantere Kino überwintert im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, so ähnlich taucht das ja auch manchmal bei Graf auf. Ein schöner Gedanke, auch in seiner Paradoxie, schließlich sind gerade diese Öffentlich-Rechtlichen das Zentrum jenes allseits integrierten Fördersystems, das oft genug allem, was am Kino interessant sein könnte, die Luft abschneidet. Obwohl ich da nach wie vor größere Berührungsängste habe als du, ist das aber auch mein Eindruck: Im Fernsehen gibt es, zumindest manchmal, mehr Beweglichkeit, mehr Interesse auch, Leute außerhalb des eigenen Milieus zu erreichen.
Damit könnten wir vielleicht abschließend noch einmal auf den Anfang zurückkommen. Denn eigentlich sollte das Fernsehen ja auch, denke ich, eine Schlüsselrolle spielen, wenn es um das Filmerbe geht. Das wäre der logische Ort dafür, Filmgeschichte neu und vielleicht auch anders sichtbar zu machen. Nur haben die meisten Sender, gerade die Öffentlich-Rechtlichen – wenn, dann wird man eher auf privaten Spartenprogrammen wie dem Heimatkanal fündig – sich da ziemlich komplett aus der Verantwortung gestohlen. Und sie pflegen, noch dazu, auch ihr eigenes Archiv nicht. Das „Fernseherbe“ taucht ja kaum auf in der Diskussion bisher, dabei ist das, wie ich während meiner Zeit im Zeughauskino erfahren habe, mindestens ebenso gefährdet wie das Filmerbe.
Kommt nicht dem Fernsehen genau hier eine neue, vielleicht seine in seiner klassischen Form letzte gesellschaftliche Aufgabe zu: die Bewahrung und Präsentmachung des audiovisuellen Materials des 20. Jahrhunderts, dem des Kinos – das selbst immer weniger über die Infrastruktur verfügt, so etwas zu leisten – und dem eigenen? Gäbe es in den Sendern Verbündete für so etwas, oder bedürfte es einer Revolution?

MD: Ich würde vermuten: eher Letzteres. Darüber klagte Eberhard Fechner schon Ende der achtziger Jahre, wie aufwendig und teuer es ist, einen Film, den er vielleicht noch selbst gemacht hat, aus den Archiven der Sender rauszukriegen. Der wollte damals deswegen ja eine „Deutsche Mediathek“ gründen. Das „Fernseherbe“ soll auf jeden Fall Teil meiner Recherche sein, gerade weil es so absurd ist, die Schätze, die da im Laufe der Zeit produziert worden sind, nicht zugänglich zu machen. Dabei ist, soweit ich das überblicke, der Konflikt eigentlich leicht zu lösen: Wenn die Rechte unklar sind, muss man sich dahinter nicht verstecken und ein Nein draus machen, sondern das politisch lösen und pauschal entgelten; einfach als „Ja“ entscheiden.
Absurd ist das Primat dieser Rechte in der Argumentation auch, weil das ja alles schon bezahlt ist von öffentlich-rechtlichem Geld – und vor allem: weil es den Rechteinhabern umgekehrt auch nix nützt, wenn die Sachen nicht zu sehen sind. Andreas Goldstein, der gerade Adam und Evelyn und Der Funktionär gemacht hat, erzählt immer davon, was für erstaunliches Material man in Senderarchiven an Berichterstattung über die DDR aus dem Westen vor 1989 findet – so eine Arbeit, eine Revision wäre auch politisch das viel interessantere Begleitprogramm zum nächsten Mauerfall-Vereinigungs-Gedenktag, als den nächsten Buchpreisgewinner-Roman, der in der DDR spielt, mit Plastikeierbechern und blankpolierten Ladas auszustatten. Gleichzeitig gibt es auch bei den Sendern Digitalisierungsinitiativen. Solche Projekte wie beim BR oder dem RBB, der alte Tatort-Folgen auf diese Weise bewahren will, deuten zumindest auf ein Geschichtsbewusstsein fürs eigene Medium hin. Das müsste man sich mal anschauen.
Der Text ist im Rahmen des Siegfried-Kracauer-Stipendiums entstanden und zuerst im Filmdienst erschienen.












Kommentare zu „Frühes Gespür fürs Bewahrenswerte – Cinephilie und „Filmerbe““
Es gibt bisher noch keine Kommentare.