Durch das Reale schneiden - Godard zum 90.
Wen Godards Spätwerk in der jugendlichen Trotzphase erwischt, der braucht keinen Referenzkosmos. Erinnerung an eine naive erste Begegnung mit dem Altmeister, der seine Zerstörungswut zuletzt vermehrt auf die technischen Mittel des Films gerichtet hat.

Was das Kino angeht, begannen die 2010er Jahre für mich mit dem Erscheinen von Jean-Luc Godards Film Socialisme. War ich zuvor ein eifriger und eher unkritischer Filmfan gewesen, befand ich mich zu dieser Zeit in einer Art von adoleszenten Trotzphase und rümpfte über einen Großteil der mir bekannten filmischen Neuerscheinungen die Nase, da sie mir die Potenziale des Mediums nicht auszuschöpfen schienen. In Godard, für dessen Werk ich mich vorher kaum interessiert hatte, fand ich 2010 jedoch endlich ‚meinen‘ Filmemacher, der mit seinen damals achtzig Jahren einen ähnlichen Widerwillen gegenüber den eingefahrenen Routinen sowohl des Arthouse- wie des kommerziellen Kinos zu verspüren schien wie ich mit neunzehn.
Klar, inhaltlich verstand ich wenig von diesem Film. Aber mir entging nicht, dass er sich, besonders in seinem Mittelteil, genau an Leute wie mich richtete: an Sprösslinge einer ins Prekäre gedrängten europäischen Mittelklasse, bei denen sich in Folge von Wirtschaftskrise und TINA-Mentalität einmal mehr No-Future-Stimmung breitmachte. Nicht umsonst zeigt uns ein plötzlicher Zoom in der bekanntesten Einstellung von Film Socialisme den Einband von Balzacs Roman Verlorene Illusionen, den eine junge Frau vor der Autowerkstatt ihrer verarmten Familie liest, während ihr aus einem vorbeifahrenden Auto ein deutsches „Scheiß-Frankreich!“ entgegengeschleudert wird.
Rekonstruktion des Ungezwungen

Ich beginne mit einer biografischen Perspektive, denn die Ungezwungenheit, mit der ich mich 2010 den Filmen Godards näherte, weil ich über ihren Platz innerhalb der Filmgeschichte wenig wusste, erscheint mir rückblickend als Vorteil. Allein der Name Godard schreckt heute viele Filminteressierte ab, und das hat viel mit seiner exponierten Stellung im Referenzkosmos der Filmkritik und -theorie der letzten sechzig Jahre zu tun. Die Auseinandersetzung mit Godards Werk ist eine kritische Königsdisziplin, in der sich Liebhaber üben und die von Außenstehenden bespöttelt wird. Für das Fach der Filmwissenschaft gehören Studien zu seinen Filmen zu den Gründungsdokumenten.
Von all dem wusste ich damals noch nichts, und in den folgenden Überlegungen möchte ich versuchen, diese Ungezwungenheit zu rekonstruieren, mich zu fragen, was genau ich damals als so belebend an Godards Ansatz empfunden habe und woran junge Filmemacher heute vielleicht ganz konkret weiterarbeiten könnten, ohne zu Godard-Spezialisten werden zu müssen.
Mosaik mit Pixeln

Nachhaltig eingeprägt haben sich mir die heute recht unscheinbar wirkenden ersten Minuten von Film Socialisme. Nach einem Auftakt, in dem wir zu betörend schönen Bildern schäumender Meereswogen und des Sonnenuntergangs über dem Mittelmeer die ersten kryptischen Dialogzeilen gehört haben, schneidet Godard plötzlich auf eine verpixelte Aufnahme aus dem Inneren der Diskothek an Bord des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia, auf dem der erste der drei Teile des Films spielt – und das nicht lange nach der Premiere des Films havarierte. Der hochauflösende Glanz der ersten Einstellungen kollidiert unversehens mit dem verzerrten Klang von Schlagermusik und der minderwertigen Textur von Handyvideos aus dem vorletzten Jahrzehnt.
Dieser Effekt ist so einfach wie verblüffend, und ästhetisch vielschichtig. Zunächst ironisiert die minderwertige Qualität der Aufnahme das Gezeigte: Das kleine touristische Urlaubsparadies wird durch seine Darstellung in einem technisch defizitären Medium in seiner Plumpheit offenbart. Aber wenn kurz darauf narrative Sequenzen in teilweise unterbelichteten und unscharfen DV-Bildern folgen, dann geht der Effekt darüber hinaus, dann wird auch die Grenze zwischen dem Amateurvideo und der „filmischen“ Einstellung verwischt, dann werden die Erwartungen untergraben, die man als Zuschauer an diese Bilder heranträgt. Die Vielzahl von Kameras und ihrer je spezifischen Optik geht in Film Socialisme einher mit den wechselnden Perspektiven auf das Schiffsdeck und vermittelt den Eindruck, dass die Fäden hier nicht in der Hand eines allwissenden Regisseurs zusammenlaufen. Vielmehr ergibt sich das Gesamtbild mosaikartig aus verschiedenen Quellen, und nur manchen haftet die bekannte Godard’sche Handschrift an.
Aufbrechen der Zwangsoptik
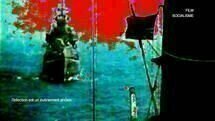
Dieser Effekt wird durch die Verwendung von YouTube-Clips verstärkt, wobei besonders ein Katzenvideo hervorsticht, das hier als Found-Footage-Element in den Film montiert wird und gleich darauf auf einem Laptop-Monitor erscheint, vor dem eine junge Frau in das Miauen der Tiere einstimmt. Die filmische Message des ersten Teils von Film Socialisme scheint damit ziemlich klar: In einer Zeit, in der alle Videos von ihrer Umgebung produzieren und online zur Verfügung stellen, ist der Filmautor nur noch eine Stimme unter vielen, und seine Perspektive bildet bestenfalls die semantische Klammer, deren Aufgabe es ist, die Polyfonie der Quellen zu etwas Neuem zu arrangieren.
Aber verweilen wir noch einen Moment bei Godards aggressiver Geste, technisch minderwertige Bilder in das nach ästhetischer Kohärenz strebende Format des abendfüllenden Spielfilms einzuflechten. Godard war sich nie zu schade, die jeweils zeitgenössischen Erscheinungsformen der Konsumgesellschaft frontal anzugreifen. Sein Umgang mit der technischen Seite des Filmemachens im vergangenen Jahrzehnt trägt viele Spuren einer Wut, als deren nihilistischer Höhepunkt noch immer die Zerstörungsorgie von Week-End (1969) gelten darf. Die Aufnahmetechnologie selbst schien bis dato noch weitgehend ausgenommen von diesem destruktiven Gestus, Kameras wie Mitchell oder Emulsionen wie Eastmancolor wurden in Godards bekanntesten Filmen als Totems der klassischen Kinematografie eher mythisiert. Mit der Entfesselung der Aufnahmetechnologien im letzten Jahrzehnt scheint sich Godards Skepsis jedoch auch auf diesen Aspekt des Filmemachens ausgeweitet zu haben. Nino Klingler schrieb in seiner Kritik zu Adieu au Langage (2014), dem Zuschauer werde in diesem Film „audiovisuelle Gewalt angetan“.
Inzwischen berüchtigt ist die Art und Weise, wie Godard in diesem Film die Möglichkeiten der neuen 3D-Technologie bis zum Äußersten ausreizt und den Zuschauer an den Rand seiner kognitiven Aufnahmefähigkeit bringt. Zwar ist dieser Gestus der Bombardierung des Zuschauers mit Informationen und Zitaten auch in früheren Filmen schon zu finden. Aber die Gewalt gilt diesmal eben vornehmlich der Aufnahmetechnologie selbst und weniger den Inhalten, die sie transportiert. Auch hier liegt Godards kritischer Impetus auf der Hand: Durch die Proliferation filmischer Praktiken im digitalen Alltag der 2010er Jahre nehmen die Konzerne, die die Aufnahmetechnologien bereitstellen, eine Machtposition ein, zeigen uns unser Leben buchstäblich durch ihre Linse. Godard nutzt die neue Freiheit, die in der Verfügbarkeit dieser Technologien liegt, aber zugleich tut er ihnen Gewalt an, um die Optik wieder aufzubrechen, die sie uns aufzwingen.
Digitales Fluidum

Dieser aggressive Gestus beschränkt sich aber nicht auf die Kameras, sondern betrifft auch den ganzen Komplex der Postproduktion. Le livre d’image (Bildbuch, 2018) kann als eine ebenso heftige Attacke auf die Konventionen neuer Schnittverfahren betrachtet werden wie Adieu au Langage als Angriff auf High-Definition und 3D. Zwar wurden, wie Godards enger Mitarbeiter Fabrice Aragno berichtet, die ersten Fassungen dieses Films offenbar umständlich an einem Videogerät zusammengebastelt und viele der bewusst primitiven Farbeffekte des Films analog reguliert. Doch die Übertragung dieser Sequenzen in eine digitale Form durch Aragno selbst verleiht dem Film eine ausnehmend digitale Textur, in die die spezifischen Eigenheiten und Fehler einfließen, die die Arbeit mit Schnittprogrammen am Computer mit sich bringt. So kommt es etwa vor, dass man beim Schneiden versäumt, die zwei „Blöcke“, die auf der Benutzeroberfläche zwei Filmclips repräsentieren, nahtlos miteinander zu verbinden. Daraus resultiert im Film ein kurzer Moment der Schwärze, ohne visuelle Informationen, der in einer analogen Montagesituation nicht möglich gewesen wäre, in Livre aber als systematisch eingesetztes, rhythmisierendes Stilmittel auftritt.
Ähnlich verhält es sich mit der Schwierigkeit, Bildmaterial aus verschiedenen Quellen (ob es nun Originalaufnahmen oder Fundstücke aus dem Archiv und dem Internet sind) in der Postproduktion eine kohärente gemeinsame Ästhetik zu verleihen. Die ganze bedauernswerte, aber aus dem heutigen Kino nicht wegzudenkende Praxis des color gradings beruht auf diesem Anliegen, der Heterogenität des an Bildinformationen überreichen hochauflösenden Bildmaterials in der Postproduktion einen einheitlichen Stempel aufzudrücken. In Livre d’Image passiert das genaue Gegenteil. Die Heterogenität der in Godards Collagen einfließenden Filmsequenzen wird durch grelle Saturierung und die Paarung unvereinbar wirkender Formate bis zum Äußersten gesteigert. Was andernorts als Fehler gilt – stockende Frames, das ‚kaputte‘ Bild, die nicht übereinstimmenden Seitenverhältnisse, das Springen des Bildes von einer Größe zur anderen –, wird hier als neues Ausdrucksmaterial für die filmische Arbeit in einem digitalen Fluidum erschlossen.
Unerschlossene Sprachen

Vielleicht ist das die unmittelbarste Anregung, die angehende Filmemacher aus diesem jüngsten Godard-Jahrzehnt mitnehmen können: All das, was traditionelle filmische Semantiken als Fehler markiert haben, sind eigentlich unerschlossene kinematografische Sprachen. So ist Adieu au Langage voller Einstellungen und Kamerabewegungen, die – besonders wenn man den Film zu Hause in 2D anschaut – amateurhaft wirken. Die Kamera steht schief, zittert in der Hand, von der sie gehalten wird, oder kippt einfach ungelenkt zur Seite. In der Summe entsteht jedoch der Eindruck, dass dieser Film mithilfe der unzähligen neuen Mikrobewegungen, die die Vielfalt heutiger Film-Gadgets mit sich bringt, auf völlig neuartige Weise durch das Reale schneidet. Das Neue muss nicht das Fernliegende sein, sondern kann in der Fahrt einer GoPro unter dem Küchentisch oder der absurd detaillierten Großaufnahme eines Malkastens zu finden sein.

















Kommentare zu „Durch das Reale schneiden - Godard zum 90.“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.