Director Cut: FID Marseille 2022
Braucht es für ein Festival vielleicht gar keinen Direktor? Das FID Marseille im Jahr Null steht wie eh und je für die Rohdiamanten des Kinos – und feiert mit Albert Serra und Mathieu Amalric den Geniekult, natürlich mit Augenzwinkern.
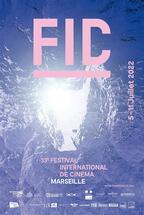
Kaum bin ich angekommen, laufe ich nacheinander Albert Serra und Jean-Pierre Rehm in die Arme. Dem einen wird hier in Marseille eine Retrospektive gewidmet, der andere hat nach 20 Jahren als Festivaldirektor das Handtuch geworfen. 2022 ist allerdings nicht ganz die erste Ausgabe ohne ihn, insofern er noch einige Teile des Programms ausgewählt hat, bevor er kurzfristig im Januar seinen Ausstieg verkündete. Die Suche nach einer neuen Festivaldirektion wurde wenige Monate später aufgegeben, zugunsten einer Lösung ohne Direktion, mit einem Leitungskomitee. Auch das bisherige Auswahlkomitee ist im Amt geblieben.
Eine Berufung für das Dazwischen

Und das macht eine fantastische Arbeit: Das Festival International de Cinéma de Marseille belegt einen ganz besonderen Platz im Konzert der internationalen Filmfestivals, seitdem es sich unter Rehm Anfang der 2000er von der Einschränkung auf die Gattung des Dokumentarfilms befreite. Indem es jenen Filmen ein Forum gibt, die es anderswo schwer haben, die durch die Raster fallen, die zwischen den Genres und Gattungen ihre Berufung sehen, im Experiment und in der Freiheit des Ausdrucks.
Kaum ein Film, der beim FID Marseille alle gleichermaßen berührt und bewegt. In den langen warmen Nächten wird tatsächlich viel über Filme diskutiert, angeregt und streitlustig, aber mit dieser Neugier, die einem Festival eigen ist, bei dem es zwar viele Preise, aber wenig Anschluss an die Branche zu gewinnen gibt. Die Gäste (es sind von den Filmschaffenden abgesehen schon überwiegend Leute aus Frankreich) sind nicht hier, um sich zu beweisen, sondern weil sie zu dieser Gruppe der leidenschaftlichen Cineasten gehören, für die Fragen nach der Form immer zuallererst politisch zu verstehen sind.
Prekräre Geschichten

About the Clouds (Sobre las nubes) der argentinischen Regisseurin María Aparicio ist dafür ein Glücksfall, In der Art, wie sie ihre Figuren in die Welt setzt und ihre Geschichten erzählt, offenbart sich mit großer Einfachheit, dass sie ihre Arbeit als ein humanistisches Projekt versteht, eines, das Zusammenhänge von Arbeit, Liebe, Familie, Hoffnung und Zufriedenheit sichtbar macht. Dafür lässt sich die Regisseurin viel Zeit und verzichtet bei allem aufrichtigen Interesse für die Geschichten auf den großen, alles verbindenden oder erklärenden Bogen. Im Mittelpunkt der Schwarz-Weiß-Bilder stehen Menschen, die nichts miteinander zu tun haben, die nur in derselben Stadt, Córdoba, leben und arbeiten – oder Arbeit suchen. Prekarität wird nicht aus dem Traum nach einem anderen Leben heraus verstanden, sondern als alltäglicher Umgang mit den kleinen und großen Zielen.
In einer von unzähligen schönen Szenen, baut ein Vater für seine Tochter aus einem Schuhkarton ein Utensil, um die Sonnenfinsternis sehen zu können, ohne Geld für eine spezielle Brille ausgeben zu müssen. In einer anderen Szene wird ein Koch im Restaurant eingesperrt und bahnt sich über Abstellkammern, Hintertüren, Luftschächte und ähnliches einen Weg bis in den Flur eines Wohnhauses, aus dem er nicht so schnell wie möglich flüchtet, lieber zwei jungen Frauen beim Gitarrespielen lauscht.
Gruseldeutsch

Einen ganz anderen formalen Weg beschreitet Lluis Galter in seinem auf DV-Videokassetten gedrehten Aftersun. Der spanische Regisseur setzt ganz stark auf eine verbindende Anekdote, um darunter allerlei Spielereien zu ermöglichen: In einer beinahe kollagenhaften Montage von Urlaubsimpressionen verfolgt Galter die Geschichte eines entführten Kindes, das eines Tages einfach vom Strand verschwunden ist. Ein alter Mann erzählt davon in möglicherweise dokumentarischen Bildern, Kinder erzählen sich davon gegenseitig nachts bei Taschenlampenlicht im Zelt, um sich zu gruseln. Die Bilder changieren zwischen rough und künstlich, mal scheinen sie einem mechanischen Kontext zu entspringen (etwa einer Überwachungskamera), mal sind es Home Videos, doch oftmals sind sie so durchkomponiert, als wären sie für den nächsten Retro-Werbespot gedacht. Die Spielereien umfassen dabei die Tonebene, die immer wieder fake klingende Nachsynchronisationen über die Bilder legen, einige Male auch auf Deutsch, der vielleicht gruseligsten Sprache überhaupt?
Desktop-Performance

Auch Mathieu Amalric ist von der deutschen Sprache und deutschsprachigen Kultur besonders fasziniert. In Marseille tritt er nicht nur als Regisseur und als Filmliebhaber auf – in einer Carte Blanche laufen von ihm ausgewählte Filme neben selten zu sehenden eigenen Werken. Dem Festival schenkt er zudem eine eigens konzipierte Performance im Keller des Museums der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers (Mucem).
Eine Spielerei: Irgendwo zwischen Klischee, Wunsch und Wirklichkeit siedelt er die 90 Minuten aus dem Schaffensprozess des Mathieu Amalric an. Er sitzt an einem Schreibtisch, angeblich ist er mitten im Dreh für eine 52-teilige Serie, die Robert Musils Mann ohne Eigenschaften unter Verzicht auf ein Drehbuch, direkt vom Romanfragment aus adaptiert. Eine schlaflose Nacht imaginiert Amalric für sich selbst, nicht ohne Verweis auf die Idee des rastlosen Genies, das unter größter Kraftanstrengung sich selbst auspresst, bis die Kunst zur Vollendung kommt.
Auf der Leinwand im Hintergrund sind auch mal Inspirationsquellen zu sehen, meistens aber wird der Bildschirm seines Laptops übertragen, wo Dreh-Dispo, Notizen und gescannte Buchseiten hin- und hergeschoben werden. Und von dem aus er telefoniert, mit Vicky Krieps, mit seiner Regieassistentin Amandine Escoffier und der Kostümbildnerin Caroline Spieth. Gelebter Alltag und Fantasie überlagern sich.
Sinn und Quatsch

Für einen augenzwinkernden Geniekult ist auch Albert Serra jederzeit zu haben, wie seine berauschende Masterclass einmal mehr unter Beweis stellt: Glaubt man Serra, gibt es nur eine Wahrheit, nämlich die seine. Alles andere ist konventionell. Eine Frage, eine einzige, stellt der Moderator zu Beginn, und Serra redet wie ein Wasserfall, für mehr als eine Stunde, haut Weisheiten und Theorien übers Filmemachen raus, als wären es Kochrezepte.
Das gipfelt in der Aussage, dass nur die digitale Kamera echte filmische Experimente erlaube, weil für sie die Dauer entscheidend sei, Schauspieler verlernen müssten, für die Kamera zu spielen. Deshalb dreht er erstens mit drei Kameras und zweitens digital (analoge Filmkameras können nur eine vergleichsweise kurze Dauer aufnehmen, bevor die Filmrolle getauscht werden muss). Es ist ein Vergnügen, Serra beim Theoretisieren zuzuhören, weil alles absolut Sinn macht, von großer Aufmerksamkeit und Hingabe zeugt, und es, verkürzt dargestellt, ziemlich nah an der Karikatur oder schlicht Quatsch ist. Auch das ist das FID Marseille. Es macht, mal wieder, Lust auf mehr.










Kommentare zu „Director Cut: FID Marseille 2022“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.