Die nachdenklichen Anfänge des Dr. Reinl
Kaum ein Regisseur des deutschen Nachkriegskinos bediente die Bedürfnisse eines ablenkungswilligen Kinopublikums so gekonnt wie Harald Reinl. Das Frühwerk des späteren Edgar-Wallace- und Karl-May-Filmserienroutiniers überrascht mit unerwarteten Tonlagen.

In Anbetracht des Einflusses, den Harald Reinl (1908-1986) auf das populäre westdeutsche Kino der 1950er bis 1970er Jahre hatte, muss er – entgegen der gängigen Filmgeschichtsschreibung – als einer von Deutschlands bedeutendsten Filmemachern überhaupt gelten. Die Cahiers du Cinema nannten ihn in den 1960ern gar den „Meister des deutschen Trivialkinos“. Vielleicht kann man ihn auch als deutschen Howard Hawks bezeichnen? Reinl war wie kaum ein anderer dem Unterhaltungskino der BRD verpflichtet, filmte, was möglichst vielen gefiel – und er bewegte sich dabei handwerklich stets souverän und mit ausgeprägtem Gespür für die alltagsenthobenen Bedürfnisse seines Publikums durch die verschiedensten Genres des Mainstreamkinos.

Reinl war schlicht einer der Spezialisten der ersten Nachkriegsjahrzehnte, wenn es darum ging, die Sehnsüchte nach einer anderthalbstündigen Auszeit zu befriedigen. So lieferte er beschwingte Heimat- und Schlagerfilme, romantische Komödien, Kriegs- und Abenteuerfilme sowie melodramatische Tearjerker aller Couleur ab, außerdem auf den internationalen Markt schielende Western- und Eurospy-Filme. Er filmte wie am Fließband, förderte die Karrieren von Filmstars wie Blacky Fuchsberger, Uschi Glas und Karin Dor, galt als uneitel und überzog, sehr zur Freude seiner Produzenten, selten das Budget.
Von Schauwert zu Schauwert

Wenn man an Reinls Filmografie denkt, fallen einem sicherlich zuerst die großen Kinoreihen der frühen 1960er bis 70er-Jahre ein: Die mal mehr mal weniger schaurige Sonntagnachmittagsunterhaltung im kunstvernebelten Studio-London der Edgar-Wallace-Krimis, für die Reinl mit Der Frosch mit der Maske (1959) die Initialzündung sowie über die Jahre drei weitere Beiträge lieferte. Im selben Atemzug kommen einem die in Cinema-Scope gedrehten Adaptionen der Wildwestfantasien Karl Mays in den Sinn, die Kassenschlager wurden, während sich der „Junge Deutsche Film“ gerade anschickte, gegen solch „realitätsfernes“ Kino der Vätergeneration anzurennen: Der Schatz am Silbersee (1962), Winnetou 1 bis 3 (1963-1965) sowie Winnetou und Old Shatterhand im Tal der Toten (1968) kreierten eine qualitativ hochwertige teutonische Spielart des Westerns, die als solche im Ausland durchaus wohlwollend aufgenommen wurde.
Kurz gesagt: Alles, was das Potential zur Kinetik hat, jede Spielfilmstory, bei der man wie im Krimi oder Western zügig von A nach B und dabei von Schauwert zu Schauwert kommt, und in der sich womöglich noch der ein oder andere „flotte“ Spruch unterbringen lässt, lag Reinl.

Was bei Reinls Omnipräsenz im Unterhaltungskino der BRD der 1960er Jahre – neben den genannten Reihen steuerte er etwa noch relevante Beiträge zur Neuauflage der Dr. Mabuse-Krimis, zur globetrottenden, an Agentenfilmen wie den James-Bond-Filmen orientierten Jerry-Cotton-Reihe und zur erstaunlich offbeatigen Pauker- bzw. Lümmel-Filmreihe bei – unterzugehen droht, ist, wie ambitioniert, ja für den späteren Reinl ungewöhnlich nachdenklich seine heute kaum bekannten Anfänge waren. Von den späten 1940er-Jahren an entstanden bis Ende der 1950er gut 20 Filme, wobei dem mystizistischen, in harten Schwarzweißkontrasten gedrehten Debütlangfilm Der Bergkristall bereits eine Reihe von kurzdokumentarischen Kultur-, Sport und Naturfilmen mit Titeln wie Oster-Skitour in Tirol (1939) und Bergbauern (1940) vorausgegangen waren. Auch vor der Kamera stand Reinl manchmal: 1931 doubelte er auf Skiern – denn der später promovierte Jurist arbeitete bis dato noch als Skilehrer und nahm an internationalen Wettkämpfen teil – Leni Riefenstahl in Arnold Fancks Der weiße Rausch.
Das Schweigen und die Dunkelheit

Diese frühe Bekanntschaft mit der späteren NS-Dokumentarfilmpropagandistin und die Tatsache, dass sie seine frühen Kulturfilme mitproduzierte, brachte Reinl – zweifellos eine monströse Initiation seiner künstlerischen Biografie – die Regieassistenz sowie die Co-Drehbuchautorenschaft von Tiefland (1944) ein. Reinl wird sich mit diesem letzten Spielfilm Riefenstahls, für den er von 1940 bis 1944 vom Kriegsdienst freigestellt wurde (bevor ihn der „Volkssturm“ kurz vor Kriegsende doch noch nach Italien brachte), massiv mit Schuld beladen. Und er wird nie bereit sein, diese einzugestehen, geschweige denn, sie zu sühnen: Denn wie Nina Gladitz‘ herausragender Dokumentarfilm Zeit des Schweigens und der Dunkelheit (1982) darlegt, wurden für den entrückten Bergfilm- und Folklorepomp von Tiefland Sinti und Roma aus dem benachbarten KZ Maxglan (bei Salzburg) zur Komparserie zwangsrekurriert; viele von ihnen, bereits während des Drehs von Stacheldraht eingepfercht, wurden nach Drehschluss im KZ Auschwitz ermordet.
Riefenstahl und Reinl leugneten zeitlebens, dass solche Zustände geherrscht hätten, dass sie vom Schicksal der Häftlinge Kenntnis hatten. In Reinls Filmen der frühen Jahre ist diese Art Schrecken denn auch selbstredend ausgeblendet; vom Ausmaß der Shoah kein Wort. Schuldfragen und Leiderfahrungen werden chiffriert, als Gleichnis verhandelt.
Vom standhaften Christenmenschen – Gesetz ohne Gnade (1950)

So etwa beim heute gänzlich apokryphen Gesetz ohne Gnade (1950) zu beobachten. Es ist wohl Reinls expressivster, schrulligster Film – und einer der wenigen, die bislang in keiner Form fürs Heimkino vorliegen. In einem fiktiven, verdächtig nach der Tiroler Bergregion aussehenden Staat bricht zu Filmbeginn der Totalitarismus los. In dynamisierten, kontrastreichen Schwarzweißbildern stürmen bewaffnete Schergen Häuser, brandschatzen und tilgen die Insignien der alten Ordnung. Auf Schildern wird sogleich die neue Staatsdoktrin verkündet: „Für das Privateigentum“; auch: „Nieder mit der Religion“. Hier deutet sich schon der wilde Mix an, den Gesetz ohne Gnade kredenzt.
Der Kampf gegen jede Form öffentlicher Religionsausübung bzw. „religiöser Propaganda“, wie es im Film heißt, mutet – ebenso wie der Kinnbart des diktatorischen Ortsvorstehers – bolschewistisch an, wozu das Beharren auf Privateigentum so gar nicht passen will. Ansonsten scheint der seit fünf Jahren überwundene Nationalsozialismus Pate für die Diktatur gestanden zu haben. Darauf deutet schon die Vorlage des Films hin: „Das Gipfelkreuz“ von Karl Loven, der als im NS verfolgter Priester hier eine autobiografische Figur entwirft, die nach der Machtübernahme in die Heimat zurückkehrt und sich gegen die Diktatur zunächst im Verborgenen, dann zusehends offener zur Wehr setzt, schließlich im Film, abweichend vom Roman, dafür den großen Märtyrertod stirbt.
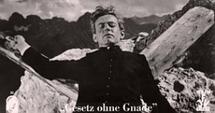
Gesetz ohne Gnade ist vermutlich ohne Parallelen im frühen BRD-Kino, ein Film voller kruder Einfälle: etwa dem, besagten Autor Loven auch als Hauptdarsteller einzusetzen, was dem Ganzen eine besondere, persönliche Note verleiht, zugleich aber dazu führt, dass hier weniger gespielt wird, als dass leblos Drehbuchsätze aufgesagt werden – und das nicht nur von Loven, sondern von allen Beteiligten. Aber vielleicht passt dieser deklamatorische Stil zu einem Spielfilm, der an Zwischentönen nicht interessiert ist, sondern stets den Maximaleffekt, den direktesten Weg in die Köpfe des Publikums sucht.
Reinl und sein Kameramann Josef Plesner (übrigens einer der Produzenten von Tiefland) übertragen das Predigen auch auf die Bilder, die randvoll sind mit Monumentalität und Pathos und gleichermaßen an die expressiven Tonfilme Sergei M. Eisensteins wie an Riefenstahls überwältigungsästhetischen Exzesse erinnern. Nicht weniger als eine Tour de Force nicht-normalansichtiger Tableaus gibt es hier zu sehen: Ein im scharfen Gegenlicht auf dem Bergplateau knieender Priester im stillen Gebet, das Hinaufschleppen eines Gipfelkreuzes in der Morgensonne, der Wechsel von Engelsgesichtern und diabolischen Visagen, ein Priesterprofil in Doppelbelichtungen vor majestätischer Alpenkulisse. Man merkt der Formensprache den Willen zum eigenwilligen Autorenfilm an, aber auch die Schauwertliebe von Reinls späterer Pulp Fiction, etwa die der erwähnten Kinoserien.
Naturmystische Morallehre – Der Bergkristall (1948)

Stärker genrehaft angelegt als Gesetz ohne Gnade ist Reinls Der Bergkristall nach Adalbert Stifter. Der Spielfilm gilt als einer der ersten Berg- und Heimatfilme der Nachkriegszeit, bedient typische Motive, wie etwa die unerwiderte und umkämpfte Liebe sowie die (martialisch geächtete) Wilderei als einem Destruktionstrieb, der sich eigenartig durchs Genre bis ins Revival der 1970er hinein zieht (an dem Reinl übrigens mit zwei Verfilmungen von Heimatromanen Ludwig Ganghofers beteiligt war).

Zugleich geht Der Bergkristall mit seinem Mystizismus eigenständige Wege. Man hat den Eindruck, dass man es hier mit einem deutsch-österreichischen Pendant zu den Filmen des sowjetischen Regieeigenbrötlers Oleksandr Dowschenko (1894-1956) zu tun hat, die in der Zwischenkriegszeit der UdSSR ebenso wie Reinls Erstling magisch-realistische Solitäre waren. Hier wie dort begegnen wir traumgleichen, zeitenthobenen, vor majestätischen Naturkulissen sich ereignenden Parabeln von Gut und Böse, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Gemeinschaft und Individuum. In den rasch aufeinanderfolgenden Close Ups der vom Leben gezeichneten Laiengesichter speichern beide Filmemacher aber auch eine Realität auf, die bei aller Transzendenz der Stories dem Märchen nie die Oberhand überlassen. Transzendent ist in Reinls Film vor allem der titelgebende Kristall, der sich, normalerweise opak, schwarz verfärbt, sobald der Held Franz etwas Schlechtes, das heißt hier: Unchristliches, tut. Und auch die ihn umgebende Gemeinschaft scheint den Pfad Gottes verlassen zu haben. Doch der Kristall weist ihnen den Weg; am Ende steht ein gütiges Reich, das sich der Gnade Gottes sicher sein kann.
Das vermeintlich verlassene Kloster – Hinter Klostermauern (1952)

Den Weg zurück in den Schoß der Kirche tritt auch Thomas Holinka (Frits van Dongen) in Reinls Hinter Klostermauern (1952) an. Ein rauf- und trinksüchtiger Typ, ein Ekel, das in den Kriegsjahren aufgehört hat, an Gott zu glauben, und frisch aus dem Knast entlassen loszieht, mit der Freundin und dem gemeinsamen Kind (eine „wilde Ehe“, wie es die Kritiken nennen) ein verlassenes Kloster zu beziehen. Ein nur vermeintlich verlassenes Kloster, wie sie kurz darauf feststellen müssen. Zügig kehrt nämlich das Leben ins Gemäuer zurück: Der Glaubensfeind Holinka trifft auf die Priorin des Klosters (Olga Tschechowa) und ihre Gefolgschaft, die ihr Leben ganz dem Glauben verschrieben hat. Er, das konstant vorm Explodieren stehende Alphatier, das ähnlich wie John Waynes Hauptfigur in Howard Hawks’ Western Red River (1948) von uns keinerlei Sympathien erwarten darf, findet unter dem Einfluss der Schwestern wieder auf den rechten Pfad des Christenmenschen.

Inszeniert ist diese Wiedergeburt als Mix aus Glaubensmelodram, neorealistischer Gegenwartsdiagnose und irritierend eruptivem Körperkino, das gar – analog zum ungleich bekannteren Black Narcissus (1947) der Archers – bereits früh Signale des später berühmt-berüchtigten Nunsploitation-Genres aussendet. Ein „realistische(r) Film, der weder Christen verletzt noch Nichtchristen missioniert“, hieß es zeitgenössisch im vom Filmverleih herausgegebenen Begleitheft. Ob das mit dem glaubensdidaktischen, offenkundig wenig um „Objektivität“ bemühten Werk – das im Übrigen auf einer Welle von Glaubensfilme ab Ende der 1940er-Jahre mischwimmt (z.B. prominent Harald Brauns Nachtblende, 1949) – etwas zu tun hat, sei dahingestellt. „Realistisch“ scheint jedoch kein ganz abwegiges Attribut für den Film zu sein. Durch den Kreuzgang von Hinter Klostermauern weht wie nirgends sonst bei Reinl der eisige Wind der Nachkriegszeit.
Und die Bibel hat doch recht

Einen ähnlichen Realitätseindruck wird der Filmemacher in der Folge allenfalls noch in dem Kinderstarvehikel Rosen-Resli (1954) mit Christine Kaufmann liefern, das wie der Klosterfilm jenseits seiner mondänen Studioräumen in einem von Armut, Kriegstraumata und Verbrechen durchzogenen Nachkriegsalltag angesiedelt ist. Mal abgesehen von den – damals wie heute – extrem kruden, weil die Wehrmacht und die nazideutsche Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg weichzeichnenden Ausflügen Reinls ins Kriegsfilmgenre (Solange du lebst, 1955, U47 – Kapitänleutnant Prien sowie Die Grünen Teufel von Monte Cassino, jeweils 1958), steht ab Mitte der 1950er bei ihm zusehends das Uneingeschränkte-Gute-Laune-Kino im Zentrum, was womöglich seinen frühen Zenit bereits in den rustikalen Sauftiraden von Die Fischerin vom Bodensee, 1956, erreicht.

Der „Meister des Trivialfilms“ denkt seine Filme später mehr Bigger than Life, nach den Maßgaben von Kinetik, Script-Twists und Oberflächenreizen. Je weniger dieses Kino mit Alltag und Innerlichkeit, erst recht mit Sinnsuche zu tun hat, desto besser. Fast eigenartig, dass am Ende von Reinls Laufbahn noch einmal der Glauben (und seine Verteidigung) ungefiltert einsickert. So versucht die Pseudodokumentation … Und die Bibel hat doch recht (1977) den Beweis anzutreten, dass sich alttestamentarischer Text und archäologische Funde mitnichten beißen. „Und die Bibel hat doch recht“: So könnten man auch das nachdenkliche, transzendentale Frühwerk Reinls überschreiben.
Zu den anderen Texten unseres Specials zum deutschen Genrekino geht's hier.















Kommentare zu „Die nachdenklichen Anfänge des Dr. Reinl“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.