Die Grenzen des Autorenkinos – ein Rückblick auf Cannes 2016
Wie konventionell ist das Festival von Cannes wirklich? Über das Kino von heute und das von morgen, und warum einer der besten Jahrgänge jüngerer Zeit mir keine Ruhe lässt.
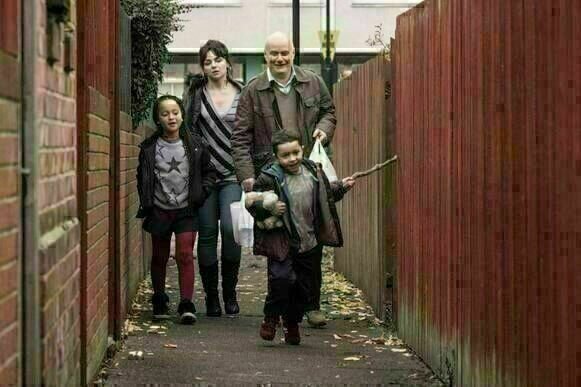
2016 wird nicht nur als Jahr der schlechten Juryentscheidungen in die Annalen des Festivals eingehen. Es könnte auch als eines der zugänglichsten in Erinnerung bleiben. Klingt gut? Nun ja. In der Süddeutschen Zeitung hat Susan Vahabzadeh vor ein paar Jahren einen Festivalbericht aus Venedig geschrieben, der mich sehr geärgert hat, mir sich aber seither eingeprägt hat. Sinngemäß warf sie dem Festival vor, dass die Preisträger keine Chance im Kino hätten und dass das den Festivals schade. Anlass waren vor allem die Preise für „Nischen-Dokumentarfilme“ wie The Postman’s White Nights (Belye nochi pochtalona Alekseya Tryapitsyna, 2014) und Gianfranco Rosis Das andere Rom (Sacro GRA, 2013).
Eine Verengung des Blicks

Wenn die Auszeichnungen eines Festivals regelmäßig an schwierige Filme gingen, so Vahabzadehs Argument, werde sich das Publikum immer seltener dafür interessieren, was auf diesen Festivals läuft. Für mich klingt das danach, dass man bittere Pillen versüßen müsste. Das scheint mir in den Annahmen didaktisch und herablassend. Richtiger fände ich in dem Kontext, statt „schwierige“ und „einfache“ Filme gegeneinander zu stellen, dass Festivals die Filmleidenschaft befeuern sollten. Das können die Filmfestspiele von Cannes auf ziemlich einmalige Weise. Sie nutzen dieses Vermögen aber aktuell viel zu wenig dafür, den Horizont eines Publikums zu erweitern, das sich mit leicht Zugänglichem begnügt. Im Gegenteil: 2016 steht im Zeichen einer Verengung des Blicks.
Selten habe ich mich auf so viele Filme eines Festivals so gefreut wie in diesem Jahr vor Cannes. Ich wurde kaum enttäuscht und hätte mir die schönsten Filme so gar nicht erträumen können. Bei den wenigen Ausnahmen bin ich gespannt, wie sie jenseits des Festivals, ausgeruht, inmitten vom Kinoalltag wirken werden. Da dürften gerade so ungleiche und hindernisreiche Filme wie die von Bruno Dumont und Alain Guiraudie, die im Wettbewerb etwas verblassten, sehr von profitieren. Die vielen Highlights (sie wurden schon oft genannt: Toni Erdmann, Elle, Sieranevada, für mich auch Einfach das Ende der Welt), die wenigen Lowlights (The Salesman, Bacalaureat), die paar Ärgernisse (The Last Face, From the Land of the Moon), sie haben fast alle eins gemeinsam: Es sind Filme, die in einer riesigen Abhängigkeit vom – manchmal meisterhaften – Drehbuch stehen.
Ein Feigenblatt in einer Sondervorführung

Im offiziellen Programm – Wettbewerb und Un Certain Regard zusammengezählt – habe ich in diesem Jahr nur einen Film gesehen, der sich von einer solchen dramaturgischen Logik löste, das war The Neon Demon von Nicolas Winding Refn. Weit und breit kein tranceartiges Erlebnis wie im letzten Jahr bei Apichatpong Weerasethakuls Cemetery of Splendour, das nicht auf Genreelemente angewiesen wäre wie NWR. Nichts gegen Genre, es ist aber auffällig, dass das Kino, das Cannes feiert, eines ist, das sich über immer mindestens eine Bezugsebene absichert. Und ein Film wie Albert Serras majestätisch eingefrorene Todeshymne The Death of Louis XIV (La mort de Louis XIV) erscheint wie ein Feigenblatt in einer Sondervorführung platziert – in Kombination mit einer Ehrenpalme für den Hauptdarsteller Jean-Pierre Léaud. Weit und breit auch kein formal abenteuerliches Werk wie Miguel Gomes’ Arabian Nights, weit und breit kein Film, der seine Geschichte in die Atmosphäre faltet wie Corneliu Porumboius The Treasure. Alles Beispiele, die in Cannes im letzten Jahr in Nebenreihen liefen und gerade nicht im Wettbewerb. Der Marginalisierung solcher Werke in den vergangenen Jahren folgte 2016 deren Abwesenheit. Das kann natürliche zyklische Gründe haben. Denn herausragende Filme, die die Grenzen des Mediums ertasten oder auch nur ästhetische Prinzipien über narrative stellen, sind selten. Andererseits kann man sie doch zum Beispiel sehr verlässlich in einem jeden Jahr beim Festival von Locarno entdecken.
Seit Jahren hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Thierry Frémaux sehr unglücklich über die Goldene Palme für Weerasethakuls Uncle Boonmee erinnert sich an seine früheren Leben (2010) war. Ein Film, der es schwer hatte im Kino, schon wegen seiner langsamen Erzählweise und der Bezüge auf transzendentale Erfahrungen, besonders aber aufgrund seiner Loslösung von narrativer Dichte und Kohärenz. Wenn ein solcher Film gewinnt, schadet das dann dem Festival? Weil das Werk kein guter Botschafter für die Zugänglichkeit ist, für das „Cross-Over-Potenzial“, wie man in der Branche sagt? Das Argument geht nicht spurlos an mir vorbei, ich meine, es entbehrt nicht einer gewissen Logik. Nur darf das doch kein Grund sein, ein Festival gegen solche offenen Formen abzuschotten. Ein Film wie Olivier Assayas’ Personal Shopper gehört unbedingt in den Wettbewerb, und nicht nur, weil Assayas Assayas ist und seine Hauptdarstellerin Kristen Stewart.
Club der Unkonventionell-Konventionellen

Auch durch Leute im näheren Umfeld von Weerasethakul wird die Distanzierung des Festivalleiters bestätigt. Den Palmen-Sieger mit einem Meisterwerk wie Cemetery of Splendour in eine Nebenreihe zu verbannen, ist ohnehin Zeichen genug. Dass darin westliche Stars fehlen, ist kein ausreichend plausibler Grund. Umgekehrt lässt sich an den Regisseuren, deren Arbeiten tatsächlich ausgewählt und protegiert werden, noch genauer ablesen, welche Vorstellungen Cannes vom Kino aktuell pflegt. Und das sind, gerade bei Debütanten und Machern unbekannterer Werke, überwiegend psychorealistische und politisch gemeinte Dramen, die sich um Aufnahme in den Club der Unkonventionell-Konventionellen bewerben. Es sind, das muss man dazu sagen, in aller Regel völlig okaye bis starke Filme.
Nehmen wir zum Beispiel den Un-Certain-Regard-Sieger, den finnischen Film The Happiest Day in the Life of Olli Mäki (Hymyilevä mies), oder auch den für das beste Drehbuch ausgezeichnete The Stopover (Voir du Pays). Beides schöne Filme, die Klischees und dramaturgische Fallen umschiffen, eigenwillige Figuren entwerfen und interessante Schauspieler gut inszenieren. Aus ihnen spricht eine Kraft, eine Lust am Kino, sie sind sanft und selbstbewusst. Das aber, womit sich Cannes brüstet, neue Stimmen des Autorenkinos zu finden, erfüllen sie das? Mir scheint, dafür sind die Filme, und nicht nur diese beiden, trotz aller inszenatorischen Finesse, zu sehr orientiert an dem, was es schon gibt. Möglicherweise ist das aber ohnehin eine Grenze von dem, was Autorenkino genannt wird. Denn auch dann, wenn einer ausbricht, dann immer mit einem Netz oder einem doppelten Boden.








Kommentare zu „Die Grenzen des Autorenkinos – ein Rückblick auf Cannes 2016“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.