Die Filter der Wahrnehmung, oder: Nichts persönlich nehmen!
Joanna Hoggs The Souvenir und Shannon Murphys Babyteeth sind radikal subjektive Filme. Zugleich keimt in ihnen die Idee des Politischen als Ort, in dem das Intime unpersönlich wird.

Zwei Filme wohnen derzeit in meinem Herzen. In beide bin ich eher so reingeraten, spontan und ohne viel Vorwissen. Beide blühen weiter im Kopf, sind keine abgeschlossenen Werke, sondern lebendige Erinnerung. Beide sind von Frauen inszeniert, umspielen jeweils das Schicksal einer jungen Frau. Beide sind in gewissem Sinne Coming-of-Age-Filme, aber dann auch wieder nicht. In beiden Filmen gibt es Heroin.
Wohin mit den Filmen?
The Souvenir habe ich 2019 auf der Berlinale gesehen, ohne bestimmte Erwartungen, er stand eben auf der Watchlist und passte ganz gut in den Tag. Dann war es schnell um mich geschehen. Auch weil ihm ein Kinostart erstmal nicht vergönnt war, nährte sich der Film in der Folgezeit von dem, was Girish Shambu das „Elsewhere“ der filmischen Erfahrung nennt, das, was wir, wie durch einen Nebel, von einem Film erinnern, „diese persönliche, cinephile Gedächtniswolke, die unbeständig ist, immer in Bewegung bleibt“. Ich hatte mich schon damit abgefunden, The Souvenir vielleicht nicht mehr wiederzusehen, da tauchte Joanna Hoggs Film im Programm des fsk in Berlin auf, und ein wenig habe ich vor einem zweiten Besuch gezögert, aus Angst, die Erinnerung an die Fiktion mit der realen Fiktion abzugleichen und dabei enttäuscht zu werden.

Angesichts der vielen Filme, die ich letzten Sommer, als die Kinos wieder geöffnet hatten, sehen wollte, hatte Shannon Murphys Babyteeth (Milla meets Moses im deutschen Titel) dagegen erstmal keine Priorität. Als ich aber nach einem abendlichen Spaziergang mit einer Freundin leicht angetrunken um 21:43 am Moviemento vorbeikam und mit einem schnellen Blick ins Programm feststellte, dass der Film um 21:45 gezeigt würde, hielt ich das für ein Zeichen. Ein bisschen wie in Trance, Mund und Nase bedeckt, taumelte ich in die erste Reihe des kleinsten Saals, blickte hinauf zum Licht, kam erst nicht ganz rein, aber dann so richtig.
Zunächst wollte ich diese beiden Filmerfahrungen in je einem kurzen, persönlichen Blogtext festhalten – in eine Essayreihe über „politische Cinephilie“ schienen sie auf den ersten Blick nicht zu passen. Diese Reihe sollte sich schließlich größeren Themen widmen, Diskurse aufgreifen, intervenieren, und die beiden Filme fühlten sich eher wie autonome Kleinode an denn wie mögliche Illustrationen größerer Thesen.
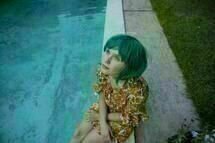
Andererseits war es von Anfang an der selbstgestellte Anspruch dieser Reihe, das Feld des Politischen zwar nicht vollkommen zu entgrenzen, aber doch zu erweitern. Gerade diese beiden Filme, die scheinbar so persönlich daherkamen, die sich zugleich so intim und so allgemein anfühlten – steckte in ihnen nicht die Möglichkeit, das Politische nochmals anders zu verstehen, eben als Verknüpfung des Intimen mit dem Allgemeinen? Glitzerte in diesen Kleinoden nicht die ganze Welt?
Das brachte mich zurück zu Lektüren der vergangenen Jahre, vor allem zu Kathleen Stewart und Lauren Berlant, zwei US-amerikanischen Kulturwissenschaftlerinnen, die sich sprachlich im Literarischen heimischer fühlen als im Akademischen, mit der Queer Theory assoziiert sind, und die stets das Intime mit dem Allgemeinen verknüpfen, um politisch zu denken. Wie schon in anderen Texten, will ich auch hier mit ihnen zusammen denken, werde sie zitieren, zwischendrin, lose übersetzt, ohne strenge Seitenangaben, denn „auch wenn manche Zitate wie direkte Quellen aussehen, sind alle Dinge in Wahrheit indirekte Quellen“.
Die Filter der Erfahrung

The Souvenir, das sind filmische Memoiren, ein Porträt der Künstlerin Joanna Hogg als junge Frau Julie. In den 1980ern ist Julie (Honor Swinton Byrne) auf der Filmschule, ringt mit sich, ihrer sozialen Position, ihrer Sicht auf die Dinge und der Frage, wie sich diese Sicht in Kunst ausdrücken ließe. Dann tritt Anthony (Tom Burke) in ihr Leben und schnappt es sich, schenkt und verlangt Aufmerksamkeit, klärt die Sache mit der Sicht auf die Dinge und der Kunst und landet tiefer in einem Drogensumpf, den Julie erst sieht, als Anthony das mit dem eigenen Schopf schon längst nicht mehr schaffen kann. Eine toxische Beziehung, if there ever was one.
Trotz aller Achtziger-Marker: Die Vergangenheit steckt in der Form. Im körnigen Bild, aber vor allem in dieser intimen Distanz, aus der hier alles betrachtet wird. Vor meinen Augen läuft eine Handlung ab, aber sie fühlt sich wie ein vergehendes, nein: ein vergangenes, nein: ein in der Vergangenheit vergehendes Leben an. Julie und ihre Ereignisse, verstellt durch einen Schleier der Erinnerung, von dem ich nicht weiß, wie Joanna Hogg ihn ins oder übers oder vors Bild bekommen hat. Da ist nichts offensichtlich verschwommen, da spricht kein Voice-over aus der Zukunft, da gibt es keine Rückblenden.

Und doch ist der Schleier da. Er steckt in der melancholisch sprunghaften Montage, im Set Design (Hogg hat die eigene Studi-Wohnung aus der Erinnerung rekonstruiert), er steckt in den nicht ganz zugänglichen Figuren selbst, diesen wunderbaren Fremd-Körpern. Ähnlich wie in der Literatur Annie Ernaux staunt eine Künstlerin über sich selbst als junge Frau, spielt das eigene Leben nochmals vor dem inneren Auge ab, und dieser reife Rück-Blick auf die eigene Unreife braucht keine Rückblenden, um zu gestehen: Hier arbeitet kein Film an einer Handlung, sondern eine Erinnerung an einem Film.
Gar keine Schleier dagegen in Babyteeth: krass scharf gestellte Momentaufnahme der letzten Momentaufnahmen eines Lebens. Unversehens im Kino gelandet, bin ich zunächst schnell ermattet vom Ton des Films, dem ausgestellt Bizarren, dem Exzentrischen, dem Humor. Zwei schräge Vögel lernen sich kennen, auf dem Bahnsteig, die zur Ablenkung brav gekleidete Milla (Eliza Scanlen) auf dem Weg zur Orchesterprobe, der tätowierte Rumtreiber Moses (Toby Wallace) mit dem offenen Hemd und dem offensichtlichen Drogenproblem. „Golden Brown“ als Streicherversion, so ging der Film ja schon los. Jetzt legt Moses Milla aufs Kreuz, der Übergriff entpuppt sich als Hilfestellung beim Nasenbluten. Ganz schön ausgeflippt, jaja, crazy in love und Coming-of-Age, gegen die Eltern, die das alles nicht so gut finden. Ein bisschen nervig finde ich das erst.

Bis auf einmal das Wort „Chemo“ in einer dieser sich in bunten Lettern über die Establishing Shots legenden Kapitelüberschriften landet, ansonsten aber weiter alles munter über die Leinwand flirrt und man allmählich versteht: Das Leben ist bizarr und exzentrisch, wenn ihm die Dauer abhandenkommt, wenn es um keinen Lebensplan mehr geht, wenn man, aus Millas Sicht, aufs Leben drängt und alles andere verdrängt, wenn man, aus Sicht der Eltern, der Tochter noch ein paar schöne Momente bescheren will. Und wenn sie happy ist mit diesem komischen Moses, dann lässt man ihn eben ein ins Haus.
Auch hier steckt die Stimmung in der Form, der Krebs in den Bildern selbst: Alles ist aufgeladen im Ausnahmezustand mit absehbarem Ausgang, irgendwie over the top, zum Schreien (komisch), völlig Panne. Von der Intensität des Moments zu reden ist ausnahmsweise mal keine Plattitüde; es ist ein Wahrnehmungsmodus, nach dem man nicht gefragt hatte, der nun aber alles bestimmt. Babyteeth ist Punk, weil schlicht No Future! Ein Film der kurzen Frist. Es geht dabei um mehr als nur jugendlichen Lebenshunger, um ein Schicksal, das besiegelt ist und es deshalb nochmal wissen will. Denn die Nahtodstimmung umfasst alle Figuren, auch die Mutter auf ihren Anti-Depressiva, auch den Vater mit seiner „neuartigen Verlegenheitsmännlichkeit“. Alle leben sie, notwendigerweise, im Moment.
Der Schleier der Erinnerung, die Intensität der kurzen Frist, das sind Filter. Sie baden das, was passiert, im Leben wie auf der Leinwand, in eine bestimmte Wahrnehmungsform, ganz wie bei Instagram. Sie führen ihre Filme damit auf eine Reise, „von der irreduziblen Spezifität des Subjekts zu den Mitteln, durch die das Sinnliche innerhalb einer kollektiv gelebten Situation allgemein wird“, wie es bei Berlant heißt.

Das New York Times-Kritiker A.O. Scott fiel in seinem schönen Text zu The Souvenir ein Paradox auf: „ein Film, der sich anfühlt, als sei er nur für dich gemacht worden, und zugleich so persönlich daherkommt, als sei er none of your business.“ Tatsächlich sind beide Filme einerseits radikal subjektiv, nicht anders zu denken als filmische Aufzeichnungen einer sehr persönlichen Erfahrung. Doch steckt gerade dieses Singuläre in einem Allgemeinen, in etwas Teilbarem, etwas Unpersönlichem.
Das Unpersönliche und die gewöhnlichen Affekte
Das Private sei politisch, hieß es irgendwann in den 1960ern, und kaum eine Intervention ins politische Denken war folgenreicher, kaum eine war bitterer nötig. Ihr verdanken sich nicht nur kulturelle und materielle Fortschritte in Sachen sozialer Gerechtigkeit. Mit dieser Losung ging auch eine Ausweitung des Begriffs des Politischen einher, und eine neue Sprache, um über soziale Hierarchien zu sprechen, eine Sprache, die auch diejenigen dazu ermutigte, sie zu benutzen, die zu häufig nur Besprochene statt Sprechende gewesen waren. In der unsäglich verkürzten Feuilleton-Debatte um „Identitätspolitik“ diesen Sommer tauchte immer wieder der Vorwurf auf, diese Sprache sei selbst unpolitisch, lenke ab von den wichtigen Dingen, erginge sich in bloßer Selbstbeschau, würde zu einer Privatisierung des Politischen führen statt zu einer Politisierung des Privaten.

Diese Gefahr ist real, denn jene sozialen Identitäten, die endlich offen artikuliert werden, sind zugleich Sprachrohr und Gefängnis. Als „Alphabetisierungsprogramm im Schmerz“ verleihen sie munter Stimmen, machen die Menschen aber auch generisch: „Sie werden zu Arten von Leuten, die an jenen Identitäten hängen, von denen sie organisiert werden, die sie aber zugleich unterbestimmen.“ Es ist diese Unterbestimmung, die das Problem der Identitätspolitik wird, wenn sie diese Identitäten fetischisiert, und es ist diese Unterbestimmung, an der eine (Film-)Kritik leidet, die da mitmacht, wenn sie, wie es bei Berlant und Stewart heißt, „einfach nur die Welt anblafft, als würde man nur leben und denken, um sie bei einer weiteren Lüge zu ertappen.“
Wenn ich mit diesen beiden Denkerinnen dagegen die Begriffe des Unpersönlichen und der gewöhnlichen Affekte ins Spiel bringe, dann nicht, um die Losung des politischen Privaten wieder umzukehren, sondern um sie weiterzudenken.
Das Unpersönliche, wie Lauren Berlant es versteht, oder wie ich es bei ihr verstehe, bringt auf den Begriff, dass das, was uns am Privatesten erscheint, also auch gerade das, was nicht in der Sprache der Identität zu formulieren ist, immer Teil an einem größeren Ganzen hat. Dass man selbst dort, wo man glaubt, sein Innerstes nach außen zu kehren, nichts anderes als Außen findet. „Das Unpersönliche ist nicht das Gegenteil des Persönlichen – als ‚Struktur‘ oder ‚Macht‘ –, sondern eine seiner Bedingungen.“

Diese Bedingungen sind nicht zuletzt affektive Bedingungen, sie werden weniger gedacht, als dass sie sich anfühlen. Das ist, was Kathleen Stewart die „gewöhnlichen Affekte“ nennt: „Strukturen wachsen in ihren Verwurzelungen, Identitäten nehmen Platz, Wege des Wissens werden mir nichts, dir nichts zu Gewohnheiten. Aber die gewöhnlichen Affekte geben den Dingen die Eigenschaft eines Etwas, das bewohnt und beseelt werden kann.“ Aus ihnen bestehen die Filter unserer Welt. Wenn das Kino uns diese Filter wahrnehmen lässt, dann steckt in ihm auch das Versprechen, „politische Subjektivität in Beziehung zu den so wirren wie vorhersehbaren Dynamiken der Welt zu setzen“.
Wider das Naturell
Vorhersehbare Dynamiken wie das Coming-of-Age-Topos vielleicht, dem in Babyteeth der Tod ein Schnippchen schlägt, weil dem Coming-of-Age das „Age“ abhandenkommt. Eine politische Subjektivität vielleicht, die sich der Rolle des sterbenden Mädchens verweigert, das die Love Story-Tradition Milla angedeihen will. Oder eine, die sich, aus dem Heute, diffus an eine Zeit erinnert, in der die Filmschule mehr noch als heute eine Männerwelt war. The Souvenir beginnt mit Julies Filmprojekt, dann übernimmt mit Anthony eine unmögliche, deshalb auch kräftezehrende Liebe, an der Julie festhält, weil es sich nach einem Etwas anfühlt, das bewohnt werden muss. Außerdem die gewöhnlichen Affekte der Drogen: Die Männer in beiden Filmen sind nicht toxisch, sondern abhängig.

Vor allem aber sind diese Filme dem Politischen, wie es in Stewarts und Berlants Schriften auftaucht, so nah, weil sie sich nicht um das Individuum und seine wahren Gefühle drehen, die wir für eine Weile mal mitfühlen dürfen. Da wird nicht einfach ein Selbst behauptet, das gesucht, gefunden oder verwirklicht wird, sondern diese Suche und dieses Begehren nach Verwirklichung in Szene gesetzt. In seiner Times-Kritik beobachtet Scott, wie Julies Naturell zwischen Entschlossenheit und Passivität changiert, aber es gibt in diesen Filmen eben kein Naturell. Figuren sind hier nicht das filmische Äquivalent von Persönlichkeiten, sondern Avatare des Begehrens, Person sein zu wollen. Und das Selbst ist nicht einfach ein Selbst, sondern „eine Sammlung von Routen und Kreisläufen. Da draußen auf sich allein gestellt, sucht es Szenen und kleine Welten auf, um sich ins Dasein zu stupsen. Es will jemand sein. Es versucht, lockerer zu werden, sich zu befreien, zu lernen, es selbst zu sein, sich selbst zu verlieren.“
The Souvenir und Babyteeth kreisen um diesen Versuch, ohne ihn gelingen oder scheitern zu lassen. Durch ihre Filter hindurch – durch den Schleier der Erinnerung, durch die Intensität der kurzen Frist – nähern sie sich den gewöhnlichen Affekten, „das, was die Resonanz in den Dingen anhäuft, durch die Klischees des Selbst, der Agency, der Heimat, des Lebens fließt, in einem Traum auftaucht, mitten in einer Entgleisung auftaucht, oder in einer einfachen Pause“.
Um dann doch nochmal auf die großen Identitäten zu kommen: Dass beide Filme von Frauen gemacht wurden, scheint mir kein Zufall. Nicht unbedingt, weil es hier um „weibliche Erfahrung“ ginge, sondern weil ihnen das Phallische abgeht, das in manchen Affekttheorien des Kinos zutage tritt. In denen der Affekt eben nichts Gewöhnliches mehr ist, sondern das große Andere, das Erhabene. Hier dagegen scheint das Affektive eine sehr irdische Welt zu sein, eine Welt, in der sich „die Lebensbedingungen eintragen, die zwischen Personen und Welten zirkulieren, in gelebter Zeit sich abspielen, Bindungen unter Strom setzen“.

The Souvenir vergegenwärtigt die Vergangenheit, Babyteeth ist in der Gegenwart eingesperrt. In beiden Filmen macht der Ton die Musik. Die affektive Modellierung des Erzählten, das, was über die singuläre Geschichte hinausgeht, ist es, was diese Filme an mich bindet, was sie unpersönlich macht, und damit auch politisiert. Ein letztes Mal Berlant: „Inmitten des ganzen Chaos, der Krise, der Ungerechtigkeit vor unseren Augen ist das Begehren nach alternativen Filtern, die ein Gefühl einer erträglicheren und intimeren Vergesellschaftung herstellen, ein anderer Name für das Begehren nach dem Politischen.“
Benutzte Werke:
Kathleen Stewart: Ordinary Affects.
Lauren Berlant: Cruel Optimism.
Lauren Berlant/Kathleen Stewart: The Hundreds.
Girish Shambu: The New Cinephilia.
Dieser Text ist eine überarbeitete Fassung des Essays Politische Cinephilie (III): Die Filter der Wahrnehmung, der am 19.10.2020 im Filmdienst erschien.












Kommentare zu „Die Filter der Wahrnehmung, oder: Nichts persönlich nehmen!“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.