Die besten Filme und schönsten Kinomomente 2023
Kino, das ist der Wind in Til Schweigers Haar, Keanu Reeves’sche Äugelein, die dem nächsten Kampfsport-Potentat ins Gesicht schauen, oder auch wenn man Drogenkartell-Rituale am eigenen Wohnort zu entdecken glaubt. Critic.de-Autor*innen lassen das Filmjahr Revue passieren.
300 Stufen

Die ungefähr 300 Stufen, die in Paris auf den Montmartre führen, sind ein Bild für sich. Heißt: Für das innerliche „Uff, das auch noch“ müsste dort zweieinhalb Stunden nach Filmbeginn auch kein großes Geschläger (oder, um gleich im richtigen Bild zu sein, keine Lawine schusswaffenbewaffneter Killerkommandos) mehr losgetreten werden. Kennt man vielleicht: Man steht vor solchen Himmelsstiegen, hat schon den ein oder anderen Tretmeter im Knie … „Ja, lohnt sich das jetzt noch?“ – Der touristische Grundfrust. Die Szene, die sich auf diesem Anstieg in John Wick: Kapitel 4 entspinnt, ist dann trotzdem ganz und gar super; obwohl es sie längst nicht mehr braucht und – needless to say – gerade deshalb natürlich. Unter Zeitdruck muss Wick (Keanu Reeves: Mittelscheitel, müde, Maßanzug) da rauf. Von oben kommen die Soldaten der quasivatikanischen Autokratenelite gepoltert. Ein riesiges und schmerzhaftes Rauf und Runter ist die Folge. Die Stufen, die er sich erkämpft, schottert Wick zugleich wieder in Richtung Innenstadt – kugelnabfeuernd, -abwehrend, -abbekommend. Währenddessen geht über Paris die Sonne auf. Das Ganze wirkt, als hätte eine Künstliche Intelligenz die Grimmigkeit eines russischen Kopfgeld-Syndikats mit der Bilderwelt von Woody Allen zusammengerechnet. Oben angekommen ist freilich auch nicht viel gewonnen. Dort kucken die Reeves’schen Äugelein dann dem nächsten Kampfsport-Potentat ins Gesicht – schwach und mürrisch und dunkel. Und tiefliegend freundlich.
Lukas Stern
Bitte mehr Genrekino dieser Art

Was vom Jahr bleibt? Neben erwartbaren Auteur-Großtaten von Petzold, Hong, Breillat und Co. auch zwei betont kleine, harte, weniger besprochene Horrorfilme aus den USA, die einen von der ersten Minute an in ihre Welt hineinsaugen – und dabei auch so manches über ihre Zeit (ob nun clever oder eher nicht) erzählen:
Beim in der Pandemiezeit mit kleinstem Stab inszenierten Slasher Sick entwirft der B-Movie-VoD-Spezialist John Hyams (in den letzten Jahren u. a. für zwei tolle Teile der Universal-Soldier-Reihe sowie für den Survival-Horrorfilm Alone (2020) verantwortlich) ein sich auf engstem Raum filigran auffächerndes Szenario, in dem alle Covid-Schutzmasken tragen, aber manche es primär deshalb tun, um unerkannt Millennials abzuschlachten. Los geht’s mit einem unheilvoll blutigen Intro auf dem Unicampus, danach dann, als hätte das eine mit dem anderen nichts zu tun, mit Slackerszenen der Entschleunigung in einem obszön opulenten Designerholzhaus am See. Ein Ort, der für zwei ungleiche Freundinnen (toll vor allem: Gideon Adlon) aber nur kurz als Social-Distancing-Aussteiger-Idylle taugt.
Wie bereits in seinen früheren Filmen versteht es Hyams wie kaum ein zweiter im gegenwärtigen Genrekino, komplizierte Filmräume zu entwerfen, ihre Besonderheiten bis ins Kleinste durchzuexerzieren, aber ohne es kunststückhaft wirken zu lassen. Präzise Schärfeverlagerungen ziehen immer neue Ebenen in den Parcour durchs Haus ein, bei dem die Heldinnen vor den Home-Invadern um ihr Leben rennen, springen und treten. Einschübe von Social Media hier mal nicht als Staffage oder als modisches Gimmick, sondern als integraler Bestandteil der Slasherdramaturgie, die sich in ihrer Gradlinigkeit wie ein Vertreter der 1980er bis 90er anfühlt (das Drehbuch stammt übrigens vom Scream-Autor Kevin Williamson). Und: wohldosierte 83 Minuten Laufzeit – bitte mehr Genrekino dieser Art.
Die sprunghafte Bildwelt von Robbie Banfitchs Found-Footage-Horror The Outwaters ist das Gegenteil des Genreklassizismus, den man bei Sick antrifft. Sie ist konstant wackelig, hyperaktiv und voll lässig formloser Alltäglichkeit – bis eben der Ausflug vierer Freunde in der Mojave-Wüste Kaliforniens zu einem zeit- und raumenthobenen Albtraum wird. Auch hier wieder die Landflucht als Motiv, das wenig Gutes birgt: Eigentlich wollte die Gruppe bloß ein angekitscht zeitgeistiges Folkpop-Musikvideo vor Naturkulisse drehen, im Zuge dessen auch etwas Wüstenromantik und die ein oder andere Field-Recording-Session mitnehmen. Doch irgendwas ist da draußen … In der Nacht donnert es unentwegt, ohne dass je ein Blitz am Himmel zu sehen wäre. Auf einmal öffnet sich etwas. Alles ist nun anders. Es gibt kein Oben und Unten, Gestern und Heute, Ich und Es mehr. Gut eine Stunde – der Weg dahin hätte wiederum gut 15 bis 20 Minuten kürzer sein können – einfach irre Leindwandpsychedelik. Spätestens ab hier ist es der radikalere (und weniger „wertige“) Experimenthorrorfilm als Skinamarink. Das Blair-Witch-Project-Handkamera-Prinzip wird dabei nicht gerade revolutioniert, aber lange nicht mehr so einen durchs Subjekt gefilterten Schrecken gesehen. Hat wohl auch fast nichts gekostet. Regieproduzent Banfitch, der u. a. auch Drehbuch, Schnitt und Kamera beisteuerte, spielt gleich noch die Hauptrolle selbst.
Tilman Schumacher
In der Pause geht’s vergnügt zu im Kartell
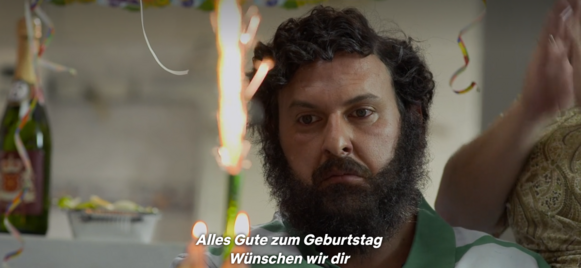
Mein Interesse an Drogenkartellserien begann mit jovialen Varianten: Undercover (Belgien, seit 2019) und Narco-Saints (Südkorea 2022). 4 Blocks (Berlin 2017–2019) war deutlich heftiger und super. Die lateinamerikanischen Serien rund um „Narcos“ aber leuchten noch stärker.
Actionreiche Pracht. Tiefe, denk- und fragwürdige, vielfältig glamouröse Charaktere. Merk- und fragwürdige Männergestalten. Der selbstquälerisch ernste, latent traurige Kartellchef Felix (Diego Luna) vs. der heftig traurige, korrupte Polizist (Luis Gerardo Méndez) in Narcos: Mexiko (USA 2018–2021). Der animalisch warme, grüblerische Escobar in Narcos (USA 2015–2017) (hier singt sein Darsteller Wagner Moura „Tuyo“, das schöne Titellied). Der knuffig-stoische „El Chapo“ (Marco de la O) in seiner stylishen Häftlingskleidung, in der er aussieht wie ein Bärentierchen oder wie die Mohnraupe, die ihm im Knast Gesellschaft leistet (El Chapo, USA 2017–2018). Der fuchsartige Sicario Chili (Anderson Ballesteros), der seinen besessenen „Patrón del Mal“ (grandios als Escobar: Andrés Parra) rückhaltlos begeistert anlacht, wenn der besonders grausam ist (Pablo Escobar – El Patrón del Mal, Kolumbien 2012).
Sie haben fast immer eine Wahl, aber sie wollen=müssen mit allen Mitteln weiter mitmischen, sich durchsetzen und immer mächtiger werden. Sie verteidigen das blendend: Wahrhaft schuld sind die Umstände, und die sind Schuld der Feinde. Sie wissen, dass sie so in ihren Untergang segeln. Aber wenn Kollegen oder Familie sie um Mäßigung bitten, spricht „El Patrón del Mal“ für sich und seinesgleichen: „Ich darf mir nichts gefallen lassen. Das ist ein Krieg. Meine Gegner vernichten mich, wenn ich sie nicht vernichte, und ich tue das nie ohne Warnung. Ihr seht das anders, weil ihr anders seid. Das ist okay, ich möchte euch nicht ändern. Also lasst mich auch so wie ich bin. Jeder stirbt am Ende.“
Die Leichen der geschäftestörenden Gegenspieler, Journalisten und Politiker baumeln mit Warnplakaten von den Brücken. Doch der Patrón del Mal liest zu Hause seinen Kindern Pferdegeschichten vor und wiehert voller Charme. Auch sonst geht es während der Pausen in den Kartellen durchaus vergnügt zu. Sie haben zum Beispiel die Eigenart, nach dem Popeln oder dem – gerne gemeinsamen – Pinkeln ihren Kumpels die schmutzige Hand durchs Haar oder Gesicht zu reiben und sich dann wie Kinder zu beömmeln. Sie sind wie diese bemalten antiken Theatermasken, die man dreht, und dann ist auf der anderen Seite ein völlig anderes Gesicht. Sie wissen das, können den Widerspruch aber auch nicht auflösen und leben irgendwie damit.
Ich wurde beim Zuschauen so, wie es die weisen Bücher empfehlen: Ich urteilte nicht mehr. Nicht mit Schmackes. Ich sah die vielen gleichzeitigen Verflechtungen und wie jede Aktion sich auf das Ganze auswirkt, Reaktionen provoziert. Welche immense innere Spannung sich so generiert und entlädt. Schon in den einfachen Soaps mit Antihelden wie J. R. in Dallas (1978–1991) oder Ansgar von Lahnstein in Verbotene Liebe (1995–2015) ist das so. Doch Narcos & Co. steigern das ins ungeahnt Komplexe. Unendliche Zusammenhänge. Manche vergleichen es mit Shakespeare.
Wenn ich jetzt durch meinen Wohnort nahe der holländischen Grenze fahre, fallen mir Dinge auf, die ich früher nicht beachtet habe. Warum gibt es in den zerrupften Bezirken voller Leerstände einen Luftballonladen oder auch einen mit „Cold drinks to go“, wo Leute ein- und ausgehen, doch nie mit Luftballons oder Getränken? Warum treffen sich Jugendliche spätabends vor dem Fußballstadion des VFR Übach-Palenberg unter Straßenlampen, wo SUVs langsam heranfahren, mit Männern, die ernst wie Fensterkatzen rausschauen? Die Filme drehen sich weiter.
Silvia Szymanski
Eine sehr fruchtbare Beziehung

Im Winter 2005 war ich mit einem Freund drei Wochen in Andalusien. In Malaga wurden wir mit einem nächtlichen Autokorso empfangen. In Cordoba liefen wir über Straßen voller Mandarinen, die saisonbedingt von den Bäumen gefallen waren und zu Matsch getreten wurden. In Sevilla hörten wir einen Panflötenspieler an einem zentralen Touristenort alle halbe Stunde Conquest of Paradise anstimmen, während wir in der Sonne faulenzten. Impression jagte Impression. Am präsentesten blieb aber der Kinobesuch danach. Vor Ort hatten wir uns das Meer angeschaut, die ganzen Kirchen, die nach der Reconquista direkt in Moscheen hereingebaut worden waren usw. usf., aber keine Leinwände und kaum Bildschirme. Nach unserer Wiederkehr gingen wir ins Kino und schauten Ray. Dieser startet mit einer Montage aus Mikros, Pianotasten und Fingern. Ein Song beginnt. Bis heute sehe ich das Becken vor mir, das nach einem Einschlag nicht mehr stillsteht. Es war atemberaubend. Als ob ich das Kino das erste Mal erlebte.
2023 habe ich sehr viele Filme gesehen, einige sogar im Kino. Einer davon – und es war wahrscheinlich der schönste – war Steven Spielbergs The Fabelmans. Daran sitzt ein Kind erstmals im Kino und ist von einem Zugunglück völlig überwältigt. Ein Leben findet daraufhin seine Schienen, auf denen es verlaufen wird. Anders als Ray wurden meine Erinnerungen aber recht schnell diesig. Ich hatte einen sensationellen Film gesehen, aber keinem Erlebnis beigewohnt. Meine siebenjährige Tochter geht seit der Wiederöffnung nach den Corona-Lockdowns inzwischen auch regelmäßig ins Kino. Für sie war dieses Jahr die größte Überraschung, als sie mit Freunden ging, wie weit hinten die ihre Plätze aussuchten, während sie doch am liebsten in der ersten Reihe sitzt. Ihr größter Aha-Effekt lag darin, dass es andere Routinen gab als die ihre.
Der biografische Zufall, dass mir Bilder aus Ray präsenter sind als von einem Film, der mir jetzt schon mehr bedeutet, ist sicherlich schade, auch das meine Tochter nicht mehr vollkommen hin und weg ist nach einem Kinogang. Die tolle Seite daran ist aber, dass ich viele schönste Momente im Filmjahr 2023 habe. Nicht nur, weil ich viele Filme mochte, die ich sah, sondern auch weil im Kino Filme rissen, Leute sich komisch benahmen, ich danach Unterhaltungen Fremder belauschte (und schnell das Weite suchte), einer Kinoangestellten half, die Schärfe zu justieren, weil sie es von oben nicht sah. Und vielleicht ist es 2023 schon anachronistisch, aber ich bin immer noch froh, dass die Kinos wieder offen sind und es all diese Impressionen gibt, die sich mit dem Film verbandeln. Mehr als wenn ich nur zu Hause schaue. Statt mit einer frischen Liebe befinde ich mich in einer sehr fruchtbaren Beziehung, sozusagen.
Robert Wagner
Nicht loskommen vom Kino

Ein Abend in Nürnberg im Frühjahr. Ende März genauer gesagt, am Starttag des neuen Til-Schweiger-Films Manta Manta – Zwoter Teil. Als kleine Gruppe von Schweiger-Fans oder zumindest Schweiger-Faszinierter machen wir uns auf, das lang erwartete, auf Facebook mit diversen Vorab-Lorbeeren geschmückte Sequel des Kultfilms aller Kultfilme in Augenschein zu nehmen. Als wir das Kino betreten, laufen wir an ein paar Typen vorbei, die sich zur Ehre des Tages in eine historische Vokuhila-Jeansjacken-Montur geworfen haben. So weit ist keiner von uns gegangen. Vielleicht ein Fehler.
Der Film selbst ist ganz gut, glaube ich. Schwer zu sagen, wie gut genau, die Wellen des Enthusiasmus, die beidseitig neben mir an- und nur selten wieder abschwellen, lassen eine kritisch-nüchterne Würdigung nicht zu. Auch Schweigers Absturz in die Skandalschlagzeilen ist noch in weiter Ferne. Dieser Abend gehört dem Bilderexzess. Wie authentisch dieser Exzess ist, ist absolut zweitrangig. Eine ironische Filmrezeption, so etwas gibt es gar nicht, glaube ich. Oder vielleicht andersherum: Jede Filmrezeption ist ironisch, weil wir eh keinen kognitiven Zugang zu unserem authentischen Erleben haben. Also bleibt uns im Kino nur eine Möglichkeit: Genieße den Moment, ganz egal, wie er zustande kommt. Das Kino, das ist der Wind in Til Schweigers Haar.
Auf dem Rückweg schweben wir auf Wolken. Der Enthusiastischste von uns erzählt den Film mit vor Begeisterung sich überschlagender Stimme wieder und wieder nach und verlängert damit den Ausnahmezustand. Wir schauen dann später noch einen ziemlich verrückten Harald-Reinl-Film (Sie liebten sich nur einen Sommer), in dem eine fiese Krankheit einer jungen Liebe mit Hitchcock’scher Präzision den Garaus macht. Warum ich immer noch nicht loskomme vom Kino, frage ich mich manchmal. Wegen Abenden wie diesem, in Nürnberg im Frühjahr.
Lukas Foerster
Ein neuer Ort
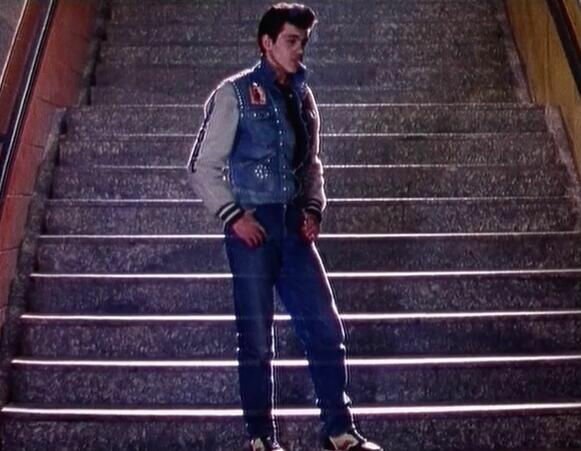
Das türkische Wort „Sinema“ prangt in großen Lettern auf dem weißen Beton über dem Eingang, mehr nicht. An der schweren Metalltür muss man ziehen, dann eröffnet sich das Foyer, das so spärlich gehalten wie charmant eingerichtet ist. Ein paar Tischchen wie in einem Café, eine Theke mit den Klassikern der alkoholischen Bardrinks – Bier, Wein, Gin Tonic, Aperol Spritz – und ein paar Limos, der Rest ist Industrieromantik und jede Menge Platz. Zum Stehen und Sitzen, zum Abhängen, zum Warten aufs Kino, zum Reden nach dem Film.
Mehr als nur Durchgangsort für die Snackversorgung soll dieses Kinofoyer sein, so wie überhaupt das Sinema Transtopia, das Anfang diesen Jahres seine neuen Räumlichkeiten im Berliner Wedding eröffnen konnte, sich auf die Fahnen geschrieben hat, Kino anders zu denken: weniger von der großen Kunst als von der sozialen Praxis her, eher als Ort der Begegnung, auch mit anderen Menschen, denn als Mittel zur eigenen Unterhaltung in Begleitung von ohnehin schon Bekannten, weniger Geschäftsmodell als Kulturprojekt. Dafür benötigen die Leiter*innen Can Sungu und Malve Lippmann Unterstützung von Bund und Senat, und es brauchte nur einen Regierungswechsel und die Revision eines Fördertopfes, um die prekären Strukturen offenzulegen, auf denen ein solches Projekt fußt.
Was das Sinema Transtopia jenseits der Versprechen eines „anderen Kinos“, die immer auch Distinktionsressourcen in einem umkämpften kulturellen Feld in Berlin sind, vor allem ausmacht, das sind die großartig kuratierten Reihen, in denen das marginalisierte und transnationale Kino das letzte Wort hat, Filme also, die zwischen den Stühlen stehen, weil sie in der Filmkultur ihres Herkunftslandes ein Nischendasein fristen oder erst gar nicht einem solchen Herkunftsland zuzuordnen sind. Migrationskino in Europa, Randständiges aus China, ostasiatische Queerness, vorrevolutionäres Kino aus dem Iran, armenische Filme über den Völkermord und vieles mehr.
Themenfilme, könnte man meinen. Aber was ich in den besten Abenden im Transtopia erlebt habe – bei Hans A. Guttners Im Niemandsland (1983) etwa, einem Dokumentarfilm über Gastarbeiterkids in München, die sich als Elvis und James Dean stilisieren und ihre eigene Subkultur erschaffen; bei der Preview von Alice Diops Saint Omer (2022); bei Korhan Yurtsevers wahnsinnigem und jahrzehntelang verbotenem Kara Kafa (1979), einem politisch grandios didaktischen Melodram über eine türkische Ehe in Deutschland; bei Naceur Ktaris The Ambassadors (Les ambassadeurs, 1976), einem vergessenen Film über antialgerischen Rassismus in Frankreich, dessen Fernsehausstrahlung heftige Reaktionen hervorrief –, könnte nicht weiter entfernt sein von drögen Politabenden, bei denen Filme nur beliebige Illustrationen dieser oder jener Phänomene und Konflikte sein dürfen.
Die Erfahrung ist nämlich viel direkter, viel filmischer. Es ist häufig weniger eine ästhetische als eine politische Dringlichkeit, die aus diesen Filmen spricht, aber vielleicht sind es eben Dringlichkeiten aller Art, die einen guten Film ausmachen; dass da jemand etwas unbedingt in bewegten Bildern ausdrücken wollte und es mithilfe einer Vielzahl von Mitstreiter*innen dann auch getan hat, so prekär, so unbeholfen, so unpoliert auch immer.
Im Transtopia sitzend, auf zugegeben nicht für jede Filmlänge geeigneten Sitzgelegenheiten, zwischen Leuten sehr unterschiedlicher Milieus (Nachbarschaft, Leute aus den von den jeweiligen Filmreihen angesprochenen Communitys, Kunst- und Kulturleute, Filmfreaks, Hineingestolperte, kurz: das transnationale Berlin), scheint mir jene unmittelbare und affektive Beziehung zwischen Bildern und Publikum sich einzustellen, von denen die Besucher*innen cinephiler Genrefilm-Festivals so gern berichten. Es gibt da eine Spannung beim Gucken, einen erhöhten Aufmerksamkeitsgrad, was wohl vor allem damit zu tun hat, dass diese Bilder, dass diese Filme teilweise erst mühsam gefunden und geborgen werden mussten, damit überhaupt jemand sie sehen kann. Kino ist hier immer auch Arbeit im und am Archiv, und das führt zu einer anderen Wertschätzung. Man hat den Eindruck, noch im eigenen Wahrnehmungsakt an der Bergung dieser Schätze teilzuhaben.
Und dann hat man Redebedarf, und auch wenn es manchmal zäh losgeht, entwickelt sich mit der Zeit doch meist ein Gespräch, das viel produktiver ist als die heruntergespulten Q&As manch anderer Spielstätten und Festivals. Dann wird manchmal gesprochen, bis wirklich alle sich nach ihrem Bett oder dem Gin Tonic an der Bar sehnen.
Irgendwie geht das also tatsächlich auf, Kino als Raum der Begegnung, irgendwie überträgt sich da was von der Leinwand in der Industriehalle auf ein offenes, wissbegieriges Publikum. Wie gut also, dass die Existenz des Sinema Transtopia erstmal wieder gesichert ist. Ich habe vielleicht nicht den besten Film des Jahres hier gesehen, aber ich sehe Filme anders hier, und manchmal auch besser.
Till Kadritzke
After-Party

Ein guter Freund erzählte mir neulich, wie sehr er mit seinen cinephilen Freund*innen hadere, zwar verbringe er immer wieder gerne ein paar Tage mit ihnen, aber bald schon erschöpfte sich der Austausch, weil diese Menschen nur das Kino im Kopf hätten. Was ihn von diesen Freund*innen unterscheide: dass er, vor die Wahl gestellt zwischen einer Party und einem Film, sich immer für die Party entscheiden würde. Spontan habe ich ihm zugestimmt, auch weil 2023 für mich das Jahr der Rückkehr von Partys und Geselligkeit war. Das Zelebrieren der Gemeinschaft, die in meinen Freundeskreisen dann doch oft auch mit Kino zu tun hat, auch weil wir uns diese Gemeinschaft im Kino oft nur noch imaginieren können. Das Teilen der Erfahrung ist für mich jedenfalls noch wichtiger geworden, gerade weil ich in diesem Jahr dank Sabbatical von meiner Festivalarbeit (beruflich) so wenige Filme wie seit Jahren nicht gesehen habe, und die (private) Lust aufs Kino umso stärker zurückkam.
Und so waren für mich die eindrücklichsten Kinomomente zwei soziale Ereignisse, die mit Rahmungen zu tun hatten: Beim Festival Afrikamera im vollen Kino Arsenal saß ich neben einem meiner engsten Freunde und während der langen Begrüßungsreden durch Partner*innen, Förder*innen und Veranstalter*innen quatschten wir ab und an (sorry). Als der Film dann endlich losging, drehte sich ein jüngerer Mann vor uns zu mir um und drohte mit einer Schlägerei, falls wir auch während des Films reden würden. Ich wollte ihm den Spaß nicht verderben, aber für mich hätte der Film sehr viel gewonnen dadurch, ein bisschen zwischendrin analysieren zu können, das Gemeinsame zu artikulieren. Das Kino als stille Ehrerbietung, gerade bei Afrikamera, schien mir eine völlig deplatzierte Forderung, der ich mich dennoch beugte. Mir bleibt dieser Augenblick in Erinnerung, weil er mir vor Augen geführt hat, wie stark es doch auf die (heimlichen) Verabredungen zwischen den Zuschauer*innen ankommt, an den Orten, an denen wir ins Kino gehen.
Wenige Wochen zuvor war ich mehrmals mit Vergnügen beim Pornfilmfestival, etwa bei einem Vortrag und bei einem chilenischen Kurzfilmprogramm (Grüße bei dieser Gelegenheit an die Kollegin, die mir entschuldigend zuflüsterte, sie begleite hier nur jemanden). Es mag albern klingen und ich verstehe alle, die in anderer Stimmung sind, aber das Erlebnis, dort in heller Aufregung Filme zu gucken, die überwiegend nicht-explizit aber dafür mit fantastischen Einfällen neue ästhetische erotische Experimente wagen, hat mich nachhaltig glücklich gemacht. Auch und gerade, weil es in den Gesichtern der Menschen ablesbar war, dass es ihnen nicht egal war, hier gerade in Gemeinschaft zu sein. Es wurde gejohlt, gelacht, applaudiert und sich immer wieder die Augen gerieben. Und auch die Leute, die offensichtlich mit ihrer Scham zu kämpfen hatten, sich die Augen zuhielten oder hinter den Sesseln versteckten, sie haben alle zum gemeinsamen Erlebnis beigetragen. Und nach dem Kino gingen wir direkt auf eine Party.
Frédéric Jaeger
Auf dem warmen Asphalt der Piazza Maggiore

Umziehen, Ausleben, Urlaub. Zum ersten Mal Italien, zum ersten Mal Il Cinema Ritrovato. Am Abend auf dem Piazza Maggiore sich in die hinteren Reihen oder auf den noch warmen Asphalt neben der Basilika San Petronio setzen, zwischen Menschen, die sich zufällig, voller Vorfreude oder angelockt durch die Menge gefunden haben und nun mit mir zusammen Stella Dallas (1925), Black Narcissus (1947), The Straight Story (1999) und The Dreamers (2003) gucken. Manche bleiben sitzen, manchen stehen auf, und andere nehmen ihre Plätze ein.
Neben mir erklärt ein 50-jähiger Mann seinem Date auf Italienisch, was Intertitles sind, und sie nickt und schaut auf ihr Handy und packt es nach ein paar Minuten wieder weg, um den Film weiterzuschauen. Ich gehe nach einer Stunde, um Schlaf nachzuholen.
Ein paar Nonnen in der viertletzten Reihe, die manchmal nicken und manchmal die Hände wie zum Gebet falten. Neben mir drei deutsche Studentinnen, die die Farben und David Farrars Brusthaar bewundern.
Drei italienische Studenten um mich rum, die sich genauso wie ich weit zurücklehnen, um noch vom Boden aus die Leinwand zu sehen. Obwohl sie den Film schon kennen. Die Profis haben kleine Klappstühle mitgebracht. Wenn die polizia ihre Runden dreht, sich die Menge kurz wie Wasser spaltet, falten sie diese wieder zusammen und lassen sie über den Rücken hängen. Als Eva Green kurz darauf ihre Jungfräulichkeit verliert, wird das Echo ihrer Tränen – Glück und Schmerz – über den ganzen Platz gejagt und verliert sich in dem blauen Scheinwerferlicht.
Ein Mann steht und wartet. Der Rest sitzt. Aus Höflichkeit und wie einen stillen Pakt einhaltend. Aber der Mann lehnt sich gegen die Absperrung, wartet und nimmt Sicht. Er wartet durch alle Einführungen. Er steht auch durch die ersten zwanzig Minuten von The Straight Story. Ein Viertel der Leinwand bleibt mir mittlerweile verdeckt, was auch an sich eine interessante Seherfahrung ist. Einmal lacht er halblaut. Es wird ein Platz in den Reihen frei, und diesmal schnappe ich ihn mir. Nach einer Weile schaue ich wieder rüber zu dem Mann, aber er ist mittlerweile gegangen.
Florian Weigl
Als Apfel reinkarnierte Katze spielt Death Metal

Meine Filme des Jahres waren Past Lives, De humani corporis fabrica sowie And the King Said, What a Fantastic Machine. Am meisten berührt hat mich aber eine als Apfel reinkarnierte Katze aus Japan, die wie verrückt auf ein Drumset eindrischt – zu Texten, die so entwaffnend direkt die Conditio humana besingen, dass mir während der Arbeitszeit am Laptop die Tränen kamen. Das Ganze sieht zunächst nach einem Kindergeburtstag aus, bei dem ein Maskottchen mit viel Verve trommelt und das einprägsame (und überraschend tiefgründige) Eröffnungslied aus der megaerfolgreichen Anime-Serie Anpanman spielt. Das wirkt alles herrlich amateurhaft: Bild- und Tonqualität sind mau, im Hintergrund werden zur Vorbereitung irgendeines Events Zettel sortiert, und eine Frau – nennen wir sie die Kindergärtnerin – schunkelt vergnügt mit. Dann aber, nach einer Minute, legt Nyango Star – so heißt die japanische Apfelkatze – plötzlich richtig los und knüppelt wie besessen auf ihr Schlagzeug ein. In dem dicken, ungelenken Kostüm ist das Hochleistungssport. In weiteren Videos spielt und balgt sie sich mit anderen musizierenden Maskottchen, begleitet ein Klavierkonzert oder versucht, die Tradition des Apfelanbaus im Norden Japans aufrechtzuerhalten. Mein absoluter Favorit ist aber ihre Performance eines Songs, der mühelos zwischen Reggae, Deathcore, Comedy und philosophischer Allegorie wechselt. Der Text erzählt scheinbar vom allmorgendlichen Drama des Aufstehens („I don’t wanna get out of futon / cause outside of futon is too cold“), überhöht das Leid dann bis zum Scherz („wish the bathroom could come to me“) und wendet es später zur Parabel über das menschliche Leben an sich („facing against the cold world“), ehe er mit einem schönen Trostwort schließt. Das Wundervolle an Nyango Star ist, dass der scheinbare Widerspruch zwischen Kindermusik und Death Metal nie aufgehoben wird. Nao Kawakita – die Drummerin unter dem Kostüm, die im echten Leben genau so aussieht, wie man sich eine Metal-Drummerin vorstellt – reißt nie den Maskottchen-Kopf ab, um dann wild zu schreien und die Zunge rauszustrecken. Sie tritt nie die Flucht in die Ironie an, distanziert sich nie vom Kindischen. Stattdessen ist sie einfach beides zugleich: ein niedliches, fröhlich winkendes Kätzchen – und ein Deathcore-Rockstar, der sein Drumset verprügelt, als gäbe es kein Morgen mehr.
Martin Gobbin
Überlebensgroße Unsympathen

Zwei Hauptfiguren, die mich dieses Jahr im Kino in ihren Bann schlugen, waren ausgesprochene Kotzbrocken. Innerhalb der Handlung profitieren Tomas in Passages und Leon in Roter Himmel vom Entgegenkommen ihrer ihnen trotz allem liebend verbundenen Nebenfiguren: Die einen spielen die Spiele des zerstörerischen Narzissten Tomas fast widerstandslos und um den Preis eigener Verletzungen mit, die anderen begegnen dem notorischen Obermuffel Leon noch stets mit mildem Lächeln und so etwas wie Hilfsbereitschaft. Auf der Leinwand wiederum profitieren die beiden – neben, natürlich, dem Spiel von Franz Rogowski bzw. Thomas Schubert – davon, mit welcher Wirkkraft sich Ira Sachs’ bzw. Christian Petzolds Inszenierung ganz auf sie einlässt und ihnen Raum gibt, ihre zweifelhafte Aura zu verbreiten. Man ist als Zuschauer vielleicht nicht auf ihrer Seite, aber doch ganz bei ihnen: Auch wenn man sie zur Hölle schicken (Tomas) oder ihnen ordentlich den Kopf waschen will (Leon), möchte man nicht aufhören, ihnen zuzusehen.
Ein kleines Lehrstück, wie man einen Unsympathen auf der Leinwand überlebensgroß machen kann, liefert der junge Filmemacher Sam in Steven Spielbergs The Fabelmans. Der wird auf dem Schulhof von Sportskanone Logan drangsaliert und antisemitisch beleidigt – und revanchiert sich mit der Art und Weise, wie er ihn im für die Schule gedrehten Strandfilm in Szene setzt: indem er ihn gerade nicht kleinmacht, sondern im Gegenteil derart bigger than life als athletischen Adonis ins Bild setzt, dass Logan, als er den Film auf dem Abschlussball zu sehen bekommt, gar nicht darauf klarkommt. Warum er das gemacht habe, stellt er Sam hinterher auf dem Schulflur vor den Spinden zur Rede – er habe ihn, Logan, so dargestellt, wie er nicht sei und niemals sein könne.
Die Kamera habe schlicht gezeigt, was sie vorgefunden habe, antwortet Sam fast gleichmütig, und das ist auf grandiose Art wahr und gelogen zugleich: weil diese Bilder im gleichen Maße die unbestechliche Beobachtungsgabe wie die unbändige Fabulierlust des talentierten picture makers bezeugen; Gaben, die es ihm ermöglichen, aus Leben Kunst und es damit lebbarer zu machen. Und seinen Angstgegner nicht zu besiegen, aber zu überwinden – ihn aus der Fassung zu bringen und ihm auch etwas fürs Leben mitzugeben. So wird diese Konfrontation der beiden auf dem Flur, bei der sie nicht in Freundschaft, aber auf grimmiger Augenhöhe (und mit einem herzlichen gegenseitigen Stinkefinger) auseinandergehen, zu einer vor Vieldeutigkeit vibrierenden Szene, eine der schönsten im für mich schönsten Film des Jahres.
Maurice Lahde
Frei von infantilisierendem Empowerment-Kitsch

Mit einem Comic über einen Jungen namens Franzi wollte man mir in der Schulzeit schonend meine Lernschwäche näherbringen. Ich nahm es damals persönlich, habe mich aber mittlerweile mit meinen Konzentrationsstörungen arrangiert. Sie sind vermutlich auch der Grund, warum ich schnell die Geduld bei Filmen verliere, die angeblich auf einen mündigen Zuschauer zielen, in meinen Augen aber eher darauf aus sind, dass man ihre Unfertigkeiten schöndenkt. Meine Aufmerksamkeit muss man sich schon verdienen!
Dass es mich immer wieder zu Thrillern und Horrorfilmen zieht, hat vermutlich damit zu tun, dass man leichter in ihre packenden Geschichten eintauchen kann. Ausgerechnet auf der Berlinale, wo mich im Dunkeln blinkende Handy-Displays dieses Jahr den Glauben an die Menschheit verlieren ließen, fühlte ich mich von einem Film besonders aufgesogen. Der abgründige Erotikthriller Femme erzählt von einer waghalsigen Aktion, für die man im wahren Leben wohl zu feige wäre, der man auf der Leinwand aber umso gespannter folgt.
Jules (Nathan Stewart-Jarrett) wird am Anfang des Films von homophoben Schlägern ins Krankenhaus geprügelt und schwer traumatisiert. Als er einige Zeit später den attraktiven Rädelsführer Preston (George McKay) in einer Schwulensauana sieht, versucht er ihn zu daten. Jules' Vorteil: Weil er während des Angriffs in Drag war, kann er sich seinem Peiniger unerkannt, wenn auch nur mit größter innerer Anspannung nähern.
Preston entspricht auf den ersten Blick jenem Stereotyp, der als „Chav“ oder „Scally“ zum festen Figurenarsenal schwuler Pornos gehört: ein britischer, vermeintlich heterosexueller Proll mit Tattoos und Sportklamotten, der im Bett die totale Unterwerfung einfordert. Oder wie es Preston beim ersten Treffen mit dem ungleich sanfteren Jules spöttisch grinsend ausdrückt: „So you wanna get fucked like a litte bitch?“.
Die Maske männlicher Dominanz ist in Femme zugleich Fluch und Einladung zum erotischen Rollenspiel. Während sich hinter Prestons demonstrativer Überlegenheit die Panik vor einem Outing verbirgt, verschwimmen bei Jules Demütigung und Anziehung. Der Film reizt die Angst, entdeckt zu werden, immer wieder geschickt aus. Sie ist eine ständig lauernde Gefahr, verleiht der Situation aber auch einen besonderen Kitzel.
Beeindruckt hat mich am Debüt von Sam H. Freeman und Ng Choon Ping, wie schlüssig sich hier Identitätsdiskurse, die im aktuellen Genrekino etwas überstrapaziert und lehrbuchartig umgesetzt werden, ins Thriller-Format übertragen lassen. Statt sich in eine besserwisserische Außenperspektive zurückzuziehen, bleiben die Regisseure ganz der überforderten Gefühlswelt ihres Protagonisten verpflichtet. Der Blick auf schwule Sexualität ist angenehm ehrlich und frei von infantilisierendem Empowerment-Kitsch. Femme will mir nicht den Kopf tätscheln, er führt mich in ein teilweise ziemlich finsteres Labyrinth des Begehrens, in dem ich mich gerne verlaufe.
Michael Kienzl
Durch 80 Seiten Verhörtranskript

Es ist eine kunstvolle Fügung, dass die 2017 in den USA verhaftete Übersetzerin und Whistleblowerin ausgerechnet den klingenden Namen Reality Winner trägt. Denn für Tina Satters Debütfilm Reality ist er konzept-, titel- und stichwortgebend zugleich. Satter brachte das unveränderte Transkript des FBI-Verhörs der U.S.-Navy-Veteranin erst als Stück auf den Broadway und schließlich als Filmpremiere auf die diesjährige Berlinale.
Ein sehr enges Korsett für Drehbuch und Regie, das Reality aber erst zur Entfaltung von dramaturgischer wie politischer Brisanz, inszenatorischer Tiefe und einer atemraubenden Grundspannung verhilft. Es ist die Zusammenkunft des Banalen und des enorm Bedrohlichen, die in dem Kammerspiel zwischen Reality Winner und zwei FBI-Männern Momente des Verstörenden schafft: Wenn etwa Smalltalk über CrossFit oder Hunde aus dem Tierheim und Angelegenheiten der innersten Staatssicherheit im Dialog aufeinanderstoßen, dann ist das im wahrsten Sinne – Realität, unersetzbar durch Fiktion.
Getragen von einer herausragenden Performance von Sydney Sweeney, ständig zwischen militärischer Ernsthaftigkeit und unterdrückter Nervosität, und Satters Feingefühl für bildliche Poesie, marschiert der Debütfilm unbeirrt durch die 80 Seiten Verhörtranskript. Inklusive zensierter Stellen, filmgeworden durch Glitch-Effekte. Was bleibt? Neben einer tiefgehenden Figurenstudie nicht weniger als ein tiefer Blick in das Innenleben der zeitgenössischen USA.
Christopher Suss
Gespenster

Ich weiß noch, dass ich die alljährliche Mail der critic.de-Redaktion mit der Bitte um die besten Filme und schönsten Kinomomente erwartet hatte, ehe sie in meinem Postfach eintraf, und dass ich nicht wie sonst erst mein Notizbuch durchblättern musste, damit ich mich erinnerte. Ich will glauben, dass ich über Music schreiben wollte, weil seine Bilder mich über das Jahr verteilt an unterschiedlichen Orten heimgesucht haben. Und weil ich beim Tischtenniszocken mit den Kolleginnen im Hof immer an die Szene aus Schanelecs Film denken muss, in der die Wärterinnen Rundlauf spielen, und mich dann frage, was diese Analogie für den Alltag in einem Graduiertenkolleg heißt, welches Wissen wir dort eigentlich bewachen, damit es nicht ausbricht.
Vielleicht hätte ich mich beim Schreiben später umentschieden. Vielleicht doch lieber über Amiko nachdenken und diese umwerfende Hauptfigur, der abgesprochen wird, dass sie sich angemessen durch die Welt bewegen würde, obwohl das Mädchen mit den großen Augen alles verstanden hat, was es braucht, wenn im Ablecken der Schokolade auf einer Doppelkekshälfte das größte Glück steckt. Vielleicht hätte ich mich auch in einem knappen, leicht verschachtelten Nebensatz über De Facto aufgeregt, weil mich dieser Dokumentarfilm ebenso wie diejenigen, die ihn abfeiern, dermaßen wütend macht, wie es mir lange nicht mehr im Kino passiert ist.
Es kam der Dezember, es kam die erwartete Mail. Sie erreichte mich an demselben Tag, an dem sich eine Person aus meinem Leben verabschiedete, die mir sehr nahestand. Seitdem weiß ich nicht mehr wirklich, wie ich über das Jahr nachdenken und meine Erinnerungen sortieren kann. Was für mich bleibt, ist ein GIF mit einem kleinen, animierten Gespenst. Eine befreundete Person hat es mir geschickt, weil sie physisch nicht bei mir sein konnte. Immer und immer wieder breitet das Gespenst seine Arme zu einer Umarmung aus, errötet und lässt dann los, bis es wieder von Neuem zum ghost hug ansetzt: „You can’t feel it, but it’s there“, steht unter der Figur geschrieben, die mich ins nächste Jahr begleiten wird.
Anne Küper























Kommentare zu „Die besten Filme und schönsten Kinomomente 2023“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.