Die besten Filme und schönsten Kinomomente 2018
Die Häme im Kinosaal verklingt, wenn der bärtige Rock dem queeren Pop in die Augen schaut: critic.de-Autoren über Collagen leuchtender Filmschmetterlinge und über Glücksmomente, in denen sie verwundbar und easy to get sind.
Im Kino sind wir alle freie Menschen

Das „schlimmste Filmerlebnis“ habe ich ausgelassen. Einmal, weil der allgemeine Empörungspegel im Internet eh schon hoch genug ist; und dann auch, weil es mir plötzlich falsch vorkommt, ein „schlimmstes Erlebnis“ als Text zu objektivieren. Warum sollte ich das tun? Um mich selbst zu quälen? Oder, im Gegenteil, um beim Schreiben vielleicht doch wieder einen Genuss aus dem Erlebnis zu ziehen? Ist das Erlebnis, wenn es zu einem lustvoll geschriebenen Text Anlass gegeben hat, am Ende vielleicht gar nicht schlimm gewesen? Oder wird es erst im Moment, in dem ich darüber schreibe, weniger schlimm? Zeichnen sich die richtig schlimmen Kinoerlebnisse vielleicht nicht gerade dadurch aus, dass sich nicht interessant über sie schreiben lässt?
Auf solche Fragen will ich mich nicht einlassen. Ich schreibe lieber über das jenseitigste Film- und Kinoerlebnis. Jenseitig von Gut und Böse, also beide Kategorien umfassend. Und eigentlich auch sogar noch die dritte Kategorie des critic.de-Jahresrückblicks, denn Eckhart Schmidts Hollywood Fling, den ich Anfang November im Nürnberger KommKino im Rahmen einer Schmidt gewidmeten Werkschau gesehen habe, ist ästhetisch näher an der Internetpornografie als an so ziemlich allen mir bekannten Kinoästhetiken. Das gilt für beide Bildsorten, aus denen der Film (fast ausschließlich) besteht. Zum einen gibt es lange Handkameraeinstellungen, nervös-fiebrige Subjektiven, die junge Frauen beim Schlendern über den Hollywood Boulevard in Los Angeles folgen, sie umkreisen, umspielen, umtanzen, umgarnen. Dazu das Voice-over eines Pickup-Artists from hell, eines Todesengels der Celebrity-Culture, er spricht über die falschen Versprechungen, die er den Frauen macht, aber auch über seine inneren Dämonen. Poesie und Zynismus werden ununterscheidbar, gelegentlich bricht er in verrücktes Gelächter aus. Die andere Bildsorte: Die Frau, die gerade noch über den Hollywood Boulevard flaniert ist, liegt auf dem Bett eines Hotelzimmers. Sie zieht sich aus, die Kamera tastet sie ab, gierig, immer wieder nacheinander Gesicht, Brüste und Vagina fokussierend. Bald darauf hat weniger der durchweg so gut wie körperlose Protagonist als die Kamera selbst mit der Frau Sex. Und wenn sie anschließend umgebracht wird, gräbt sich die Kamera so tief in das Kissen, das ihr über das Gesicht gelegt wird, dass der ganze Bildraum schwarz wird.
Ein Film, der das Kino an Grenzen und darüber hinaus treibt, ohne dass man gleich sagen könnte, welche Grenzen das genau sind, die überschritten wurden. Was ist da gerade über uns hergefallen? Der letztmögliche Slasher, ein abstrakter Fetischporno, ein Metaautorenfilm? Eine ältere Zuschauerin hat etwas vollkommen anderes gesehen. Sie wundere sich, sagt sie im Publikumsgespräch, warum hier alle über Gewalt gegen Frauen sprechen, für sie sei das ein Film über die zärtliche Zuwendung zum weiblichen Körper. Wie wir denn darauf kommen, dass da jemand umgebracht werde? Die Kissen? Die habe sie nicht weiter beachtet, vielleicht wollten sich die Frauen ein wenig streicheln oder wärmen lassen. Im Kino sind wir alle freie Menschen, lerne ich in diesem Moment.
Lukas Foerster
Und das Land lachte

Vieles macht Zama von Lucrecia Martel zu einem der interessantesten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe: das Wagnis, den Irrsinn des Kolonialismus in den gebrochenen Existenzen der Kolonialherren aufzudröseln; die Parallelsetzung eines moralischen Verfalls mit dem Verrotten aller Materie, die in den Blick des Films gerät; die großartige Nähe von Tragik und Komik. Diego de Zama, Offizier der spanischen Krone, hat sich in einem Provinzort an der Küste Sudamerikas niedergelassen. Er gebärdet sich wie ein Herrscher, doch er vermag es nicht, das Land vollends unter seine Herrschaft zu zwingen; etwas entgleitet ihm, so wie sein dreckiges Haar immer wieder unter einer Perücke lugt, die nicht zurechtzurücken ist. In einer der großartigsten Szenen des Films – und dem schönsten Moment meines persönlichen Filmjahres 2018 – steht Zama am Strand und hört ein Kichern. Es sind einheimische Frauen, die sich mit Schlamm einreiben. Doch in der kurzen Spanne, in der das Lachen noch nicht verortet ist – weder für Zama noch für den Zuschauer –, da lacht die Landschaft, da lacht ein Land, das Zama mit Kräften abstößt und ihm zu verstehen gibt, dass er es niemals durchdringen wird.
Manon Cavagna
Zarte Stimmen grober Jungen

Manchmal entdeckt man bei seinen Vorlieben Muster, die man selbst nicht so ganz versteht. Mich berühren zum Beispiel oft Filme, die sich um christliche Motive oder Glaubensfragen drehen. Allein in den letzten zwei Jahren finden sich drei solcher Exemplare auf meiner imaginären Lieblingsfilmliste: Martin Scorseses Silence, Paul Schraders First Reformed und, als Neuzugang, Cédric Kahns The Prayer. Jeder von ihnen erzählt von einer Glaubenskrise, lässt dabei aber offen, ob er selbst glaubt.
Religion kann einen modellhaften Charakter haben, wenn man etwas über Menschen erzählen will; etwa über ihre Sehnsucht nach Strukturen und Regeln, den zwanghaften Abgleich zwischen persönlichem Begehren und einer höheren Ordnung, über den Umgang mit unermesslichem Leid oder auch darüber, welche Funktion Kollektive für den Einzelnen haben. Man könnte da wahrscheinlich auch jede andere Ideologie hernehmen, aber das Christentum hat eben auch noch eine mysteriöse übersinnliche Komponente und ein dickes Buch voller spannender Geschichten als Fundament.
Darüber hinaus fasziniert mich aber auch die Sinnlichkeit des Katholizismus, wie sie sich in einigen Ritualen, mehr aber noch in sakraler Kunst niederschlägt. Vielleicht nicht unbedingt, weil da noch katholische Reste in mir wuchern, sondern weil diese Werke oft von dem Wunsch durchdrungen sind, sich aufzulösen, so wie man ihn zum Beispiel auch spürt, wenn man in einem guten Club tanzt oder lange allein spazieren geht. Eigentlich bin ich ja eher bei den Atheisten, aber die sind in ihren Abwehrreflexen manchmal auf so rechthaberische Weise rational, dass ich wieder ins Grübeln komme, ob Christen nicht vielleicht doch die empfindsameren Menschen sind.
Cédric Kahns The Prayer hat mir so gut gefallen, weil er sowohl das Modellhafte als auch das Sinnliche der Religion auf eine sehr unkokette und organische Weise vereint. Hängen geblieben ist mir dabei vor allem eine Szene am Anfang, wenn die schwer erziehbaren Jugendlichen gemeinsam ein Kirchenlied singen. Der Film lief während einer Berlinale-Pressevorführung in der Wettbewerbs-Frühschiene. Ich mag die am liebsten, weil da eine verschlafene Stimmung herrscht und man noch verwundbar und durchlässig ist. Genau das richtige Setting also, um von den zarten Stimmen der groben Jungen komplett durchdrungen zu werden.
Michael Kienzl
Sport als Religion
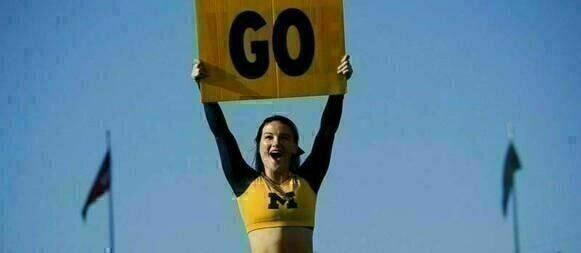
Ein B52-Bomber donnert über meinen Kopf hinweg, rings um mich herum stehen 60.000 Menschen, die Hand auf dem Herzen, den Blick auf die Flagge gerichtet. Sie singen die letzten Zeilen ihrer Nationalhymne und bejubeln zugleich die Machtdemonstration ihres Militärs. Ich empfinde das als unheimlich, einschüchternd, beängstigend. Ich bin eigentlich im Stadion der Florida State University, um ein Football-Spiel zu sehen – werde zuvor aber Zeuge einer inszenierten Aufwallung von Patriotismus oder, in meinen Augen, Nationalismus.
In das titelgebende Motiv des Dokumentarfilms The Big House, das Stadion der University of Michigan, passen nicht nur 60.000 Menschen, sondern fast doppelt so viele: 115.000. Es ist das größte Stadion der USA und an Spieltagen die fünftgrößte „Stadt“ in ganz Michigan. Vom Duell auf dem Rasen zeigt der Film kaum etwas. Das Spiel mag nur drei Stunden dauern, doch die Vorbereitungen ziehen sich über Tage. Essen wird geliefert, Marschmusik wird einstudiert, Helme werden bemalt, Cheerleader trainieren, Notärzte kontrollieren Medikamente, Polizisten rücken mit Hundestaffeln an. Das organisierte Chaos in einer kleinen Uni-Stadt: Fans pilgern zum Stadion, eifrige Hobbytheologen predigen in den Straßen, Wahlkämpfer werben für oder gegen Trump.
Irgendwann ist es endlich so weit: The Big Game in The Big House. Körper kollidieren mit brachialer Gewalt auf dem Spielfeld, 115.000 salutieren ihrem Team mit ähnlicher Uniformität, wie man sie von nordkoreanischen Parteitagen kennt. Die Individuen bewegen sich im Einklang, singen gemeinsam, verschmelzen zu einer Masse und steigern sich bei jedem erfolgreichen Spielzug ihres beschissenen Teams in einen kollektiven Rausch hinein (Disclaimer: Der Autor ist fundamentalistischer Anhänger eines direkten Rivalen von Michigan). So skeptisch man eben noch auf Staatsgewalt, religiöse Fanatiker und rechte Verschwörungstheoretiker vor dem Stadion geschaut hat: Der nackten Euphorie, die das Publikum im Stadion erfasst, kann man sich selbst im Kinosaal kaum erwehren.
Der Sport ist Nebensache, die Logistik bewundernswert, aber schnell vergessen. Deutlich spannender ist das Spiel aus soziologischer Perspektive. Rituale und Traditionen stimmen die Gemeinde auf ein Gemeinschaftserlebnis ein, Logos und Maskottchen dienen als Ikonen, Ekstasen ergreifen die Anhänger, Spielzüge heißen wie Stoßgebete („Hail Mary“), direkt neben dem Stadion steht „Touchdown Jesus“ und die katholische University of Notre Dame gibt in ihrem inoffiziellen Motto eine dreifaltige Hierarchie vor: „God. Country. Notre Dame.“ The Big House blickt auf eine bis zur Unversöhnlichkeit polarisierte Gesellschaft kurz vor einer wegweisenden Präsidentschaftswahl und deutet an, wie der Sport zur Religion wird. Das macht manchmal Angst – und reißt einen doch unweigerlich mit.
Martin Gobbin
Abgesang mit Pathos

Ich hatte kaum was mitbekommen von der Rezeption dieses Films, weder aus den USA noch aus Germany, aber wenn ich schon mal in Los Angeles bin, dann muss ich mir A Star Is Born auf dem Big Screen angucken, ist ja klar. Der Film hat mich in dem Moment, als der Rockstar in der Spelunke, in der er auf der Suche nach ein bisschen real life gelandet ist, gebeten wird, ein Lied zu spielen. Der Drag Queen ist egal, welches. Hauptsache, er guckt ihr dabei in die Augen. Und das macht er, und das Lied sagt, es sei vielleicht time to let the old ways die, und da fügt sich also eine irgendwie neue, eine irgendwie anders funktionierende Welt in eine sehr klassische Hollywood-Affektkonstellation ein. Da haucht zwar wieder mal der Countrytyp seine verlebte Stimme ins Mikro, und natürlich ist es da auch schnell um die schöne Frau geschehen, die die Szenerie gleich betreten wird. Aber in diesen ersten Zeilen guckt auch irgendwie der bärtige Rock dem queeren Pop in die Augen und singt, in a very old way, vom Sterben der old ways.
Ein Abgesang mit Pathos, und weil die Tonlage des Abgesangs nie ganz zu greifen ist, nicht zynisch ist, aber auch nicht platt nostalgisch, stritt man sich wohl um Aussagen und Botschaften und Lesarten – der Rezeption bin ich weiterhin größtenteils ausgewichen. Erst einmal ist A Star Is Born interessant, weil der Film gar nicht anders kann als zu fragen, wie die klassische weißheteronormative Erzählung vom männlichen Künstler und weiblichem Starlet heutzutage so aussieht. Und die Classical-Hollywood-Dialektik zwischen Uneigentlichkeit (der perfekten Konstruktion) und Eigentlichkeit (der Anrufung einer vorgeblich universellen Erfahrung) ist dann eben schnell kulturgeschichtlich überformt, einerseits von neuen Subjektivierungen, andererseits vom Pop-Diskurs um die Pole nostalgischer Authentizitätsfetisch und lustvolle Performativität. Aber die Fremdwörter trägt der Film nicht an sein Material heran, es reicht schon, dass er in unserer Zeit spielt und das begreift.
Und auch etwas über sie sagen will? Vielleicht. Vielleicht auch tatsächlich das Falsche. Aber wie herum man diesen Film nun lesen will, er lässt die old ways sterben, trauert natürlich ein bisschen, lässt aber die ganze Säufer-Suizid-Romantik des Rock als narzisstische Projektion erkennen. Bricht das vor allem in zwei Sequenzen wunderbar herunter: Einmal überlässt da jemand seine eigene Bühne, ein anderes Mal stürmt er eine Bühne, die ihm nicht mehr gehört. Maybe it’s time to let the old ways die. Vielleicht übersteigt der Song seinen Interpreten so wie dieser Film seinen sogenannten Autor. Jenseits von Lesarten und Interpretationen ist A Star Is Born jedenfalls das, was La La Land so gern gewesen wäre: von einem anderen Stern und zugleich ganz von dieser Welt.
Till Kadritzke
Jeder Ort ein Magic Castle

Ich glaube, ich habe in einem Film noch nie ein Kind so weinen sehen wie Moonee (Brooklynn Prince) kurz vorm Ende von The Florida Project. Hundert Minuten sprudelte die Sechsjährige nur so über vor Lebensdrang und anarchischer Spielfreude – doch mit der gleichen Urgewalt, mit der sie und ihre Clique fröhlich eine Schneise der Verwüstung durch die Gegend zogen, brechen jetzt die Tränen aus ihr heraus. Sie steht bei ihrer Freundin Jancey vor der Tür, um Abschied zu nehmen; die Leute vom Jugendamt sind da, um sie von ihrer Mutter, ihren Freunden, ihrem Magic Castle zu trennen.
Magic Castle, so der Name einer der beiden Motelanlagen in Orlando, zu Unterkünften für Menschen umfunktioniert, die sich keine Sozialwohnung mehr leisten können; die andere heißt Futureland. Die lila und orange gestrichenen Gebäudekomplexe vor den Toren der unerreichbaren Disney World schreien danach, als Abenteuerspielplatz benutzt zu werden, nach einer Kamera ohnehin. Und wer noch einen Funken Erinnerung daran hat, wie kindliche Einbildungskraft sich beinah jeden Ort zu einem Magic Castle machen kann, der wird Moonee und ihre Freunde dort als stets in sich geschützt erleben – ohne dass sich die Gefährdungen am Bildrand und im Hintergrund je ganz übersehen und überhören ließen, die Highways, die Helikopter, die Stimme von Herrenbesuch an der Badezimmertür. Mag sein, dass Moonee noch zu klein ist, um ihre soziale Situation zu verstehen, aber sie hat auch wache Augen; nicht alles, was am Ende aus ihr ausbricht, kommt aus heiterem Himmel.
Doch dann ergreift Rotschopf Jancey, die Moonee den Film hindurch eher brav folgte, die Initiative, nimmt ihre Freundin bei der Hand und saust mit ihr los; Regisseur Sean Baker tauscht die 35-mm-Kamera auf den letzten Metern gegen das iPhone und saust hinterher, über die Grenze zu dem sonst reichen Touristen vorbehaltenen Vergnügungspark, auch Magic Kingdom genannt. Als Ende schenkt der Film ihnen, sich, uns ein eskapistisches Ausscheren – dass alle um die Bedrohungen wissen, die hinter den beiden bleiben, tut dem Glück, trotz Kloß im Hals, keinen Abbruch.
Maurice Lahde
Ein alter Mann schlürft eine Suppe
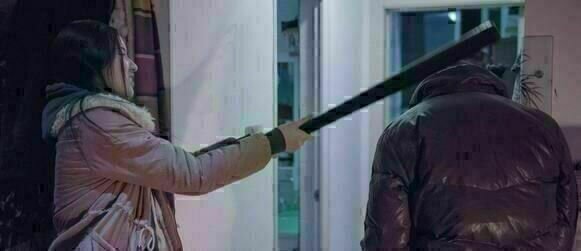
Ein alter Mann schlürft eine Suppe. Er schlürft laut. Er ist alleine, sitzt im Freien, in einer unwohnlichen Gegend im Norden Chinas. Die Atmosphäre ist grau mit ewiger Tendenz zur Verdunkelung. So sieht es hier immer aus.
Ein Schüler zündet ein Streichholz an, begutachtet es einen Augenblick lang und wirft es an die Decke. Die Kamera schwenkt dem Streichholz nach und nimmt die Decke in den Blick, die mit Brandlöchern übersät ist. Sie sieht aus wie ein Stück infizierter Haut.
Ein Mädchen ist in ihrem unkindlichen Kinderzimmer. Im Flur streiten erwachsene Menschen. In ihr kocht die Wut, aber das sieht man nicht. Ihr Körper ist ruhig, fast schlafend. Sie nimmt einen Baseballschläger, klettert aus dem Fenster, geht einmal ums Haus, kommt zur Wohnungstüre wieder herein und drischt zu.
Ein junger dünner Mann mit tollen, festen, schwarzen Haaren sitzt auf einem Bett und raucht, dann bewegt er sich im Zimmer. Es gibt auf der ganzen Welt kein Zimmer, in dem man sich so bewegen könnte wie dieser Mann es tut. Das ist ganz und gar seltsam, ganz und gar wunderschön.
Alles ist und macht Musik

Domenico Modugno ist der Mann, der 1958 den Welthit „Volare (Nel blu dipinto di blu)“ geschrieben und gesungen hat. Wie sehr dieses Lied Programm für diesen musischen Tausendsassa war, zeigte die kunstvoll von ihm selbst geschriebene und inszenierte illustrative Collage leuchtender Filmschmetterlinge rund um seine Lieder, die in diesem Sommer auf dem „5. Terza Visione – Festival des italienischen Genrekinos“ in Frankfurt lief: „Tutto è musica!“ (1964). Fliegen und Singen, Leben und Lieben: Sie sind dem Mann, den er in diesem Film verkörpert, eins und alles. Er ist beflügelt, getragen von einem alles umarmenden, euphorischen, himmlischen Lebensgefühl. Sportlich und energiegeladen fliegt er wie ein Zauberer durch das Blaue, tanzt überglücklich über dicht befahrene Kreuzungen. Autos hupen, Bremsen quietschen, Leute schimpfen: Macht nichts, alles ist und macht Musik. Glänzend bunte Bilder steigen auf und schweben mit ihm durch die Luft. Viele seiner Geschichten handeln mit großer Sympathie von den Gefühlen von Tieren (und ähnlichen Lebewesen), die der Mensch gedankenlos für sich beansprucht. Sie müssen sich jede kurze Zeit der Freiheit und des Glücks zurückstehlen. Zwei Rennpferde brechen eines Tages aus. Wie unbändig sie galoppieren, voller Freude, ohne Reiter, ohne Zügel, in ihrem Element, bis die Menschenherrschaft sie wieder einholt! Ein Schwertfilmpärchen lebt verliebt im Meer, bis Fischer es töten. Ein kleiner Junge verliebt sich in ein kleines Mädchen, bis sein Urlaub in ihrem Land vorüber ist und er mit seinen Eltern heimfahren muss. In einer umwerfenden Episode wird ein verrückter junger Mann selbst zum Tier. Lachend und lechzend, mit heraushängender Zunge und strahlenden Augen, spielt er begeistert, er sei ein Hund, und niemandem gelingt es, ihn vom Ausleben dieser Fantasie abzubringen. Freunde! So soll es sein.
Silvia Szymanski
In den besten Filmen werden Tiere geboren

Koinzidenzen. Google und Facebook werden 2018 noch prüder. Der neue Film eines gefeierten französischen Regisseurs kommt in Deutschland nicht ins Kino, wird nicht einmal diskutiert, scheint völlig abwesend. Abdellatif Kechiche hat wohl vieles falsch gemacht, sicherlich auch schon, bevor er die Goldene Palme für Blau ist eine warme Farbe (La vie d’Adèle) erhält. Die Vorwürfe der Schauspielerinnen und anderer Mitarbeiter gegen ihn wiegen schwer und dürften mitgeschwungen haben bei den zurückhaltenden Bewertungen der internationalen Presse. Auch Mektoub My Love, Canto Uno, der vor über einem Jahr im Wettbewerb von Venedig lief, interessiert sich für Zusammenhänge von Unschuld und Sexualität und blickt durchaus voyeuristisch auf junge Körper.
Ich meine, Kechiche hat auch deshalb einen der besten Filme des Jahres gemacht. Die wichtigste Szene in Mektoub My Love, Canto Uno (denn ein zweiter Teil soll 2019 folgen) folgt den Blicken des jungen Fotografen, der, schüchtern und selbstbewusst zugleich, den ganzen Film vor Liebe übersprudelt und selbst Objekt der Begierde wird, denn die Dinge liegen oft überquer. Zu sich kommt der Film in einem Moment, da sich Amin (Shaïn Boumedine) wieder in die Beobachterrolle begibt, auf die Lauer legt, um dieses Mal dabei zuzusehen, wie ein Schaf geboren wird (in den besten Filmen werden Tiere geboren, looking at you, In My Room). Es ist ein herausgehobener Augenblick, doch wie alles fließt er dahin, erscheint plötzlich, unmittelbar, sachte und rasant. Das Licht könnte nicht schöner sein, die Erschütterung nicht durchdringender. Tränen in den Augen, Wunder, Welt, Körper, Liebe, alles in einem. Wem wird Amin davon erzählen können? Wird er die Berührung weitergeben? Mektoub weiß viel über soziale Konventionen und jugendlichen Eifer zu erzählen, über das Verhältnis von Körpern im Sommer zueinander. Die Form, die Kechiche schafft, ist eine besondere, weil das Leben nie so im Fluss ist wie bei ihm. Die Projektionen aber, die er heraufbeschwört, die Anziehungen und Ablehnungen, die Lust zum Greifen, egal ob erfüllt oder nicht, sie sind alltäglich. Hoffentlich bleibt das Kino noch lange ein Refugium vor der Prüderie der Internet-Monopolisten.
Frédéric Jaeger
Häme, die restlos verklingt

Die Diskussionen sind meist endlos. Die eine Position besagt, dass es unmöglich geworden ist, ins Kino zu gehen, weil dort in einem nie gekannten Maß geredet, mit Handys geleuchtet und sonst wie auf seine Mitmenschen keine Rücksicht genommen wird. Die andere besteht darauf, dass es immer auf Film und Kino ankommt. Vielleicht auch darauf, wo der eigene Sitzplatz ist und ob der als solcher empfundene Pöbel vielleicht gar nicht wahrgenommen wird.
Ich habe selbst erst wenige Erfahrungen mit den apokalyptischen Beschreibungen von Kinovorstellungen gehabt, die ich manchmal höre. Dieses Jahr saß ich nun mal wieder in einem Multiplex, und der Saal (hinter mir) war äußerst, äußerst unruhig. Eine halbe bis dreiviertel Stunde nach Filmbeginn kam ein Paar in den Saal, und sie brauchten sichtlich etwas Zeit, um sich an die Situation zu gewöhnen. Sie redeten also erst, suchten Dinge, machten vermeintlich witzige Kommentare über den Film. Aber dann passierte auch bei den beiden nochmals, was schon zu Anfang zu beobachten war. Dass dieser Rattenfänger von einem Film zwar erst nebenherlief und ganz ungestört von der fehlenden Aufmerksamkeit sein Ding machte, irgendwann aber jeden Einzelnen im Kino mitgenommen hatte. Große Teile der Laufzeit war alles still, und die Spannung im Saal war förmlich zu hören, weil da eben nichts mehr war.
Bei dem Film handelte es sich um Corin Hardys The Nun. Ein Film, der kleine Portionen Indiana Jones ins Conjuring Cinematic Universe aufnimmt, aber vor allem aus Exzess besteht. Das wackelige Gerüst einer Geschichte wird darin wüst und hedonistisch mit dunklen Orten, unweltlichen Entitäten und jeder Menge Jumpscares aufgefüllt. Das Lachhafte dieses vermeintlichen Trashes lag auf der Hand, so schien mir, aber genau das Gegenteil geschah. Die kurzzeitig spür- und hörbare Häme verklang restlos. Ein Film, der fast nur aus Atmosphäre besteht, schaffte es, diese und damit sich über den ganzen Saal zu legen. Da brauchte es keine Positionen mehr. Nur einen Film, der eine endlose Diskussion abschloss.
Robert Wagner
Wie süßer, starker Alkohol
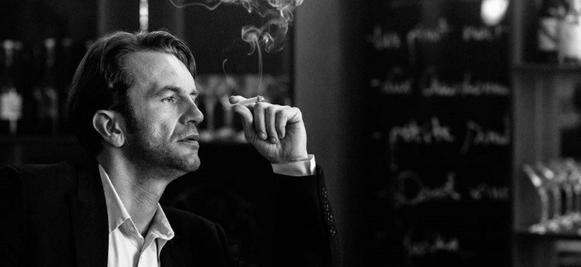
Mir ist die Filmgegenwart Joanna Kuligs in Erinnerung geblieben: die etwas tapsige Gangart, der sinnliche Mund, die Brüste, „le charme slave“ (war im Film ironisch gemeint). Eine entzückend-schlimme Leidenschaft, schnell und kurz der Film, schneller Heimweg durch cold Neukölln. Nachgedacht und nicht verstanden, was es mit dem Titel auf sich hat. Auf der Suche nach einem objektivierbaren Überbau ist die Kritik unterwegs auf falschen Fährten. Ich empfehle Cold War weiter und denke nicht weiter darüber nach.
Dann habe ich mit A. ganz lange über Cold War telefoniert. A. und ich, wir sind zwei verschiedene Sorten Zuschauerinnen. Ich bin easy to get, lache, wenn auf der Leinwand gelacht wird, auch immer mit. Glaube den Figuren aufs Wort. „Dunkle Zonen der Verantwortungslosigkeit“ (Christian Metz). A. dagegen bleibt wach und aufmerksam, sie fand Cold War so lala. Ihre Kunsturteile begründet sie ausgesprochen elaboriert. Kühl, klar und ohne einmal auf übliche substanzlose Adjektive und Füllwörter zurückzugreifen, kann sie zum Beispiel darlegen, warum sie den männlichen Protagonisten jetzt richtig toll fand. Wir stritten uns ein bisschen, ich war glücklich.
Seitdem ist Cold War wieder da. Wie eine Wunderkerze dieser Film, wie Alkohol, der in meiner Heimat immer süß und stark sein muss. Wie eine in glänzende Folie eingewickelte Praline, dahinschmelzend.
Olga Baruk
Hier geht's zu unseren liebsten Webvideos aus dem Jahr 2018
Und hier zu unseren schlechtesten Filmen und schlimmsten Kinomomenten 2018
















Kommentare zu „Die besten Filme und schönsten Kinomomente 2018“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.