Die Befreiung der Triebe bleibt Utopie – Nachruf auf Jürgen Enz
Inmitten der Sexfilmwelle der 1970er Jahre wirkten die Regiearbeiten von Jürgen Enz steif und verklemmt. In seinen Dirndl- und Lederhosen-Filmen herrscht überall Zwang. Doch mit ihrer bizarren Ästhetik und zermürbenden Qualität haben sie uns viel zu bieten.
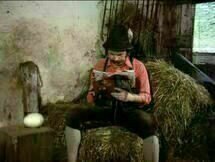
Anfang dieses Jahrhunderts avancierte Kunst aufräumen zum Bestseller. In dem Bildband präsentierte Ursus Wehrli auf jeder Doppelseite nebeneinander ein Kunstwerk und eine nach strengem Ordnungssinn neu arrangierte Version desselben. Auf der einen Seite also etwa René Magrittes Golconda, das einen mit Männern gefüllten Himmel zeigt – möglicherweise regnet es diese –, auf der anderen Seite die gleichen Männer, nur wurden sie in Reih und Glied nach Größe sortiert. Oder: links ein Gemälde von Jackson Pollock, rechts einige Farbdosen.
Drang zum Aufgeräumten

Der Metawitz dieser Bilder geht dem Werk von Jürgen Enz völlig ab. Den Drang zum Aufgeräumten teilt es aber mit ihnen. Die Bilder, die Räume der Handlung wie auch der dramaturgische Aufbau unternehmen ihr Möglichstes, um jede Form von Durcheinander zu verhindern. Schön sauber eines nach dem anderen, schön sauber alles nebeneinander. In Waidmannsheil im Spitzenhöschen (1982) gibt es eine wunderbare Einstellung, in der wir einen Saal mit tanzenden Paaren sehen. Darunter schließt eine Tafel mit Wurst das Bild ab wie ein Rahmen. Völlig symmetrisch steht beides zueinander und strahlt aufeinander ab, vor allem aber fällt nichts ineinander. Ob die Wurst ein Kommentar zur Wurstigkeit der Veranstaltung ist oder ob hier eine sehr bodenständige Form von Glamour zelebriert wird, ist nicht klar. Es stehen nur wieder zwei Dinge nebeneinander.

Jürgen Enz war in seiner von 1973 bis 1990 andauernden Karriere im Bereich der Sexploitation tätig. Er drehte Erotikfilme, Sexklamotten, Soft- und Hardcorepornos. Nicht selten ging es um Lederhosen und Dirndl. Die Aufgeräumtheit seiner Filme führte aber dazu, dass sie nie den Verheißungen des Genres und ihren reißerischen Titeln – beispielsweise Sexgaudi am Königssee (1977) oder Wo der Wildbach durch das Höschen rauscht (1974) – entsprachen. Statt Lust und tolldreistem Vergnügen herrschten Steifheit und Verklemmung. Wer von den Filmen angemacht werden wollte, wer sich Jux und Tollerei versprach, fand schlechtes Handwerk, fade Witze und enervierende Gemächlichkeit.
Nur nicht mehr gehemmt sein

Durch ihre Form schaffen es diese Filme aber auch, eine gewisse Art von Horror zu erzeugen. Enz selbst hatte nie Lust am Dreh der Sexszenen. Wie fremd sie ihm waren, ist sehr deutlich zu sehen. Überall herrscht Zwang. Die Geschichte erzwingt den Koitus. Die Figuren agieren zwanghaft. Die Schauspieler zwingen sich zur Lust. Enz war Teil der Sexfilmwelle, während derer sich nicht nur die Grenzen des Zeigbaren in kürzester Zeit erweiterten, sondern auch Aufklärung und Reißerisches ein eigenwilliges Amalgam bildeten. Nur nicht mehr gehemmt sein, schien das Motto zu lauten.

Im Zentrum des Kinos Jürgen Enz’ stehen Leute, die ihre Triebhaftigkeit offen performen. Er zeigt uns aber nicht die Lässigen, nicht diejenigen, die mit ihrer eigenen Sexualität im Reinen sind, sondern die Scheiternden, die einen neuen Status quo nur behaupteten. Die Liebesvögel – Küss mich da, wo ich es mag … (1979) erzählt von einem jungen Mann, der sich ins sündige München aufmacht und erlernen möchte, was es mit diesem Sex auf sich hat. Seine Lehrmeister sind schrecklich aufdringlich mit ihren aufgesetzten Aufführungen. Er hingegen schafft es, davon abgeschreckt, nicht, einen Orgasmus zu bekommen. Erst Ehe und Liebe führen ihn zum Höhepunkt.

Es handelt sich um einen essenziellen Film im Werk von Enz. Nicht wegen des konservativ anmutenden Endes, sondern wegen der Leute, die in den neuen promisken Lebenswelten, in denen es offen zu sein gilt, nach Anerkennung und Sinn suchen. Die Filme zeigen den Sex so nicht durch die Brille der Lust, sondern mit einer durchaus schmerzlichen Unzulänglichkeit. Es kann einen gruseln, was man zu sehen bekommt. Die Filme Jürgen Enz’ sind sprechende Zeugen dafür, wie sehr Herbert Marcuses Utopie der Befreiung der Triebe eben noch Utopie war und ist.
Mehr als ein hölzerner Poet sexueller Unvollkommenheit

Die Unvollkommenheit der Filme – die nicht unwesentlich im Unvermögen eines Regisseurs begründet liegt, von dem mitreißende Blockbuster oder künstlerisch wertvolle Autorenfilme undenkbar sind – verbrüdert sich so mit ihren Figuren. Enz-Filme sind nicht ganz einfache Erfahrungen. Weder sehen wir die Übersetzung unserer Welt in „gekonnte“ Fiktion noch in episches Theater oder eine andere Form klarer Verfremdung. Bei einem Film von Helge Schneider wissen wir, dass es sich um eine absichtliche Herausforderung von gängigen Mustern und unserem Verständnis von Sinnhaften handelt. Bei Enz ist diese Intention nicht herauszulesen. Vielmehr ist es so, als ob wir nach einem Urlaub nach Hause kommen und plötzlich wieder verstehen, wie vulgär und banal das um uns Gesagte ist.

Eigentlich hätte Jürgen Enz gerne Heimatfilme gedreht. Im Jahr 1980 wurde Herbstromanze veröffentlicht, die Verwirklichung seines Traums mit Rudolf Lenz, dem Förster vom Silberwald (1954), in der Hauptrolle. Es handelt sich dabei um sein Meisterstück. Der Sex, der sein Schaffen davor und danach in sehr klaren Bahnen bestimmt, nimmt hier die Form von völlig entrückten, weichgezeichneten Fantasien über rennende Pferde an, von unterdrücktem, grenzinzestuösem Verlangen, von sexueller Gewalt. Vorsicht und Überspanntheit bestimmen das Gesprochene, von den Schauspielern exaltiert bis schlaftrunken aufgesagt. Entscheidendes findet sich meist in den Blicken. In diesem seltsamen, einzigartigen Film offenbart sich eine andere Qualität von Jürgen Enz’ Werk, die aus ihm mehr macht als einen hölzernen Poeten der sexuellen Unvollkommenheit.
Lyrisches und völlig Erratisches

Eine ausgefallene Lyrik ist seinen Filmen zu eigen. Mal liegt sie im sanften Wesen ihres Regisseurs, mal in dem fehlenden Willen oder Können, „normal“ zu sein. Mal sind es kurze, entlarvende Gesten, wenn etwa ein Mann genussvoll einen Zug aus seiner Maß nimmt und damit die Frau, mit der er gerade Sex hat, zur Nebendarstellerin seines Lusthaushalts macht. Mal ist es völlig Erratisches wie Frauen, die breitbeinig wie Westernhelden dastehen und ihre Röcke zum Duell hochziehen, wenn Männer um die Ecke kommen. Momente, wenn zarter Bodennebel mit dadaistischer Verlangenspoesie konterkariert wird („Schau mal die Beine, die sind so heiß, da möchte man fast sein Leberkäsebrötchen wegwerfen.“). Wenn immer wieder Wände mit unzähligen Tellern behängt sind und so Orte von vollgestellter Leere und beengender, surrealer Gemütlichkeit erschaffen.
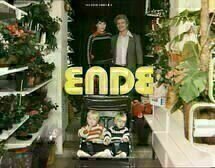
Die Filme von Jürgen Enz sind sehr reiche Zeitkapseln, deren Entstehungsmoment durch Ausstattung, Sprache und Kleidung immer sichtbar bleibt und in sie eingeschrieben ist, weil sie nur zu diesem einen Punkt in der Geschichte der BRD möglich waren. Und da alles unvermischt nebeneinander arrangiert wurde, das Moderne und das Anachronistische, das Wollen und das Sein, das unverstanden Performte und das nicht abzuschüttelnde Eigene, haben sie uns durch ihre bizarre Ästhetik und trotz ihrer zermürbenden Qualitäten jede Menge zu bieten.
Nun ist Jürgen Enz zum Jahreswechsel verstorben. Deutschland hat mit ihm vielleicht nicht seinen eloquentesten Filmemacher verloren, aber doch einen unvergleichlichen, einen eingeschränkten Sexfilmer und außerordentlichen Vertreter Naiver Kunst.















Kommentare zu „Die Befreiung der Triebe bleibt Utopie – Nachruf auf Jürgen Enz“
Lukas Kapeller
Großartiger, schöner Text!