Die Arbeit am Bild – Der Dokumentarist Hartmut Bitomsky
Hartmut Bitomsky hat sich in seinen essayistischen Dokumentarfilmen an vorgefundenen Bildern abgearbeitet und sich eigene erarbeitet.

„Er fängt nicht mit Adam und Eva an, sondern mit dem, worüber er reden will; er sagt, was ihm daran aufgeht, bricht ab, wo er selber am Ende sich fühlt und nicht dort, wo kein Rest mehr bliebe.“1 So charakterisiert Theodor W. Adorno in „Der Essay als Form“ (1958) das Denken und Schreiben des Essayisten. Man kann diese Beschreibung auch auf das Filmemachen Hartmut Bitomskys (*1942 in Bremen) beziehen. In seinem Werk, das sich von Ende der 1960er bis in die 2000er Jahre erstreckt, ist Bitomsky vorrangig der essayistisch geprägten Dokumentarfilmform nachgegangen – ohne sich explizit als ein Essayfilmer zu verstehen. Schon die Übertragung des Begriffs Essay auf den Film sieht er nicht als besonders gelungen an, hafte ihr doch etwas unschön Akademisches an. Klar ist aber, dass seine Filme mehr Versuche als Ergebnisse darstellen und in ihnen stets dieser Rest bleibt; dass sie nichts mit didaktischen, gut gemeinten Dokumentarfilmbeiträgen am Hut haben, die suggerieren, die Wahrheit in den Griff zu bekommen. Gerade die Absage ans Ausgewogene und Abgeschlossene scheint den Essay auszumachen. Es ist schwer, ihn zu bestimmen, da er sich bewusst entzieht. Was zugleich Fluch und Segen ist.
Erschwertes Sehen

Der Begriff Essayfilm wird mittlerweile inflationär gebraucht. Verkürzend versteht man darunter gerne eine subjektiv-spekulative und vor allem vereinnahmend ästhetisierende Art und Weise, in einem (semi-)dokumentarischen Film von Zusammenhängen zu erzählen. So fuße der traditionelle Dokumentarfilm auf quasi wissenschaftlichem Instrumentarium, der Essay sei persönlicher, gerne auch mal kryptischer Ausdruck. Harun Farocki hatte sich schon vor knapp zwanzig Jahren darüber beschwert, dass in der gängigen Wahrnehmung „viel Stimmungsmäßiges und nicht eindeutig Journalistisches (…) schon Essay“ sei.2 Stimmungen spielen in Bitomskys Filmen im Grunde keine Rolle; investigativ, sogar lehrreich sind sie hingegen schon. Ohne deshalb belehrend zu sein, schließen sie einen künstlerischen und demnach nicht alltäglichen Zugang zu Feldern der Wirklichkeit auf. Ihren Gegenständen (seien es Arbeitsprozesse oder Filmproduktionen) wird nicht entsprochen, sondern mit einer konstruierten Filmsprache begegnet. Und dies nicht nur durch die präzise, oft lakonisch vorgetragene Voice-over-Stimme Bitomskys, die die Bilder nicht eigentlich kommentiert, sondern auf sie reagiert – mal emphatisch, mal distanziert –, sondern auch in den Bildern selbst, die stets ihre Vermittlungsarbeit ausstellen. Es geht zwar um Erkenntnis, aber die wird nicht erlangt, wie es sich die Dokumentarfilm-Strömung des Direct Cinema vorstellte, indem man die Welt lediglich einfängt. Künstlerische Verfahren müssen das Betrachten vielmehr erschweren, damit man erst einmal darauf kommt, richtig hinzusehen.
Was Bitomskys Filme essayistisch macht, ist ihre Schilderung einer Denkbewegung, ihr skeptisches, notwendigerweise nicht zu einem Ziel kommendes Umkreisen der Gegenstände. Darin steckt auch immer etwas Selbstreflexives. Wie steht der Filmemacher mit seiner ästhetischen Arbeit zur Welt, lautet letztlich die „peinigende Frage, in der immer eine Selbstbefragung eingeschlossen sein wird.“3 Diese Überlegung findet sich im 2012 erschienenen Band Geliehene Landschaften, der anlässlich einer Film- und Videoinstallation im Neuen Berliner Kunstverein (n.b.k.) erschienen ist. Er versammelt unter anderem Bitomskys Arbeitsjournale aus gut zwei Jahrzehnten, die als Vor-, Zwischen- und Nachbetrachtungen seiner Filme zu verstehen sind, aber auch allgemeiner als Aphorismen über das Arbeiten mit und durch Bilder.
Kinowahrheit

Denn Bitomskys Medium ist gleichermaßen der Film wie die Schrift. Ab den frühen 1970er Jahren veröffentlichte er Kritiken und umfangreiche Analysen in der Filmkritik (deren Vorstand er später werden sollte), etwa zu John Ford und Humphrey Jennings. Zu beiden entstehen im Jahr 1976 auch filmische Arbeiten: Humphrey Jennings: Berichte über einen englischen Filmemacher und Der Schauplatz des Krieges: Das Kino von John Ford. Geschriebenes und Gefilmtes bedingen sich also schon früh und werden auch später sinnhaft nicht mehr zu trennen sein. Bereits 1972 liegt ein Theoriebuch mit dem wunderschönen Titel Die Röte des Rots von Technicolor vor, das Marx’sche Ideologiekritik mit zeitgenössischer Semiotik zu verschränken versucht – ein Ansatz, dem Bitomsky, so scheint es, später nicht mehr so recht folgen will.
Bis zum heutigen Tag kann man sich das schriftstellerische Werk einfacher erschließen als das filmische – nur sein vorletzter Film Staub (2007) ist überhaupt auf DVD erschienen. Der Sammelband Kinowahrheit (2003) etwa, lässt sich gut zwischendurch hervornehmen: eine Fundgrube meist knapper, verdichteter Gedanken, die die Komplexität des Kinos erahnen lassen. Dort finden sich Sätze wie dieser: „Mit einer gewissen Berechtigung kann man sagen, daß der Dokumentarfilm mit Ready Mades arbeitet: Dinge, die schon da sind, präfabriziert in einer bestimmten vorgefundenen Form und Verfassung, mit einer eigenen Geschichte – Dinge, die ihr eigenes, apartes Daseinsrecht haben, die sich in einem spezifischen (wenn auch vielleicht unbekannten oder nur vage erahnten) Kontext zu dem entwickelt haben, was sie sind.“4 Und dann an anderer Stelle, bezogen auf den Dokumentaristen Peter Nestler: „Er ist ein Nacherzähler, und das heißt, daß er weiß: die Kraft, die er mitteilt, geht nicht von ihm aus, sie geht von den Dingen aus durch ihn hindurch.“5 Hierin steckt auch eine Selbstbeschreibung.

Der Titel des Buchs ist Programm: Gibt es einen notwendigen Zusammenhang von Film und Wahrheit, der mit Bezug auf die Wirklichkeit aufgespürt werden kann, oder gibt es vielmehr etwas Wirkliches, das sich nicht jenseits der Bilder zeigt, sondern (nur) in ihnen – Kino-Wahrheit? Hier sind Texte aus der Filmkritik erneut abgedruckt und einige mehr enthalten; ihre Gegenstände reichen von der Betrachtung einzelner Filme wie Robert Bressons Das Geld (L’argent, 1983) oder Michael Ciminos Heaven's Gate (1980), Überlegungen zur Ästhetik und Geschichte des Dokumentarfilms bis hin zu einem umfangreichen Essay, der sich der Materialfülle und ästhetischen Eigenart von NS-Kulturfilmen anzunähern versucht („Der Kotflügel eines Mercedes-Benz“). Daneben stehen aber auch Reflexionen zum eigenen Werk, etwa Texte, die die gleichen Titel wie seine Filme tragen: „Das Kino und der Tod“ und „VW-Komplex“. Hier zeigt sich, dass Bitomskys Nachdenken über das Gemachtsein filmischer Bilder und ihrer Geschichte nicht davon zu trennen ist, eigene herzustellen und sie dann wieder auf den Prüfstand zu stellen.
Bilder der Arbeit
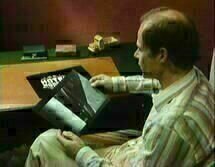
Wenn man kurz und bündig erläutern sollte, worin Bitomskys dokumentarisches Hauptinteresse besteht, so müsste man wohl sagen: Arbeit. Zum einen die physische Arbeit und hier vor allem ihre Abläufe und Kreisläufe. Im Kompilationsfilm Reichsautobahn (1986) wird der Arbeitsprozess, jedoch nur sein propagandistisch vorzeigbarer Bereich, in archivarischem Fremdmaterial sichtbar: Zu sehen sind etliche Aufnahmen, wie die titelgebende Reichsautobahn in bewerbend-feierlichen Dokumentar- und teilweise auch Spielfilmaufnahmen der Nazizeit errichtet wird. Ein mehrdimensionales Bild – bestehend aus Arbeitskrankheiten, Todesfällen und Ausbeutung, die mit der Forcierung des weitgehend nutzlosen Prestigeprojektes (das mehr Bilder und Geschichten nach sich zu ziehen schien, als Autos oder gar Kriegsgerät auf ihr fuhren) Hand in Hand gingen – kann uns nur der Voice-over andeuten.
In VW-Komplex (1989) schwenkt die Kamera sanft durch die zeitgenössischen Produktionshallen des Autobauers, und ein Arbeiter tut seine Sorge kund, dass die zunehmende Technisierung des Werkes zum weiteren Abbau von Arbeitsplätzen führen werde. Es wird auch ein Wandgemälde im Fabrikkomplex eingefangen, in dem sich ein Arbeiter in einer Art Illusionsmalerei eine durchbrochene Ziegelmauer mit einer dahinter liegenden Strandlandschaft imaginierte. Ein kitschiges Bild, das andere Dokumentaristen wohl kaum in ihre Informationsvermittlung einbezogen hätten, doch Bitomsky interessiert sich dafür, was es über den Produktionszusammenhang sagen könnte.
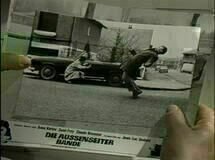
B-52 (2001) zeigt uns die Konstruktion und Dekonstruktion des titelgebenden amerikanischen Bombers sowie die Logistik, die nötig ist, um ihn in Bewegung zu setzen, damit von ihm potenziell eine Zerstörungskraft ausgeht. Eine zur Ikone gewordene Maschine – folgerichtig, dass auch der Besuch bei einem Maler, der sich auf ihre Darstellung besonders versteht, integriert ist. Von Staubpartikeln, wo sie überall bei Arbeit und Alltag anfallen und in welchen Wissenschafts- und Wirtschaftszweigen sie Nutzen und Erkenntnis nach sich ziehen, handelt schließlich der lose arrangierte Staub (2008).
Sich Bilder erarbeiten

Bitomskys Filme sind aber keine trockenen Abhandlungen in Filmform, die uns einfach ein bestimmtes Arbeitsfeld oder einen produzierten Gegenstand präsentieren. Diese filmischen Annäherungen – das ist auch wörtlich zu nehmen, oft werden Strukturen von der Kamera abgemessen und umschritten – handeln immer auch davon, dass man sich diese Bilder erarbeiten muss. Bitomsky rückt seine eigene ästhetische Arbeit ins Bild, seine Denk- und Suchbewegung, die keine Zusammenfassung liefert, sondern eher der Dramaturgie eines Road Movies folgt.
Die Arbeit mit Archivmaterial ist noch so ein wiederkehrendes Element in Bitomskys Werk. Das eine verweist auf das andere, Geschichte und Gegenwart verzahnen sich (zum Beispiel der Volkswagen im NS mit dem der 1980er Jahre; die verwaiste Reichsautobahn der 1940er Jahre mit dem Stau der Gegenwart), aber auch hier gibt es keine allwissende Instanz, die eine klare Ab- oder Herleitung präsentieren könnte. „Möglichkeitserwägungen“ trifft es eher, um mit Robert Musil einen weiteren Essay-Denker heranzuziehen.6 In Deutschlandbilder (1983), ein gemeinsam mit Heiner Mühlenbrock realisierter Film über die perfide Ästhetik des NS-Kulturfilms, artikuliert der Voice-over immer wieder Zweifel daran, ob man sich diesen Bildern aus der Gegenwart heraus überhaupt nähern kann, und wenn ja, dann wie. Diese Bilder sollen gängigerweise bezeugen, wie der Faschismus gewesen ist, seine filmische Illustration liefern. Doch sind sie von solch einer Verschleierungstaktik durchzogen, dass sie eher davon erzählen, was für andere Bilder sie verdeckt und verhindert haben. „Das Bild ist die Maske eines anderen“, heißt es am Ende.

Es gilt also, in einen Austausch mit Bildern zu treten, der ihren ästhetischen Eigenwert nicht missachtet, dabei aber im Auge zu behalten, dass der Gegenstand, den man verstehen will, mit dessen zirkulierenden Bildern nie deckungsgleich sein wird: „Die Bilder selbst sind schon eine Abweichung von den Dingen, wie sie sind, wie jede Produktion den Dingen etwas hinzufügt, eine kritische Masse.“7Die Integrität der Dinge zu achten, heißt dann mitunter auch, ihre Verstellung in Kauf nehmen oder mit eigenen Bildern von ihr zu erzählen. Imaginäre Architektur (1993) untersucht einige Bauten des modernen Architekten Hans Scharoun auf ihre Ästhetik und Sozialgeschichte hin. In der Villa Schminke, einem Klassiker des modernen Villenbaus, werden wir aber erst einmal einer trubeligen Situation gewahr: Kinder feiern eine Party, musikalisch begleitet vom Prinzen-Hit „Küssen verboten“. So hatte man sich die filmische Begehung nicht unbedingt vorgestellt; der Bau war aber zum damaligen Zeitpunkt zu einem Kindergarten umfunktionalisiert worden. Eine lustige Sequenz, in der uns die 1990er Jahre direkt entgegenkommen – Humor ist sonst nicht wirklich Bitomskys Sache.
Tücken des Objekts
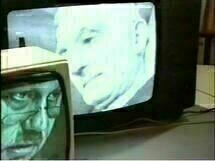
Mitunter sieht man Bitomsky in seinen Filmen auch selbst, wie er etwas betrachtet, mit Menschen spricht, Dingen nachspürt. Vor der Kamera soll die Wirklichkeit produziert, nicht bloß repräsentiert und konsumiert werden. Deshalb auch die Kritik an der Orthodoxie des Direct Cinema, nach der ein möglichst unscheinbares, sich nicht zu Erkennen gebendes Dabeisein bereits Authentizität verbürgt. In einem Text heißt es von Bitomsky dazu sinngemäß, hier werde die Suggestion einer Kriegsreportage in Friedenszeiten umgesetzt. Ein Filmemacher des uncontrolled cinema wie Richard Leacock ist ihm dennoch wichtig, da dieser eine klare Idee vom Dokumentarfilmen hatte, von der man sich dann gewissermaßen abstoßen kann.
Was die oben genannten Filme zunächst unscheinbar, allzu simpel erscheinen lassen mag, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ein gezielt undogmatischer Ansatz. Im gegenwärtigen Dokumentarfilm lässt sich eine Tendenz zur Formstrenge und erzählerischen Reduktion ausmachen, die gerade im Verzicht auf das gesprochene Wort ein Mittel in der Hand zu haben glaubt, die Dinge ganz für sich sprechen zu lassen. Solch eine Selbstevidenz ist aber nicht generell gegeben – manches verlangt nach einer weniger äußerlich bleibenden Darstellung. Bitomsky scheut deshalb beispielsweise keine oft verpönten Interviewsituationen, etwa mit Zeitzeugen in Reichsautobahn, Piloten in B-52 oder Filmexperten in Die Ufa (1992). Er ist kein Dokumentarfilm-Purist. Gleichzeitig hält er am eigenen Voice-over fest, das ihm aber wiederum nie poetischer Selbstzweck wird. Sich des Materials durch das gesprochene Wort gewaltsam zu bemächtigen, wie man es im neuesten Godard-Film Le livre d'image (2018) erfährt, liegt ihm fern. Da ist er nah bei Nestler: mit und durch Bilder reden, nicht mit mithilfe und über sie hinweg.

Dabei ist es nicht entscheidend, ob sie selbst hergestellt oder vorgefunden sind. Vorgefundene Bilder werden, abseits der genannten vorrangig Archivmaterial-basierten Deutschlandbilder und Reichsautobahn, intensiv in den Kino- und Filmgeschichtsreflexionen der späten 1980er bis 90er Jahre betrachtet – und dabei auf eigenwillige und bestechende Weise inszeniert.
Bilderlabore
Der Film, der wahrscheinlich am prägnantesten die Methode des mal mühsamen, mal spielerischen Dialogs mit dem Fundus vielfältiger Bildproduktionen der Filmgeschichte umsetzt, ist ein Fernsehbeitrag für den WDR von 1991 mit dem so schön umständlichen wie lakonischen Titel Das Kino und der Wind und die Photographie. Ein filmischer Essay in sieben Kapiteln zur Geschichte und Ästhetik des Dokumentarfilms, gleichzeitig eine räumliche Versuchsanordnung, die uns vor Augen führt, wie sich die Denkarbeit mit seinen Vertretern und Theoretikern gestalten ließe: In einem halbwegs unansehnlichen Arbeitsraum sind mehrere Monitore und VHS-Rekorder aufgestellt, um sie herum gruppieren sich Forschende und Betrachtende. Bitomsky und seine Mitarbeiter (darunter etwa sein Kameramann Carlos Bustamante und der angehende Regisseur Christian Petzold) durchschreiten den Raum, denken laut, stapeln Bücher, lesen Passagen aus ihnen vor, betrachten ausgesuchte Filme auf den Bildschirmen – zum Teil mehrere zeitgleich, was die Kamera in Form von innerbildlichen Montagen ins Bild setzt. Was auf den ersten Blick als ein spontaner Ausdruck der Beteiligten daherkommt, ist jedoch durchdacht und durchformt.
Auch hier wieder das Naheliegende und Schnörkellose: Man geht eben mit dem Material um, das man zur Verfügung hat, Verfremdungseffekte inbegriffen. Krisselige, deutsch synchronisierte Videokassetten-Versionen und fotografische Stills8 werden verwendet, die – begleitet von einer präzisen Beschreibung, Frage oder Deutung Bitomskys – einzelne Szenen veranschaulichen, oder besser: sezieren. Ziel ist es dabei nicht, die behandelten Filme (etwa von Humphrey Jennings, Robert Frank oder Robert J. Flaherty) ästhetisch adäquat zu repräsentieren; es kommt auf die Arbeit mit ihnen, auf die Vermittlung innerhalb des szenischen Aufbaus an – gewissermaßen eine Schule der Bildbetrachtung.

In dieser Filmarbeit ist auch ein Stück weit kommentiert, was in einem anderen Kinogeschichte-Essay, Kino Flächen Bunker – Das Kino und die Schauplätze (1991), anhand von Lew Kuleschows Theorie der Schöpferischen Geographie verhandelt wird: Durch das Zusammensetzen der Filmstücke wird ein filmischer Raum geschaffen, der vorgibt, Wirklichkeit zu sein, jedoch Resultat eines künstlerischen Kalküls ist: Bilder aus unterschiedlichen Kontexten ergeben durch Montagearbeit die Suggestion einer schlüssigen Erzählung. Statt das eine ins andere übergehen zu lassen, fügen sich die disparaten Dinge im Kino-Essay innerbildlich neu zusammen, stehen aber auch quer zueinander. Was dabei herauskommt, ist nicht wie bei Kuleschow die Lenkung des Betrachters, sondern eine Einstellungsweise, die einen anderen, offenen Blick auf Einblicke gewährt. Was sonst einfach an einem vorbeiziehen würde, wird sichtbar. Man ist zu sehr damit beschäftigt, sich auf das einzulassen, was im Bild zu sehen ist und vergisst darüber, wie es zu sehen ist. Noch einmal aus den Arbeitsjournalen: „Die Einstellungen kommen von den Dingen, die sichtbar sind, und sie kommen von den Bildern, die sichtbar machen. Dies sind zwei verschiedene Sachen.“9
Und dann ist es im Grunde auch nicht zutreffend, dass Bitomsky im Film erscheint: Es ist nicht eigentlich seine Person, seine Individualität, die uns hier interessiert. Er wird zur Figur, die den Gedanken eine Verkörperung verleiht. Robert Bresson, dessen letztem Film die Filmkritik unter Mitarbeit Bitomskys die filmische Gemeinschaftsarbeit L'argent von Bresson (1983) widmete, sprach in diesem Zusammenhang vom Modell statt vom Schauspieler. Man begleitet jemanden beim Sprechen und Bewegen; keine Identifikationsfigur oder Projektionsfläche. Das ausgestellte Sehen, Denken und Umschreiten scheint für Bitomsky näher an der Kino-Wahrheit dran zu sein.
Kino-Enthusiasmus

Was auf dem Papier vielleicht trocken und mitunter arg analytisch klingen mag, lässt als filmische Erfahrung auch immer eine Begeisterung am Kino spürbar werden. „Diese Untersuchung will nicht systematisch sein, es ist eher eine Art Wilderei, eine fröhliche Wissenschaft, in der das Wichtige neben dem Marginalen stehen darf und der Begriff in der Beiläufigkeit steckt. (…) Was dabei herauskommt, ist Kino-Enthusiasmus.“ Das hatte Bitomsky einmal zu seinem Das Kino und der Wind und die Photographie gesagt. Seine Arbeit an und mit den Bildern des Kinos macht stets Lust darauf, sich das vorzunehmen, was man noch nicht kennt oder noch nie so gesehen hat, oder es abermals hervorzuholen. Dabei steht Viktor Schklowskijs Verfremdungstheorie neben Hitchcocks Suspense-Vereinnahmungen; der Schein-Tod im kommerziellen Kino neben dem Wirklichkeitsgehalt des dokumentarischen, die amerikanische B-Movie pulp fiction, die keine überschüssige Einstellung kennt, neben dem Inuit Nanook, der in einem Moment dokumentarischer Durchlässigkeit in die Kamera lächelt.
Der Text ist ursprünglich im Begleitheft zur Hartmut-Bitomsky-Werkschau des GEGENkino-Festivals 2019 erschienen.
Einen Überblick des Programms gibt es hier.
Fußnoten:
1Theodor W. Adorno: Der Essay als Form. In: Noten zur Literatur. Frankfurt a. M. 1997, S. 10.
2Zitiert nach: Barbara Filser: Chris Marker und die Ungewissheit der Bilder. Paderborn/München 2010, S. 92. Aus: Obdachlose am Flughafen. Sprache und Film, Filmsprache. Harun Farocki im Gespräch mit Rembert Hüser. In: Jungle World, Nr. 46/2000.
3Hartmut Bitomsky: Zum Essayfilm. In: Marius Babias (Hg.): Hartmut Bitomsky – Geliehene Landschaften. Zur Praxis und Theorie des Dokumentarfilms. Arbeitsjournale, Aufzeichnungen, Tagebücher, Notizen und Texte. [Anlässlich der Ausstellung Hartmut Bitomsky. Shakkei - Geborgte Landschaft im Neuen Berliner Kunstverein, 25. September - 7. November 2010]. Köln 2012, S. 364.
4Hartmut Bitomsky: Die dokumentarische Welt (1997). In: Ilka Scharschmidt (Hg.): Kinowahrheit / Hartmut Bitomsky. Berlin 2003, S. 206.
5Hartmut Bitomsky: Finden, Zeigen, Halten. Notizen nach den Filmen von Peter Nestler (1979). In: Ebd. S. 146.
6Zitiert nach: Filser 2010, S. 83.
7Hartmut Bitomsky: Bilder im Schnitt (2000). In: Geliehene Landschaften, S. 183.
8Das Betrachten und Durchblättern fotografischer Reproduktionen wird auch in Das Kino und der Tod (1989) sowie L'Argent von Bresson (1983) in extenso betrieben. Kein materialtechnischer oder ästhetischer Mangel, sondern eine Reflexion darauf, dass eine Filmbetrachtung mit den Mitteln der Kinematografie immer schon eine Vermittlung darstellt: Schöpferische und zugleich kritische Nacherzählung; „Arbeit an der Überlieferung“ (Jutta Pirschtat).
9Hartmut Bitomsky: Die verlorene Form (2008). In: Geliehene Landschaften, S. 361.











Kommentare zu „Die Arbeit am Bild – Der Dokumentarist Hartmut Bitomsky“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.