Das Kino entdeutschen: Film Restored
Perspektive statt Thema: Das Film Restored Festival suchte in diesem Jahr die Erfahrung der Migration ins Zentrum zu stellen und ließ von dort aus den Blick schweifen: von Wolfsburg nach Bali, von Helsinki nach Frankfurt. Und warf auch filmpolitische Fragen auf.

Der Clou beim Begriff des Postmigrantischen, der mittlerweile nicht in aller, aber doch in mancher Munde ist, besteht darin, dass Migration kein Thema mehr sein will. Weder geht es um die Postmigrant*innen als gesellschaftliche Gruppe, noch zielt das entsprechende Adjektiv auf eine bestimmte historische Phase „nach“ der Migration ab. Eher kündet der Begriff von einem Perspektivwechsel, attestiert unserem ganzen Land einen Migrationshintergrund, nicht nur einzelnen seiner Bewohner*innen. Ein postmigrantischer Blick auf Deutschland, das ist ein Blick, der nicht mehr, ob in guter oder schlechter Absicht, von einer Norm ausgeht und die Abweichung betrachtet und der sich nicht mehr an der Trennung zwischen Migrantin und Nicht-Migrantin abarbeitet. Weil Migration deutsche und europäische Gesellschaften so fundamental durchzieht, dass wir alle Betroffene sind. Das Postmigrantische ist also kein Teil der, sondern eine Perspektive auf Gesellschaft.
Konsonanten und Paragrafen
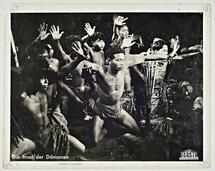
Die sechste Ausgabe des Film Restored Festivals der Deutschen Kinemathek, die Anfang November unter dem Motto „Cinematic Migrations“ frisch restaurierte Filme im Berliner Arsenal zeigte, ließ sich als Beitrag zum Projekt verstehen, nationale und internationale Geschichte aus Perspektive der Migration neu zu erzählen. Entsprechend weitläufig der Blick: Es liefen restaurierte Filme von Flüchtlingen aus NS-Deutschland (Robert Siodmaks The Killers, Peter Lorres Der Verlorene, Animationsfilme von Kurt Weiler und Lotte Reiniger); den Ausflug eines argentinischen Sängers in die USA der 1930er Jahre (The Day You Love Me, 1935) gab es ebenso zu bestaunen wie den eines jüdischen Ethnologen in die Südsee (Friedrich Dalsheims Insel der Dämonen, 1933 auf Bali gedreht). Einen besonderen Schwerpunkt aber bildeten die Arbeitsmigration im Europa der Nachkriegsjahrzehnte und die Fremdheitserfahrungen von sogenannten Gastarbeiter*innen aus dem Süden in den Industrieländern des Nordens.
So sehr die Migration kein Thema, sondern Perspektive sein will: Wenn von ihr erzählt wird, muss irgendwo angefangen werden, eine Gefahr insofern, dass die dramaturgische Struktur Heimat – Reise – Fremde dazu tendiert, doch wieder nur eine partikulare Erfahrung zu vermitteln, die Gesellschaften in Heimat und Fremde in Ruhe zu lassen. Eine ganze Stunde verweilt etwa Werner Schroeters episch angelegtes Gastarbeiter-Drama Palermo oder Wolfsburg, dessen digital restaurierte Fassung am Eröffnungsabend präsentiert wurde, in Sizilien. Ein sympathisch-schräges Paradies ist dieser Ort, es wird viel gesungen; das Deutschland, in dem der noch blutjunge Nicola (Nicola Zarbo) irgendwann ankommt – mit ähnlich streng guten Vorsätzen wie der Protagonist von Burhan Qurbanis Berlin Alexanderplatz (2019) –, ist dann nur noch schräg. Man ermahnt ihn gleich mal, doch nicht einfach die Schienen zu überqueren, man geht direkt weiter, wenn man ihn nicht versteht.

Schroeters Film bleibt in seinen durchaus klischeebehafteten Nationalporträts mitunter der Logik des Culture Clashs verhaftet, ihm gelingt aber im letzten Teil – in dem Nicola, dem für einen Doppelmord der Prozess gemacht wird – eine grandiose Verzerrung des Deutschen zu bitterer Kenntlichkeit. Konsonanten und Paragrafen verschwören sich dort miteinander, kapern die Körper von Richter, Staatsanwalt und Verteidigerin, ein gerichtsdeutscher Alptraum, der Nicola in den Wahnsinn treibt.
Fremde in der Heimat, Heimat in der Fremde

Auch Paul Meyers From the Branches Drops the Withered Blossom (Déjà s’envole la fleur maigre, 1960) beginnt in Italien, nur sind hier die Bilder noch schwer vom Neorealismus beeinflusst. Eine Familie wandert in eine belgische Bergbauregion aus, der Film nimmt die Perspektive des Sohnes ein, der mit Sprache, Ausgrenzung und einem ganzen neuen Leben zu kämpfen hat. The Foreigner (Ulkomaalainen/Yabancı, 1983) von Muammer Özer dreht die Struktur um, die Heimat steht nicht am Anfang, sondern sucht die Fremde heim. Nach einem kurzen illegalen Aufenthalt in Deutschland zieht ein türkischer Landarbeiter nach Finnland weiter. Dort rasen die Flaschen in einer Abfüllfabrik ähnlich schnell vorbei, wie die Nachrichten aus der Heimat sich überschlagen: Militärputsch 1971, der beste Freund in Gefahr, nichts kann man tun. Diasporische Zerrissenheit, der Putsch dort, das Geld hier. Am Ende ist alles Fragment, Montage, Desintegration.
Mahmoud Ben Mahmouds Debütfilm Crossing Over (Traversées, 1982) umgeht die Gegenüberstellung zwischen Heimat und Fremde gänzlich, verschreibt sich ganz dem Dazwischen, das in diesem Falle von einem nordafrikanischen Intellektuellen und einem hyperaktiven Polen bewohnt wird. Beider Papiere werden sowohl im britischen Dover als auch im belgischen Ostende nicht anerkannt, und so pendeln sie auf der Fähre zwischen den Staaten hin und her, lernen sich wider Willen kennen, schließlich macht eine Frau vom Schiff, aus anderen Gründen ausgegrenzt, das Duo zum Trio. Crossing Over ist angenehm kulturlos, schiebt die jeweiligen spezifischen und politischen Hintergründe der Figuren vor jede nationale Eigenheit und erschafft einen Ort, der die Ausgeschlossenen zu Allianzen zwingt.
Dokumente auf der Tonspur

In all den bislang erwähnten Filmen – ebenso wie in Klassikern wie Angst essen Seele auf (1974) oder neueren postmigrantischen Filme wie Exil (2019), Berlin Alexanderplatz (2019) und Le Prince (2020) – ist Migration Männersache, sind Frauen, ob herkunftsdeutsch oder nicht, eher Aspekt als Subjekt der migrantischen Erfahrung. Zwei der interessantesten Entdeckungen des Festivals sind entsprechend Filme, in denen weibliche Migration im Zentrum steht: In Hannelore Unterbergs auf einem Hörspiel basierendem DEFA-Film Isabel auf der Treppe (1984) geht es um Rosita, die mit ihrer kleinen Tochter Isabel aus Chile in die DDR geflohen ist, dort zunächst von einer Patenfamilie namens Kunze umsorgt wurde, die wiederum nun, sechs Jahre später, nichts mehr von den ausländischen Nachbarn wissen will. Es hat sich ausgeholfen. Hoffnung geben nur Jung und Alt: Opa Kunze freundet sich mit Rosita an, der Sohn büxt irgendwann mit Isabel aus, Rositas Tochter, die im Filmtitel auf der Treppe sitzt, weil sie auf Post vom Vater wartet. Der jüngste Kunze haut einmal, etwas zu weise für sein Alter, aber irgendwie auch toll, seinen Eltern ein bisschen Wahrheit um die Ohren: „Ich glaube, ihr denkt, die Chilenen müssen dankbar sein. Ihr zahlt euren Soli, und damit ist gut.“ Was ein Kindermund!
Und dann gab es da noch Das höchste Gut einer Frau ist ihr Schweigen von 1980, einen Film, der derzeit auch auf der Retrospektive beim Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg zu sehen ist. Regisseurin Gertrud Pinkus wollte eigentlich einen Dokumentarfilm über ein paar der italienischen Frauen drehen, die in ihrem Haus wohnen, doch die wollten aus Angst vor Gerede in der Heimat nicht vor die Kamera treten. Pinkus ging nun nicht den Weg einer klassischen Fiktionalisierung, sondern beließ die Tonspur dokumentarisch. Dort erzählt Maria von Vergangenheit und Gegenwart, während ihre Erzählungen von einer anderen Gastarbeiterin gespielt werden.

Ihre Schilderungen sind manchmal existenziell traurig – wie das Leben vorbeizieht, ohne dass man mal Zeit gehabt hätte, die nicht für die Arbeit oder die Kinder draufgeht; selbst die Freundschaft zu einer türkischen Kollegin bleibt in den spärlichen Pausen auf der Arbeit stecken –, manchmal fast komisch. Einmal beschwert sich Maria, dass die Verkäuferin an der Fleischtheke ihre Geste nicht versteht, sich vielmehr über sie lustig macht. „Als Ausländer bist du hier der letzte Trottel. Wir Italiener machen eine Geste und verstehen sofort. Denen hier musst du alles ganz genau ausdeutschen, bis die endlich kapieren.“ Ob diese sprachliche Innovation schon im italienischen Original steckt oder auf eine originelle Untertitelung zurückgeht: Ein gelungener Begriff für die Anforderungen, die dieses Land an jene stellt, die fürs Dazugehören etwas leisten müssen, ist es allemal.
Erschütterungen gesucht

Lieber mal alles entdeutschen, als alles auszudeutschen, das ist indes nicht nur Aufgabe für Filmschaffende, sondern auch für die Filmpolitik. Denn selbst wenn sich dieses Deutschland allmählich als das Einwanderungsland begreift, das es immer schon war, zeigt die bislang dominante Realitätsverweigerung weiterhin allerlei Wirkungen, zum Beispiel aufs Filmerbe. Das ist Thema bei einer Podiumsdiskussion, in der Can Sungu, Initiator und Kurator des Sinema-Transtopia-Projekts im Berliner Haus der Statistik, über die Hindernisse spricht, etwa jene Amateurfilme zu restaurieren, die die ersten Gastarbeiter*innen in den 1960er und 1970er Jahren gedreht und in privaten Screenings aufgeführt haben. Ein unschätzbarer Teil deutscher (Film-)Geschichte, der jedoch aufgrund altbackener Definitionen von „deutscher Film“ im Filmfördergesetz von 1967 – von Deutschen gedreht, auf Deutsch gedreht usw. – nicht mit Fördergeldern der entsprechenden Institutionen gerettet werden kann. Ein eindrückliches Beispiel für die Notwendigkeit, das postmigrantische Kino nicht als ästhetische Spielerei, sondern als institutionelle Herausforderung zu begreifen – und die zunehmend hörbaren migrantischen Stimmen nicht als diversifizierende Ergänzung, sondern als nachhaltige Erschütterung der Gesellschaft.








Kommentare zu „Das Kino entdeutschen: Film Restored “
Ines
Ich bin ziemlich entsetzt über den Begriff "entdeutschen". Das ist mal wieder etwas durchaus Wohlgemeintes, welches aber begrifflich an den schlimmsten Gebrauch von Wörtern in Nazideutschland erinnert. Bitte mal LTI von Victor Klemperer lesen und über das Neuschöpfen von Wörtern nachdenken.
Leander
Ja. Sowas geht nämlich garnichd in Teutschland.