Cannes bekommt den Blues
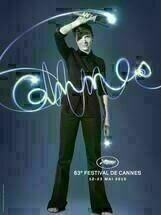
Nun geht es also wieder los. Cannes, da lässt sich nicht drum herum reden, ist das wichtigste Filmfestival der Welt, und eines der schönsten überdies. Weil hier doch immer im Schnitt sehr sehr gute Filme laufen, bis in die entlegenen Nebensektionen hinein, manchmal dort sogar bessere, als im Wettbewerb. Weil das Wetter toll ist. Weil Cannes wie ein Raumschiff funktioniert, das zur Eröffnung abhebt, und in dem man dann drinsitzt, und zwei Wochen lang die reale Welt hinter sich lässt: Finanzkrisen, Umweltkatastrophen und Guido Westerwelle einfach mal vergessen darf (es sei denn, sie erscheinen plötzlich auf der Leinwand).
Auf die Gefahr hin, ketzerisch zu erscheinen, muss auf das generelle Lob jetzt gleich eine Einschränkung folgen, und die ist eher empirischer Natur: Ein seltsames Startgefühl hängt ein wenig mehltauhaft über dem Auftakt zu diesem Jahr. Ob es nur am für Cannes schlechten weil kühlen Wolkenwetter liegt? Oder am latenten Krisengefühl, das sich in der Pressekonferenz vor Auftakt zeigte, als Cannes-Leiter Thierry Fremaux meinte, 2010 sei ein schwieriges Jahr. Oder in Nebenbemerkungen der Auftaktartikel, etwa jener, es gäbe in diesem Jahr kaum Partys. Nein, dann haben wir ja mehr Zeit, um ins Kino zu gehen, und zu den Partys bekommt man sowieso selten eine Einladung. Es ist vielleicht einfach der Eindruck, den das Festival in diesem Jahr macht, wenn man nur mal ins Programm blickt: Im letzten Jahr sah man hier Haneke, Tarantino, von Trier, Coppola und viele derartige Legenden zu Lebzeiten mehr. „Das war letztes Jahr so, als ob Marx, Engels, Lenin und Stalin auf einmal da waren.“ meint Jeroen, der Kollege vom recht anspruchsvollen niederländischen „Filmkrant“, ohne allerdings zu präzisieren, wen er denn für den Stalin des Kinos hält.
Genau genommen sieht das Programm soviel unscheinbarer auch gar nicht aus: Immerhin die Namen Abbas Kiarostami, Alejandro González Iñárritu, Apichatpong Weerasethakul, Mike Leigh, Bertrand Tavernier, Takeshi Kitano und Lee Chang-dong liest man da, alles bekannte Regisseure, dazu „bekannte Unbekannte“ wie Wang Xiaoshuai, Rachid Bouchareb und Kornél Mundruczo, und außer Konkurrenz Regie-Weltstars wie Ridley Scott, Oliver Stone, Stephen Frears, Olivier Assayas, in der Nebensektion „Un Certain Regard“ dann kein Geringerer als Jean-Luc Godard, und dazu Regisseure wie Jia Zhang-ke oder auch Christoph Hochhäusler.

Die merkwürdige, aber doch bezeichnende Erfahrung nach der Ansicht von Ridley Scotts Robin Hood, mit dem Cannes am Mittwoch eröffnet wurde: Man findet den Film eigentlich bis auf die letzte langweilige halbe Stunde ganz in Ordnung, hat sogar den Anfang richtig genossen, mit seinen Bildern von Rittern im Matsch, einem ebenso fetten wie frustrierten, doch recht aheroischen Richard Löwenherz, und dann sitzt man da im Presseraum, und es fällt einem plötzlich nicht wirklich etwas ein zu dem Film. Ein diffuses Werk. Wäre es ein Ritterfilm wäre das besser, das Sujet „Robin Hood“ scheint Scott eher zu stören, weshalb er allem Robin-Hood-haften konsequent ausweicht.
Was bleibt, ist der Eindruck von Scotts unbändiger Energie, seiner Fähigkeit, soliden Hollywood-Mainstream zu machen, und sich trotzdem über die Jahre eine eigene Handschrift bewahrt zu haben, also Autor zu sein. Da ähnelt er Regisseuren wie Anthony Mann oder Henry Hathaway, der ja übrigens mal einen Prinz Eisenherz-Film gemacht hat. Dass der gerade auf DVD herausgekommen ist, war offenbar Gesprächsthema bei den Kölner Kollegen, denn gleich zwei kamen gestern irgendwann auf mich zu mit der identischen Bemerkung, Hathaways Prinz Eisenherz sei ja mal um Meilen besser und übrigens gerade auf DVD… Mir gefallen hat an Robin Hood Scotts Interesse für Handwerk, besonders Kriegshandwerk, beispielsweise dafür, wie im Mittelalter eine Burg geknackt wurde. Aber dies ist kein Film, an den sich in fünf Jahren noch irgendwer erinnern wird.
Chongqing ist eine der größten und eine der unbekanntesten Städte der Welt. Schon eine Reihe chinesischer Filme spielen hier, und so, wie man mit etwas Erfahrung sofort erkennt, ob ein Film in Peking oder Shanghai spielt, erkennt man auch das spezielle Licht, und die Atmosphäre von Chongqing schnell. Die Luft ist offenbar schlecht dort, und sehr feucht, es scheint immer nebelig zu sein, und die chinesischen Filmemacher tauchen die Stadt immer in ein leicht bläuliches Licht. All dies trifft auch auf Chongqing Blues von Wang Xiaoshuai zu, mit dem am Donnerstag der Wettbewerb begann.

Im Zentrum des von der Zensurbehörde genehmigten Films steht ein älterer Mann, ein Seemann, der nach 14 Jahren zurück in sein altes Leben kommt. Für ein paar Tage ist er in Chongqing, und schon als er als erstes seinen gleich alten besten Freund trifft, erfahren wir, warum: Sein Sohn ist tot, er wurde von der Polizei erschossen, als er in einem Supermarkt eine Geisel genommen hatte. Mühsam versucht der Vater, den Tod des Sohnes zu rekonstruieren. Wie ein Detektiv sammelt er Aussagen, Puzzlestücke, aus dem sich das Bild der Tat und ihrer Vorgeschichte nur gegen viele Widerstände zusammensetzen lässt.
Am Anfang ist der Film ganz Suche, ganz offen; wir beobachten den Beobachter und lernen mit ihm das Chongqing von heute kennen, einen Transitions-Raum zwischen Vergangenheit und Zukunft, Alt und Neu, traditionellen kleinen Läden und modernen Shopping Malls, Garküchen mit Mahjong-Tischen und Techno-Dance-Clubs für die Jugend und sehr sehr viele verschiedene Verkehrsmittel. Gezeigt wird das mittels einer sehr guten Handkamera, die an den Menschen immer ganz nahe dran ist; lange Einstellungen und ruhige Schwenks oder auch mal eine 360-Grad-Kreisfahrt ersetzen wo es passt die Schnitte, die dann, wenn sie da sind, oft die Bilder ruckartig vorantreiben, also noch betont werden.

Worum es in einem grundsätzlicheren Sinn geht, jenseits eines Portraits des modernen China, und dem Verhältnis der Generationen – die Schuldgefühle des Vaters sind genauso evident wie die Ratlosigkeit der Älteren angesichts einer Jugend, deren Leben ohne Sinn scheint –, ist der Umgang mit Erinnerung, mit Vergangenheit allgemein. Gegen das europäische Zerreden von Gefühlen, das Erbe der Psychoanalyse mit seiner Verdammung der Verdrängung und seinem Zwang zum Aufarbeiten zeigt der Film Menschen, die die (hier vom Vater gewünschte) Aussprache verweigern, die nach einer traumatischen Erfahrung einfach weitermachen. „ I don't want to talk”, das hört man hier oft. Das gipfelt einmal in einer tollen Szene, in der der Vater seiner Ex-Frau minutenlang durch einen überfüllten Laden hinterherläuft, sie mit Fragen bedrängt, während die einfach bis zum Ende gar nichts sagt.
Dabei ist dieses Schweigen sehr sprechend, und Wang Xiaoshuai arbeitet damit auch auf der Bildebene in Form prägnanter Auslassungen, eines grundsätzlich fragmentarischen Erzählens. Man ertappt sich beim Zusehen auch dabei, über China und seinen Umgang mit Gefühlen nachzudenken, darüber wie große Sentimentalität und ein gewisser Kitsch, wenn man es mal salopp so formulieren darf, hier mit dem Eindruck von Kälte und Ungerührtheit zusammengehen. Chinesen fühlen offenkundig anders, sind aber keineswegs gefühlloser.
So ganz bekommt der Film dann aber nicht die Kurve. Zum einen ist er nicht sehr konsequent: Anfangs sehen und wissen wir nicht mehr als der Vater, dann aber zeigt der Regisseur uns den Sohn in Flashbacks, die die Erzählungen der Befragten illustrieren, und wir sehen auf einmal den Sohn und damit viel mehr, als der Vater, der bis zum Filmende kein Bild des Jungen hat. Vor allem aber ist alles am Ende zu auserzählt, und damit deutlich weniger kunstvoll und interessant als andere neue chinesische Filme, die unverständlicherweise nicht nach Cannes eingeladen wurden, etwa The High Life von Zhao Dayong. Vielleicht liegt das auch an einem gewissen zähmenden Einfluss der europäischen Koproduzenten: Denn Chongqing Blues wurde von Isabelle Glachant produziert, eine sehr einflussreihe Französin mit Büro in Peking. Sie hatte neben vielem zuvor, unter anderem den früheren Filmen von Wang Xiaoshuai, zuletzt auch Lu Chuans City of Life and Death über das Massaker von Nanking produziert, der 2009 das Filmfestival von San Sebastian gewann.
Trotz solcher Einwände: Ein interessanter Wettbewerbsauftakt.

Dafür, dass wir dann nicht zu sehr in künstlerische Höhen abhoben, sorgte ein Autor der BILD-Zeitung, der, ohne zu wissen, dass wir Deutsch verstehen, neben uns ins Telefon zunächst von „der Hassliebe zwischen Frankreich und England“ schwadronierte, mit dem Zusatz „Ridley Scott hat ja auch ein großes Haus in der Bretagne“, und dann diktierte, was wirklich wichtig ist, in Cannes: „Nie gingen mehr Menschen ins Kino. Absatz. Filme sind die großen Mythen unserer Zeit, verzaubern uns in zwei Stunden. Ausrufezeichen. Der Blick auf die schönste Bucht der Welt. Wie viele Yachten der Milliardäre schwimmen unter dem glühenden Sonnenuntergang. Fragezeichen. Über 50. Ausrufezeichen. Letztes Jahr, Starrummel Klammer Inglorious Basterds mit Brad Pitt, Angelina Jolie, Til Schweiger - und Christoph Waltz, Klammer zu. Punkt. Hat die Finanzkrise Cannes erreicht. Fragezeichen. Ja. Es gibt weniger Partys…"








Kommentare zu „Cannes bekommt den Blues“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.