18. Hofbauerkongress: Metamorphose durch Trivialisierung
Gemeinsam die Orientierung verlieren, Filme sehen, die wie schlüpfrige Illustrierte sind, mit der Bewusstseinsschlacke der alten BRD konfrontiert werden oder mit der fragilen Schönheit einer Teenagerliebe: Der Hofbauerkongress ist volljährig geworden. Das würdigen wir mit einer XXL-Collage an Festivaleindrücken.
Das Gemeine in einen Sofakasten sperren

„Niemand sei mehr glücklich im Abendland, meinte sie weiter, niemals mehr, wir müssten das Glück als einen vergangenen Traum betrachten, die historischen Bedingungen seien schlicht nicht mehr gegeben.“ (Aus SEROTONIN von Michel Houellebecq, den gerade alle lesen, auch ich.)
Ich habe in Nürnberg ein bisschen Glück erfahren. Doch es war kein reines Glück, nichts Pures und aus dem Nichts Kommendes, sondern eher eine Aufmerksamkeit, die sich auf bestimmte Filme richten konnte und die sich dann in Glücksgefühle übersetzte. Es waren nicht die Filme, die mich am meisten amüsiert hätten oder durch die sich ein besonderes Wohlgefühl eingestellt hätte. Auf ihre Art waren es vielleicht sogar drei besonders düstere. Ich möchte sie hier nennen und damit möglicherweise auch vor einem neuerlichen Vergessen bewahren: 24 Stunden aus dem Leben einer Frau (1931) von Robert Land, Caribia (1978) von Arthur Maria Rabenalt und Lisa! (2018) von Mario Schollenberger. (Mit den genannten Entstehungsjahren hangelt sich das Trio am ganzen Hofbauer-Zeitstrahl entlang.)
Robert Lands Film hat gerade erst das Sprechen gelernt, und man merkt es ihm an. Die Sätze sind so kurz, sie könnten noch immer als Texttafeln zwischen den Bildern stehen. Die Menschen im Film wirken steif, obwohl sie geschult darin sind, mit ihren Gesichtern zu spielen, vielleicht deswegen. Eine sticht heraus, eine Frau, moderner als die anderen, die ihre eine Schulter lässig nach oben streckt und die Hand in die Hüfte stützt, die weiß, was Sache ist, durch die Welt reist und mondän ist. Ihr gegenüber die Hauptfigur, ein Frauenbild wie eine Träne, ein Tropfen, der traurig nach unten fallen möchte. Sie will einen Spielsüchtigen zu einem anderen Leben ermuntern, vielleicht zu einem mit ihr. Das ist viel Tragik und Langsamkeit vor einer opulenten Kulisse, Monte Carlo war es, glaube ich, und die Möbel in den Hotelzimmern wirken, als könnten Papageien auf ihnen sitzen. Gleichzeitig ist da ein Schrank, der aussieht wie zwei Särge. 24 Stunden im Leben einer Frau hat auch etwas von einem Tropenfieber, das Casino scheint an ein Sanatorium angegliedert, in dem die Reichen mit ihrem Geld dahinschwinden.
Damit hat Lands Film gar nicht so wenig mit Rabenalts Caribia zu tun, wohl einer der Programmpunkte, bei dem allesamt gemeinsam die Orientierung verloren. Auch er langsam und ausschweifend erzählt, fast, als läge ein großformatiger Bildband vor einem, dessen Seiten man behutsam umblätterte. Gefühlt nimmt sich Caribia die Hälfte der Laufzeit, um seine tanzenden Kaspar Hausers einzuführen – sechs schöne junge Menschen, denen der Kontakt mit der Außenwelt bis auf eine Bezugsperson versagt geblieben ist. In haitischen Hütten wuchsen auf diese Weise prächtige Exemplare der menschlichen Gattung heran, jeder mit einem eigenen Spezialfeature ausgestattet. Balletttänzer (wer hat ihnen das beigebracht), die an Stränden und schwülen Lichtungen erfahren, was es bedeuten kann, wenn Mann und Frau einander begegnen. Ein wirklich abenteuerliches Konglomerat, in dem irgendwie auch kolonialistische Strukturen verhandelt werden und der Wunsch nach Freiheit. Zum Schluss läuft das ganze Experiment jedenfalls gewaltig aus dem Ruder, aber es lässt sich auch nicht sagen, wohin.
Noch nicht vergessen ist Lisa! von Mario Schollenberger. Gewiss kennen ihn bisher aber auch nicht ausreichend Leute. Ein Projekt, an dem der Regisseur einige Jahre drehte (man sieht es nicht, so flüssig greifen die Szenen ineinander) und das mir ein Berlin gezeigt hat, um das ich weiß und das ich spüre, aber filmisch noch nie so vorgefunden habe. Lisa! ist in kuriosen Unecken fotografiert, die manches Mal etwas Steppenhaftes haben. Eben diese breiten, endlosen Straßen, auf denen man im Sommer zu vertrocknen droht. Lisa! weckt in mir auch das seltsame Empfinden, dass es möglich gewesen wäre, in Berlin zurechtzukommen, wenn man es ein bisschen mehr hätte so halten können wie die Titelfigur: Die vorhandene Rohheit mit einer eigenen Rohheit konfrontieren. Rache üben. Das Gemeine in einen Sofakasten sperren, es betäuben, mit von Sperma versetzten Breigerichten füttern und sich gelegentlich von ihm lecken lassen. Tja. Wieder waren in Nürnberg also Möglichkeiten und Lebensvorschläge zu sehen, die man gemeinhin vor den Augen der Zuschauer zu verheimlichen sucht. Gut, dass die Hofbauer-Kommandanten diesen Missstand immer wieder aufs Neue korrigieren.
Carolin Weidner
Männlicher Blick außer Kontrolle

Frauen, die wieder und wieder aus Häusern treten und dabei wieder und wieder von einem frischen musikalischen Motiv begrüßt werden. Die Tonspur treibt die Wiederholungen in immer stärkere Verkürzungen, es hat akustisch etwas Delirantes, wenn nicht Quälendes, als ob der Film seiner Ellipsen selbst überdrüssig würde. Die Männer drehen sich um (Gli italiani si voltano) heißt der 18-minütige Teil, den Alberto Lattuada zu dem Omnibusfilm Liebe in der Stadt (L’amore in città) von 1953 beigesteuert hat. Eine stumme Studie des Schauens, Nachschauens, Begehrens und darüber hinaus, und im begrifflich schwerer zu fassenden Dazwischen liegt die Brisanz des Films.
In seinen inszenierten Szenen macht er Witze: Ein beleibterer Mann entscheidet sich, seine Bewegung zu ändern und einer vorbeigehenden Frau viele Treppenstufen lang zu folgen, ehe sie am Ende der Treppe auf ihre Verabredung trifft und der vom Nachsteigen immer weiter angeheizte Plan – ja, welcher? – ihres Verfolgers in Enttäuschung resultiert, die der Film mit einem Gag kaschiert; der Mann wischt sich den Schweiß von der Stirn. In den dokumentarischen Szenen ist die Sache offener: Die Männer drehen sich schon nach der Frau um, die zwischen ihnen über Bürgersteige läuft, aber sie schauen damit auch dem Aufbau nach, der diese Frau schützt – den Dreharbeiten.
An manchen Stellen wirkt Lattuadas Film, als geriete ihm die kinoklassische Schönheitsbewunderung von Körpern, Linien, Silhouetten, die Bewunderung eines männlichen Blicks außer Kontrolle, weil es nicht beim Schauen und Bewundern bleibt (dass die Frauenkörper hier vor allem Objekte sind, ist Prämisse des Films, die sich gegen Ende aber auch zart korrigiert), sondern sich ins Stalken und Übergriffige fortsetzt. Gleichzeitig verlässt der Film, gerade zum Schluss, wenn er mit den Frauen in volle Busse steigt und das Angefasst-Werden unter dem Vorwand der Gedrängtheit gezeigt wird, seine Distanz zu den Figuren der Beobachtung. Im Bus wechselt der Modus des Betrachtens ins Panische des Übergriffs, und wenn ein Mann einer Frau schließlich bis an die Endhaltestelle folgt, wo sie sich raschen Schrittes in ihr Haus entzieht (trübe Pointe des strahlenden Auftakts), dann ist der Mann allein mit seinem unerklärten, ziellosen Trieb (hätte er sie nur ansprechen oder gleich vergewaltigen wollen?) – auf der Straße einer gerade fertiggestellten, noch von Baustellen-Accessoires gesäumten Siedlung. Ein großes, modernes Bild: Die Männer drehen sich um weiß um die männliche Gewalt, hat aber, anders als für die weibliche Schönheit, die er selbst beschwört, keine konkreten Begriffe, einnehmbaren Perspektiven dafür.
Matthias Dell
Ein Lächeln, das nichts fordert

Die erste Liebesszene in Therese and Isabelle (1968) spielt auf der Toilette des Mädcheninternats, das – wer sonst - Therese (Essy Persson) und Isabelle (Anna Gaël) gemeinsam besuchen. Isabelle, die erfahrenere, souveränere und auch ein wenig größere der beiden, nähert sich Therese seelenruhig und doch begehrend an, die ihrerseits nicht recht weiß, wie sie sich verhalten soll und schließlich unruhig das Gesicht verziehend zurückweicht. Eine Großaufnahme isoliert die beiden Gesichter vor der mit harmlosem Unsinn vollgeschmierten Toilettenwand: Isabelles Gesicht und vor allem das Lächeln in diesem Gesicht wird zu einem Ufo, mit dem Therese, die anders als ihre Freundin nie ganz eins mit ihrem Körper ist und deren Gesicht manchmal regelrecht in sich zusammenzufallen zu drohen scheint, eine unheimliche Begegnung der dritten Art hat.
In Mädchen von 18 Jahren (1955), dem anderen großen Mädcheninternatsfilm des Festivals, gibt es keine Liebesszene, aber etwas Ähnliches. Tatsächlich hat sich Anna (Marisa Allasio), das quirlige Alphamädchen der Schule, selbst eingeredet, dass sie Maria (Virni Lisi), die stille, strebsame, statueske Außenseiterin, hasst. Vorderhand, weil sie in ihr eine Nebenbuhlerin um die Gunst des feschen Physiklehrers sieht; aber eigentlich, das suggeriert die schönste Szene des Films, wenn nicht des Kongresses, weil sie sich insgeheim nach einer tieferen Verbindung sehnt. Nachdem Maria, auch aufgrund von Annas Bullying, verunglückt und auf eine Bluttransfusion angewiesen ist, entdeckt Anna, dass die Blutgruppen der beiden kompatibel sind. Und so liegen sie nebeneinander auf dem Krankenbett, verbunden durch einen Plastikschlauch, der ihr Innerstes ineinanderfließen lässt – und dann legt Anna den Kopf auf die Seite und blickt Maria an. Auf ihrem Gesicht ein Lächeln, das, anders als das in Therese and Isabelle, nichts fordert.
Lukas Foerster
Wird man wohl noch sagen dürfen
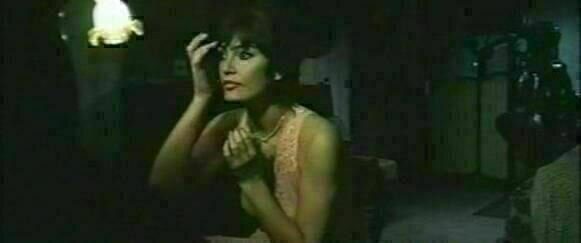
Zur Volljährigkeit nun alles Gute, lieber Hofbauerkongress, der du seit deiner frühen Pubertät meine Jahresanfänge begleitest und sie cineastisch einläutest. In meiner dreitägigen Anwesenheit hat mich heuer – so ehrlich darf ich sein, nichts mehr so wirklich vom Sessel geblasen, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Trotzdem waren wieder einige Entdeckungen dabei – und das Vergnügen, in einem übervollen Saal mit lauter Filmbegeisterten Jahrzehnte vergrabene Kinoschätze zu heben, wird dadurch keinesfalls geschmälert. Im Gedächtnis bleiben für mich kleine Szenen, Einstellungen, Momente: Marisa Mell traumwandelt in Osceno Desiderio (1978) durchs Herrenhaus und beobachtet eine Zeitlupen-Orgie nach der anderen (der Film verlässt sich völlig auf Carlo Savinas Soundtrack); die letzte Einstellung aus dem Vorfilm Annes erster Kuss (1989), die nur die Treppen zum Schulhaus zeigt (offensichtlich sollte da ein Abspann drüber liegen), in dem endlich ein junges Glück zusammengefunden hat, und – ganz groß – eine kurze Aufnahme, in der der Spieler aus 24 Stunden aus dem Leben einer Frau (1931) durch eine Hintergasse in Monte Carlo geht, über ihm die Wäsche, die aus den Fenstern zum Trocknen hängt: ein Funke vom echten Leben in einem ansonsten bleischweren Film.
Florian Widegger
Fugen mit laufenden Leuten

Bei meinem ersten Besuch eines außerordentlichen Filmkongresses des Hofbauer-Kommandos lief in der zweiten Nacht ein Erotikthriller, der mich seitdem begleitet. Joe D’Amatos Das Testament der Begierde (1990) zeichnete sich weniger durch eine ausgefallene Handlung aus als vielmehr durch seine Füllszenen. Von Anfang an wurde die Spielzeit mit Sequenzen gestreckt, in denen nichts passierte. Eine Frau geht vom Flugzeug zum Auto, wird anschließend darin gefahren, Menschen laufen Straßen und Auffahrten hoch und runter. Nichts davon wird nur angedeutet, jede Handlung von Anfang bis Ende ausgehalten. Was damals ziemlich amateurhaft und stümperhaft auf mich wirkte – zugleich schwang aber auch etwas darin mit, was dieses Gefühl unterminierte. So schaut besagte im Auto sitzende Frau auf die Uhr und bringt die Verwunderung darüber, das von Anfang an nichts passieren möchte, auf die Leinwand. Noch viel schöner aber sind die Einstellungen, wo Mann und Frau nach einer strengen Choreografie eine Straße heruntergehen. Sie biegen um eine Ecke und laufen bis zur Kamera. Weder reden sie miteinander, noch geschieht etwas. Schnitt – und dann geht’s erneut um eine Ecke, diesmal spiegelverkehrt, und das Gleiche geschieht abermals. Und dann, abermals gespiegelt, gleich noch einmal. Ich bekomme es nicht aus dem Kopf: Wieso wird so viel Liebe, Zeit und Genauigkeit auf etwas auf den ersten Blick so nutzlos Dauerndes aufgebracht? Zum Glück habe ich diese Fugen durch einen Hofbauer-Kommandanten kondensiert in einem Video und kann sie immer wieder anschauen, sie genießen und über sie sinnieren. Joe D’Amato ist inzwischen einer meiner liebsten Regisseure, weil er das Slow Cinema völlig verquer in seine „billigen“ Exploitationunternehmen einbringt.
Dieses Jahr kam als Ersatz für einen Film, den ich heiß ersehnt hatte (Velluto nero, 1976), für den die Untertitel aber leider nicht rechtzeitig fertig wurden, ein hochwertiger VHS-Scan von Hot Steps (1990). Dieser stammt ebenso aus D’Amatos Werkstatt Filmirage und entstand zeitgleich mit Das Testament der Begierde. Regie führte der US-amerikanische Kameramann Gerry Lively. Ein wenig erinnert dieser Tanzfilm an D’Amatos Meisterwerk Dirty Love (1988) und erzählt mittels des „Spielberg-Gesichts“ von Tanz als Sexsubstitut und offen gewährtem Voyeurismus. Fugen mit laufenden Leuten gab es, kaum war es zu erhoffen, aber auch. Vielleicht hat D’Amato das gleich zum Hausstil erklärt? Dieser Gedanke erfüllt mich mit seltsam viel Glück. Doch unter der Hand von Lively sind sie anders. Kürzer vor allem. Skizzen, mit deutlich mehr Gloss als bei D’Amato. Hot Steps zeigt einem, wie eine Hollywoodversion eines der eigenwilligsten Stilmittel aussehen würde, die ich bisher kennengelernt habe. Und darüber bin ich auch noch nicht hinweggekommen. Die teilweise hörbare Freude im Saal, als unverhofft auch hier losgelaufen wurde, sie zeigte mir, ich bin nicht allein, nicht bei diesem wunderbaren Filmfestival.
Robert Wagner
Alles Gute, Monika!

Manchmal scheint mir ein Film wie für mich gemacht. Als käme er aus der Herzkammer eines verschütteten Teenie- oder Twen-Ichs, mit Plastik-Kirschen im Haar. Und mit Middle of the Road in den Ohren. In Ich – Das Abenteuer, heute eine Frau zu sein (1972) tanzen Monika und ihr Verehrer in einer Mini-Disco zu MotRs glühendem, limonadig perlendem Song „Soley, Soley“, mit der alten, zuversichtlichen Freude auf ein Leben wie im Freibad. MotRs Sängerin Sally hat diese kindlich-kräftig krähende Stimme, die oft doppelt klingt, als wäre neben ihr noch ein Dämon da, den ihre Musiker beschützen. Doch wenn sie solo singt, klingt sie ganz unschuldig und lieb. Letzten Sommer haben wir in Frankfurt beim „Terza Visione“ einen Film gesehen, zu dem Middle of the Road den Soundtrack geschrieben haben, Ein Sommer voller Zärtlichkeit (1971), mit Ornella Muti. Auch dort klingen sie so schwerelos und populär. Inklusiv. All you can. Es scheint so leicht und billig, happy zu sein.
Ich – Das Abenteuer … ist widersprüchlich wie Middle of the Road. Oberflächlich ist er eine beschwingte, etwas schlüpfrige Illustrierte, die man zwischendurch beim Schwimmen am Baggersee liest. Darunter aber steckt ein wahrer, dunkler, harter Kern, der von dem süßen, bunten, zugänglichen und leicht verdaulichen Fruchtfleisch dieses Filmes beschützt wird.
Gleich den ihm verwandten Sex-„Reporten“ über Schulmädchen oder Hausfrauen, spielt Ich – Das Abenteuer … nicht bei reichen, bourgeoisen Leuten, sondern ein, zwei Schichten drunter, wo es weniger steif zugeht und eher sozialdemokratisch swingt. Eine imaginäre junge Frau von heute erzählt uns ihre spannende Geschichte. Es ist ein leichtfüßiges Abenteuer und zugleich ein echtes, körperliches, emotionales Dilemma. Ich – Das Abenteuer … ist das akrobatische Kunststück, aus einem schwierigen, weiblichen Sexualleben voller Tiefgang ein reizvolles, poppiges Gebilde zu zaubern. Metamorphose durch Trivialisierung. Das Leben kriegt Schmetterlingsflügel. Fancy Minikleider. Einen glossy, sexy Fotoroman-Look. Levitation durch weiches Easy Listening. Es erleichtert mich, wenn sich aus unseren Erlebnissen so etwas Unterhaltendes machen lässt. Alles ist Musik.
Ich lese gerade die „unexpurgated“ Tagebücher der Anaïs Nin. Ihre in den 1960er Jahren ersterschienenen, bearbeiteten Bände – eine literarische Sensation bis heute – mussten aus Rücksichtnahme auf noch Lebende Nins viele sexuellen Erlebnisse und Motive aussparen. Erst seit Ende der 1980er Jahre erschienen dann, bis heute, Nins Originaltagebücher. Sehr sexuell. Und sehr konfliktreich. Besonders an die Schilderungen ihrer jungen Ehe und ihrer Versuche, sie zu retten, erinnert mich Ich – Das Abenteuer …
Monika (Renate Carol) hat ihre erste Liebe, Kai (gespielt von Frank Glaubrecht, dem späteren, vielbeschäftigten Synchronsprecher), geheiratet. Nun will sie überschwänglich alles mit ihm ausprobieren. Doch Kai hat feste Vorstellungen. Er macht’s kurz, ist schnell zufrieden und dann müde. Eigentlich ist er nett (er erinnert ein bisschen an den jungen James Stewart). Aber der einzige Sex, den er gelten lässt, ist knapp, genormt und unsensibel. Moni kann mit ihm nicht kommen, doch anfangs denkt sie: Hauptsache Sex. Hauptsache Kai. Sie hängt an ihm. „Wir haben doch noch so viel Zeit“, tröstet sie sich und ihn. Aber es wird nicht besser. Was tun? Monika lässt sich von dem älteren Arzt Dr. Hoffmann, ihrem Kinderschwarm, in dessen Praxis eheberaten. Der Doktor mit den grauen Schläfen und dem markanten Gesicht hat allerdings sofort zwei Cognacgläser in der Hand und würde ihr gerne persönlich zeigen, wie eine Frau zum Orgasmus kommt. Monika geht nicht darauf ein. Doch, angeregt durch seinen Rat, probiert sie zu Hause Selbstbefriedigung aus. Wie viel es zu entdecken gibt! Sie wird fast süchtig danach. Sie spricht mit ihrer erfahrenen Freundin, der feschen Besitzerin einer Boutique.
Was für ein Teenagertraum Boutiquen in den frühen 70er Jahren waren! Carnaby Street, Paris und San Francisco, Beat und Underground, Love & Peace, Sex & LSD: Die aufregende Welt da draußen manifestierte sich in den Klamotten. Auch Moni ist davon berührt und infiziert. Ein kurzer, weiß-gelber Häkelponcho aus dicker Wolle mit Bommeln hat es ihr (und mir) besonders angetan. Moni probiert ihn im Versöhnungsurlaub mit Kai auf dem tollen Straßenmarkt auf, glaub ich, Teneriffa aus. „Such dir einen Liebhaber“, rät Monis Freundin. Moni schreckt davor zurück, erzählt aber Kai von ihren Onaniersessions. Er, rüstig und abfällig: Ach, so ein kleiner Finger kann es doch nicht bringen! Er und alles bleibt beim Alten. Und Moni kriegt Dr. Hoffmann nicht mehr aus dem Kopf. Als er kurzerhand mit ihr in seinem Mercedes auf einen Waldweg fährt, lässt sie sich auf seine Zärtlichkeiten ein. Und ist begeistert. Sie blüht in diesen Dingen auf; sie ist in ihrem Element. Hoffmann kehrt, für meinen Geschmack, zwar arg den erfahrenen Mann von Welt heraus. Aber das muss man ihm lassen: Monika und ihrer Sexualität gegenüber ist er aufrichtig zugewandt. Er ist voller Verständnis, Wärme, Achtung und Bewunderung für ihre intensive Freude am Sex, ihre Grenzenlosigkeit und ihren Freiheitsdrang. Er nimmt sich Zeit, lässt sie spielen, reiten, experimentieren. „Bitte trag dein Haar offen. So offen wie deinen Schoß.“ Er möchte gerne fest mit ihr zusammen sein. Aber sie will ihre Ehe retten. Als er sich zu sehr verliebt, macht sie mit ihm Schluss.
Moni will keine untreue Frau sein. Sie will bei anderen nur Erfahrungen sammeln, um sie Kai dann zu vermitteln, damit sie mit ihm glücklich wird und andere nicht mehr braucht. Doch Kai will gar nichts von ihr lernen. Ihre Versuche, ihm etwas zu zeigen, machen ihn nur misstrauisch.
Sie besucht ihn auf seiner Baustelle (er ist dort Architekt). Die Bauarbeiter johlen, als sie beschwingt und stolz an ihrem Rohbau vorübergeht. Belustigt lässt sie sich von ihnen feiern. Für einen umwerfenden Moment stellt sie sich diese Männer alle nackt vor. Kais lebensfroher Chef sagt, lassen Sie es doch zu, Kai, dass Ihre Frau Sie hier besucht, sie muss doch mal raus. Aber Kai macht das nur eifersüchtig. Auch in der Boutique soll sie nicht aushelfen. Moni hofft auf den Teneriffaurlaub. Dort fällt sie übermütig – „komm, wir spielen Denkmalsschändung“ – in den Dünen über ihn her. Vertrauensvoll reden sie miteinander am Meer, im verheißungsvollen, bernsteinfarben gewordenen Abendlicht dieser sehr schön alternden 35mm-Kopie. Im Zimmer aber leider wieder: ruckzuck. Es ist zum Haareraufen.
Sie lernt den abenteuerlustigen Karsten kennen. Der Sex mit ihm ist klasse, aber sie macht Schluss, als sie mitkriegt, wie zynisch er über sie spricht und sie wie einen Geheimtipp an Freunde weitervermitteln will. Ihr nächster Geliebter, der genießerische Rolf, scheint netter zu sein. Auch er ist ein gewiefter Experte und Experimentierer, von dem sie viel und gerne lernt. Doch Rolf und Karsten kennen sich. Rolf soll sie zu den regelmäßigen Orgien überrumpeln, für die die Freunde anscheinend immer frische Frauen brauchen. Als sie sich geschockt weigert, wird sie beschimpft.
Moni ist verzweifelt und beschämt. Das Experiment, Erfahrungen zu machen und dabei von den Geliebten geschätzt und respektiert zu werden, scheint gescheitert. Wenn man so ist wie sie, verachten einen selbst die Spielkameraden. Kai, zu dem sie schutzsuchend zurückkehren will, ohrfeigt sie und schmeißt sie raus. Verstoßen und verstört irrt Moni wie ein weggejagtes läufiges Kätzchen durch die Straßen. Die Stimmen von Kai, Rolf, Karsten schwirren in ihrem Kopf: „Schlampe, nichts wert“. All diese Hässlichkeiten. Desolat taucht sie in Dr. Hoffmanns Praxis auf. Es ist ein bisschen Nymphomaniac (2013), Lars von Trier, und ich bin diesem süßen Film hier sehr dankbar, dass er es nicht so dumm enden lässt wie dort. Doktor Hoffmann lässt seine Patienten im Wartezimmer stehen und schließt Monika vor aller Augen in die Arme. Ich wünsch dir alles Gute, Monika! Ich glaube, es bleibt spannend.
Silvia Szymanski
Ausweg aus der BRD-Hölle
In gewisser Hinsicht stellen die Hofbauerkongresse auch Konfrontationen mit den Sedimenten an Mentalitäts- und Bewusstseinsschlacke der alten BRD dar. Der Überschuss, der sich bei diesen Kinofesten im Publikum immer wieder ergibt, liegt mitunter gerade auch in der kapitulierenden Begegnung („das Gehirn gibt auf“) mit dem, was mittlerweile überwunden geglaubt wird – oder mit dem, was bis in die Gegenwart Kontinuität hat, heute an den Rand der Gesellschaft verwiesen ist, sich in den historischen Artefakten aber als absolut mittig erweist. Sehr viel Sinn macht es daher, beim Hofbauerkongress nicht nur alte Schlager- und Sexfilme zu zeigen (worauf sich das Programm ohnehin selten reduzieren lässt), sondern auch so etwas wie das „Paul & Erna“-Schmalfilmprogramm, also ursprünglich für den Privatgebrauch gedachte Super8-Filme eines Rentner-Ehepaars, das mitunter wohl Zielgruppe vieler HK-relevanter Filme gewesen sein dürfte, hier nun aber die Kamera eigenhändig auf sich selbst richtet und, das ist das Besondere, dabei noch ein Tonbandgerät mitlaufen lässt (an sich sind Super8-Filme bekanntlich zur Stummheit gezwungen).
Zu sehen gibt es in diesem Rentner-Report zunächst, womit jeder Adornit gerechnet hat, was sich jeder Adornit durchaus vorstellen mag: Impressionen aus dem beschädigten Leben, die BRD-Tristesse des klein(bürgerlich)en Glücks, eine stickige Atmosphäre zwischen Wandschrank-Spießertum nach außen, Infantilität nach innen. Fast immer eingepreist: eine weniger hedonistisch gelebte Lust am Alkohol, sondern das pflichtgemäß zu erfolgende Besäufnis. Pflichtgemäß ist beim Urlaubs-Segment dann auch das per Schnitt in der Kamera hergestellte (und stets von einem „fffft“ auf der Tonebene medienmateriell begleitete) Einfangen kleiner, großer oder auch gar keiner Attraktionen. Melancholie der Willkürlichkeit: Warum nun jenes Boot auf dem See, dieses eher weniger reizvolle Gebäude und schließlich auch jener Strauch für die „Ewigkeit“ der eigenen Erinnerungen abgespeichert werden musste, ist nicht ersichtlich. Dennoch tauchen 30, 40 Jahre später diese Impressionen auf einer Nürnberger Leinwand vor einem aus dem ganzen Land angereisten Publikum wieder auf, das auf diese irritierende Zeitkapsel entsprechend reagiert.
Dann aber: Blumen. In einer Vase vor einem Fenster. Für kleinbürgerliches Repräsentations- und Ästhetikverständnis („stets mittig, viel Luft drumherum“) eigentlich viel zu nahe aufgenommen. Mehrfach macht es wieder „fffft“. Was nach jedem Kameraschnitt zu sehen ist, sind aber immer wieder nur: diese Blumen. Mal kann man durch das Fenster sehen, mal ist das Fenster weiß. Mal sind die Blumen Silhouetten, dann wieder farblich erkennbar, meist bleiben sie schemenhaft. Mitunter wechselt die Perspektive im Zentimeterbereich. Es dauert ich weiß nicht wie lange, aber schon merklich lange, bis ein neuer Gegenstand gefunden ist. Es ist eine Irritation für sich, aber auch, zumal es stets nur das „fffft“ der Stopptaste zu hören gibt, eine unwillentlich entstandene ästhetische Insel der Kontemplation, eine Scherbe, die für einen Moment lang einen Ausweg aus der BRD-Hölle weist, einen Ausweg, der aber nicht beschritten wird. Wenig später steht Erna nackt im Badezimmer und erklärt, dass Reinlichkeit unter großen Frauenbrüsten besonders wichtig ist.
Thomas Groh
Wimmelbilder in strengen Gärten

Gegen Ende von Radley Metzgers Therese und Isabell (1968) betritt die erwachsene Therese für einen kurzen Augenblick das Bild, in dem ihr jüngeres Selbst allein auf einer Bank im Schulhof sitzt. Isabell ist da schon aus dem Film verschwunden. Der Moment ist recht beiläufig, hat nichts Ausgestelltes, und vielleicht fand ich beim diesjährigen Kongress keine Einstellung schöner. Im zweiten Internatsfilm des Programms, Mario Mattòlis Mädchen von 18 Jahren (1955), glich die Leinwand oft einer Art Wimmelbild, emsig und zukunftsfroh huschen die Schülerinnen umeinander her. Völlig aus der Reihe tanzt dabei niemand, das sagt schon der Barockgarten mit seiner Geometrie (als die einzige Außenseiterin in Lebensgefahr gerät, wird sie über ihre Vene fast gewaltsam zurück an die Gemeinschaft gekoppelt). Auch Metzgers Film hat so einen strengen Garten, erzählt aber freilich eher von Dingen, die da ausgeschlossen sind. Therese und Isabell treffen sich also hinter der Truhe im Sakralbau oder hinter der Tür im Klo. Während bei Mattòli die ganze Klasse vom selben Lehrer schwärmt und die Direktorin das Begehren absegnet, solange es noch theoretisch bleibt, ist bei Metzger dagegen nichts von dem Verlangen öffentlich, optimistisch oder sanktioniert, vor allem aber – weil der Film primär mit Rückblenden auf die alte Liebe arbeitet – ist alles schon längst passiert. Das kann ja etwas Tröstliches haben, den Gedanken wünscht man zumindest der älteren Therese, wenn sie da kurz mit der Therese von damals das Bild teilt, weil es niemand sonst tut.
Katharina Stumm
Anna und der Zigeunerjunge

Im deutschsprachigen Schlager bin ich schon öfters auf das Subgenre des Zigeunerlieds gestoßen. Dabei handelt es sich um schwermütige Songs von Daliah Lavi, Alexandra oder Udo Jürgens, in denen Sinti und Roma zum Symbol einer unstillbaren Sehnsucht werden. Man kann darin die stereotype Darstellung bemängeln, aber eigentlich scheint es in den Texten ohnehin eher um die zu gehen, die sie singen – beziehungsweise darum, wie fasziniert sie von den Fremden sind, sich mit ihrem Außenseiterdasein solidarisieren, sie für ihre vermeintliche Unabhängigkeit von gesellschaftlichen Zwängen beneiden oder sie sexuell begehren.
Richard Jacksons (aka Ernst Ritter von Theumer) Exploitation-Alpenwestern Die Totenschmecker (1979) wirft einen ähnlich romantisierten Blick auf eine niederschmetternd melancholisch gezeichnete Romafamilie. Schon während des Vorspanns sitzt sie mit trüben Mienen ums Lagerfeuer, so als ahnte sie schon, was wenig später mit ihr geschehen wird. In dem Tiroler Dorf, in dem sie sich niedergelassen haben, sind sie alles andere als willkommen. Besonders eine ausgesprochen grobe, von Neid und Minderwertigkeitskomplexen zerfressene Bauernfamilie hat es auf sie abgesehen. Nach einem Zwischenfall auch auf ihr Leben.
Am Rande dieses Massakers entwickelt sich eine zärtliche, wenn auch von Anfang an unmögliche Liebesgeschichte zwischen den Kindern beider Parteien. Bei ihrer ersten Begegnung singt Anna ein rassistisches Lied, als Roma-Spross Joschi, wie in einem Musical, hinterm Busch hervortritt und dabei eine traurige Melodie auf der Geige spielt. Es ist ein bisschen wie in Alexandras „Zigeunerjunge“: Für das Mädchen und ihren freudlosen provinziellen Alltag ist Joschi eine Tür in die Freiheit. Mit Musik, Gedichten und Weltgewandtheit gelingt es ihm, Anna in nur ein paar Sekunden zu verzaubern.
Die Szenen zwischen den beiden sind das Schönste am Film; weil sie in einer barbarischen Welt für einen Rest an Menschlichkeit und Neugier aufs Unbekannte stehen, aber auch, weil zwischen den Teenagern eine magische Energie entsteht. Wenn sich Anna und Joschi unterhalten, tun sie das in einem sonderbaren Duktus, der klingt, als würden sie in Versen sprechen und dadurch jede Banalität in Poesie verwandeln. Besonders Maria Beck als Anna ist toll. Das Einzige, was ich über sie gefunden habe, ist ein IMDb-Eintrag voller Nebenrollen in kleineren US-Produktionen, wobei ich skeptisch bin, ob das wirklich dieselbe Person ist. Ihr etwas gestelzt klingendes, stark bayrisch eingefärbtes Hochdeutsch wirkt erstmal so unbekümmert trocken, dass es manchmal auch komisch ist. Aber gerade weil ihr Auftreten so frei von großen Gesten und schauspielerischen Manierismen ist, wird dabei eine fragile Schönheit freigelegt, die einen sofort begreifen lässt, dass diese jugendliche Liebe etwas Welterschütterndes hat.
Michael Kienzl
Tränen, nicht aus Freude, nicht aus Rührung

Zu Beginn – wie der ganze Film wunderschön fotografiert und kompetent inszeniert – eine schwarz-weiße Kerkerwelt aus Mauern und Gittern und den Schatten, die sie werfen. In dieser klaustrophobischen Enge: zehn junge Frauen. Eingesperrt nicht nur in eine Besserungsanstalt, sondern auch in ihre eigenen traumatischen Biografien voller Armut, Gewalt und Verlust. Die Narben, die sie auf den Pulsschlagadern tragen und vorzeigen können, um ihre Geschichte zu erzählen, sind nicht einfach nur Veräußerlichung ihres inneren Zustands, sondern drehen die Etymologie des Wortes Trauma um: von der metaphorischen Narbe, die bestimmte Ereignisse auf der Seele eines Menschen hinterlassen können, zurück zur „realen“ Narbe auf dem Körper. So psychologisch fundiert ist dieser „dreckige“ kleine griechische Exploitation-Film von 1963 von Anfang bis Ende. Schließlich gelingt den Frauen die Flucht. Doch einen einfachen Ausweg gibt es auch damit für sie nicht. Denn auf die Insel in der Ägäis, auf die sie fliehen, sucht eine Gruppe von Gangstern nach einem hier einst vergrabenen Schatz. Da kommen ihnen die Frauen gerade recht, denn irgendjemand muss ja das Graben in der sengenden Sonne übernehmen, während sie im Schatten sitzend zugucken, saufen und sich in schmierigen Fantasien ergehen, wie sie die Frauenkörper, haben sie den Schatz einmal gefunden, auf noch andere Arten ausbeuten könnten.
Das Oberhaupt der Bande ist ein alter Nazi und das Patriarchat, in dem er die Rolle des Führers einnimmt, ein derart archaisches, dass man es ruhig wörtlich verstehen darf: die (zunächst uneingeschränkte) Herrschaft des Vaters. Seinem Sohn jedoch ist seine mörderische und durch und durch berechnende Skrupellosigkeit zuwider. Für seine Rebellion gibt es ein paar schallende Ohrfeigen, darüber hinaus sind dem Patriarchen, wenn es um den eigenen männlichen Nachfahren geht, die Hände gebunden. Der Sohn verliebt sich in eine der Frauen, die in der Gruppe ihrerseits die Rolle einer Anführerin inne hat. Dass sie den Namen der alttestamentarischen Erzmutter trägt, Sarah, macht das ödipale Potenzial an der Konstellation endgültig offensichtlich. Doch so leicht wie es sich dieser Konflikt eines jungen Mannes zwischen verhasstem faschistischen Vater und ausgebeuteter geliebter Mutterfigur mit seinen Identifikationsangeboten zu machen scheint, macht es uns der Film tatsächlich keineswegs. Der Vater wird getötet, allerdings weder vom Sohn noch von Sarah, die mit ihm durchaus auch noch eine Rechnung zu begleichen hätte, sondern von den Polizisten, die sie schließlich zur Hilfe holen kann, weil der Geliebte es ihr listig ermöglichte. Am Ende dann ziehen die noch lebenden Figuren wie in einer Art Prozession davon.
Und allen im Publikum, denen das Bild einer Gruppe, in der die einen Maschinenpistolen tragen, die anderen Handschellen, noch Hoffnung machen würde, dass die Welt des Films jetzt eine bessere wäre als zu Beginn, nur weil ein alter Nazi tot ist und ein junges Paar schließlich zusammenfinden darf, zeigt die letzte Einstellung dann ein Kreuz auf einem Grab. Dabei gibt es seiner melodramatischen Anlage nach durchaus die Möglichkeit zur Katharsis. Ich jedenfalls habe am Ende bitterlich geweint. Allerdings nicht aus Freude oder Rührung.
Nicolai Bühnemann
Im Negligé am blauen See

Schön zu wissen, dass es einen Himmel gibt. Schwer vorstellbar jedoch, dass man mal tot in diesen Himmel kommt. Denn der Himmel, den ich meine, ist die Welt in den Schlagerkomödien von Hans Billian. „Übermut im Salzkammergut“, sein Regiedebüt von 1963, mit Hannelore Auer, Gus Backus, Peppino di Capri und vielen anderen, hat gegen Ende einen Moment, den ich besonders hervorheben möchte. Da wird das Trennende zwischen einer Mutter vom Land und einer Schwiegertochter aus der Stadt, das Unüberwindlichste also, überwunden – mittels einer einzigen Großaufnahme. Helga Sommerfelds Gesicht erstrahlt darin in himmlischem Licht. Himmlisch, wirklich, weil Hans Billian mit dem gleichen unbändig lebensfreudigen Spaß, mit dem er uns seine Darsteller, die Menschen und ihre Lust zeigt, zuletzt noch kess die Kinematografie selbst als ewig frische Erfindung vorführt, im sinnlich demokratischen Wunderwirken der Großaufnahme. Frauen und Männer, egal ob sie die Handlung vorantreiben oder nur singend, tanzend, ihren kurzen Auftritt haben, bei Billian besitzen alle: überschüssige Freiheit. Etwas, das diesem Herrscher „Leben“ einfach nicht gehorcht.
Rainer Knepperges
Slay, Girl!

Die Männer drehen sich um heißt Alberto Lattuadas Episode aus dem 1953er Anthologiefilm Liebe in der Stadt (L’Amore in città), aber der Beginn gehört ganz allein den Frauen. Sie öffnen Fenster, laufen Treppen herunter und treten auf die Straße, essen das erste Eis des Tages, werfen einen Blick zum Himmel oder noch eben schnell in den Taschenspiegel. Die Gesichter geschminkt, die Haare gelockt oder aufgesteckt, die Körper stecken in schmalen Zigarettenhosen oder schwingenden Röcken. Sicher entsprechen sie dem Fantasiebild der in allen Lebenslagen makellos herausgeputzten Frau, aber wie wenig sie der Kamera Beachtung schenken, ganz auf sich oder ihre gelegentliche Begleiterin konzentriert, dazu beschwingte, fast naiv zuversichtliche Musik, das gibt ihnen den Anschein lebendiger Märchenwesen, die über den Dingen schweben. Beachtung schenken sie zumeist auch den Männern nicht, die bald schon über sie hereinbrechen. Es beginnt harmlos mit einem scheuen Blick über die Schulter, doch schon bald kommentiert die zunehmend ironische Musik das Gehabe ältlicher Herren mit schütterem Haar und gierigen Blicken, die jungen Frauen keuchend lange Treppenstiegen hinauffolgen, sie aus dem Autofenster heraus begaffen oder in der Straßenbahn die unfreiwillige Nähe ausnutzen, ganz so, wie es noch Jahrzehnte später Elena Ferrante in ihrem Debütroman beschreibt. Sie wenden den Kopf, halten inne, wechseln spontan die Richtung, verrenken sich die Hälse manchmal auch weniger wegen der Rockzipfel als vielmehr wegen der Kamera, und plötzlich kreuzen sich die Blickachsen, und die Grenzen verschwimmen zwischen Performance und Dokumentarfilm, zwischen Blicksubjekt und -objekt. Die meisten Frauen jedenfalls würdigen diese Gockel keines Blickes, eine aber bahnt sich in eng tailliertem Rock und Halstuch lächelnd ihren Weg über einen von Männern bevölkerten Gehsteig. Ihr Blick, die Art, wie sie sich mit der Hand durchs Haar fährt, spricht von mildem Spott über deren allzu offensichtliche Gedanken, aber auch von einem Selbstbewusstsein, das sich in der Aufmerksamkeit aalt. Slay, girl!
Katrin Doerksen
Tief eintauchen ins Vergessene

Unvergessen bleiben für mich besonders die Momente, in denen der Hofbauerkongress tief in das Vergessene eintaucht. Die Entdeckung unbekannter oder verschollen geglaubter Filme der 1960er und 70er Jahre wie mit Ich – Das Abenteuer, heute eine Frau zu sein ist immer wieder ein Fest, aber es bewegt sich auf vertrautem, modernem Terrain. Dagegen tauchte Komödienspezialist und Totò-Vielfilmer Mario Mattòli in seinem dramatisch angehauchten Mädchen von 18 Jahren in die Höhere-Töchter-Welt eines italienischen Mädchenpensionats Mitte der 50er Jahre ein, in dem die moralischen Grenzen noch deutlich enger gefasst wurden und die jungen Frauen ständig Gefahr liefen, an Reputation zu verlieren. Eine Konstellation, die Mattòli in ihrer Verlogenheit mit wunderbarem Drive genüsslich zuspitzte. Passendes Bonmot am Rande: Marisa Allasio, Darstellerin der aufsässigen Internatsschülerin, wurde in Italien zum blonden Erotikstar der 50er Jahre mit Filmen wie Ich lass mich nicht verführen (1957) und Nackt, wie Gott sie schuf (1958), bevor sie mit 22 Jahren weggeheiratet wurde. Und die schöne Virna Lisi, hier als ihr braver Gegenpart besetzt, glänzte in den folgenden Jahrzehnten wiederholt als verführerische Versuchung im italienischen Film.
So weit weg sind die 50er Jahre also gar nicht, aber der Hofbauerkongress wartete noch mit einem Sprung in die Frühphase des Tonfilms auf mit 24 Stunden aus dem Leben einer Frau aus dem Jahr 1931. Für die Hauptdarstellerin und Produzentin Henny Porten, damals Anfang 40, alles andere als ein Frühwerk nach zuvor mehr als 100 Rollen im Stummfilm und über 20 Filmen, an deren Produktion sie beteiligt war. Mit Grandezza verkörperte sie eine Witwe, deren Mann sich das Leben genommen hatte. In langen Einstellungen erfasst die Kamera das Gesicht einer Frau, die an ihrer Hilflosigkeit, den Freitod nicht verhindert zu haben, verzweifelte. Ihre Bewegungen sind von größter Ruhe, ein Tempo, das sich auf den gesamten Film überträgt. Die langen, wallenden Kleider, die Höflichkeitsfloskeln, das luxuriöse Ambiente und die stets präsenten Bediensteten versetzen den Betrachter in ein längst vergangenes Jahrhundert. Aber da ist noch die Freundin, die sie auffordert, wieder unter Gesellschaft zu gehen, und ein Herr, der als Handleser beeindruckt, als Verehrer aber zu heimlich bleibt. Und der jüngere Mann, der im Casino sein gesamtes Geld verspielt, nicht mehr leben will und damit zur Herzensangelegenheit für die sanfte Witwe wird. Es kommt, wie es kommen muss – Sex, Liebe, Verrat –, und der Hofbauerkongress ist wieder ganz bei sich.
Udo Rotenberg



















Kommentare zu „18. Hofbauerkongress: Metamorphose durch Trivialisierung“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.