17. Hofbauerkongress: Sinnlich entgrenzender Ich-Verlust
Nichtsahnend den Kinosaal betreten, wo Schmerz oder Verzückung auf einen warten. Flurgespräche über Liebe führen. Curd Jürgens auf den nackten Arsch starren. Und mit Hannelore Elsner Weißwein trinken: Eine hemmungslos ausufernde Textcollage vom Nürnberger Festival des unsichtbar gewordenen Exploitationkinos.
Notausgang zu Curd Jürgens’ Allerwertestem

Mein liebster Moment des 17. außerordentlichen Filmkongresses des Hofbauer-Kommandos war, als Curd Jürgens in Der zweite Frühling (1975) in einer Sauna lag. Es war ein Film, der beständig Feingefühl, Rätselhaftigkeit und Derbheit verband. Curd Jürgens’ Figur ist hier, in dieser unwirklichen Mischung aus La dolce vita, Aguirre, der Zorn Gottes und Emmanuelle, auf dem Höhepunkt ihrer Reinlichkeit. Fox hat sich von einem Leben der Exzesse verabschiedet, und während sein Freund neben ihm fast unter den pornösen Vorgängen in dem ehemals züchtigen Schwitzbad zerfließt, hat er nur ein ausgestelltes Schulterzucken parat. Für all das Weltliche dieser Szene hat er keine Augen, keine Gefühle mehr. Das will er uns und sich eindrucksvoll und schnodderig weismachen. Passend dazu bedeckt sein Handtuch nur notdürftig seine Scham. Was kümmert es ihn noch. Der zweite Frühling interessiert sich auch nicht dafür, irgendwas zu verstecken.
Und so zeigte der nackte Arsch eines alten, möglicherweise geläuterten Tunichtgut auf den direkt neben der Leinwand liegenden Notausgang des Kinosaales – sein Damm wurde dabei mehr offenbart als versteckt–, als Christoph Draxtra nach einem Klogang durch den Notausgang wieder eintrat. Einer der beiden Herzen und Seelen des Hofbauerkongresses, die wie Sisyphus noch die geschundensten Kopien versuchen auf Vordermann zu bringen, um den Zuschauern ein Festival zu bieten, das Feingefühl, Rätselhaftigkeit und Derbheit verbindet, stand nun kurz zur Salzsäule erstarrt in den Vorhängen der Tür. Sein Blick war, so versprach zumindest die Perspektive aus dem Zuschauerraum, direkt in den Allerwertesten von Curd Jürgens gerichtet. Er schüttelte sich unmerklich und huschte schnell auf seinen Platz. Ein schönes Bild für die Kongresse ist das. Nichtsahnend betreten wir, die Zuschauer und die Veranstalter, den Raum, wo mal mehr, mal weniger alte, unsichtbar gewordene Filme gezeigt werden, die teilweise niemand der Anwesenden vorher sah, wo anthropologische Studien unternommen werden, wo mal Schmerz auf einen wartet, mal die Verzückung, manchmal beides zusammen, wo selten sicher ist, was auf einen wartet, und da ist dann eben oft erst mal mehr oder wenig kurze, aber intensive Verarbeitungsarbeit nötig – denn immer wieder sehen wir hier ganz unerwartet in die goldenen Augen der Filmgeschichte.
Robert Wagner
Hygenie und Sex, Hand in Hand unter der Dusche
In Mädchen in der Sauna (1967), gezeigt als Vorfilm zum „tristen Überraschungsfilm“, stimmt nichts, aber gerade das macht ihn auf schwiemelige Weise stimmig. Fängt schon damit an, dass es zuerst und längere Zeit nur ältere Herren in der Sauna zu sehen gibt – Filmmaterial, das tatsächlich aus einem „Kulturfilm“ stammen könnte, der Mädchen in der Sauna zu sein vorgibt. Sieht aus wie gedreht von der landeseigenen Tourismuswerbung (so wie der tatsächliche Film gesponsert ist von einer Fluglinie), aber eben reingekloppt in dieses widersprüchliche Teil von Film, das neben Information (für die Sponsoren) und Kultur (für das Format) vor allem auf nackte Haut (eben) hinauswill. Hygiene und Sex gehen wieder mal Hand in Hand unter die Dusche; die Agentin aller Projektionen ist die Journalistin Vera Moorkamp, die schleierhaft zart-geil innere Monologe aus dem Off spricht und mit der, nun ja, Redaktion telefoniert, als es um die Reisekosten geht – das ist der vermutlich tollste Moment, weil die unbegründet traurige Tranigkeit von Vera Moorkamp, die zwischen Dauerbeleidigtsein und einer damals vermutlich verbreiteten Unschuldsfantasie schwankt, eine Zurückweisung des Reiseantrags erwarten lässt (noch im Augenblick der entscheidenden Frage), der Flug, man ahnt es, aber natürlich gestattet wird, weil – sonst gäbe es ja diesen Film nicht!
Matthias Dell
Zwei Hardcore-Filme als introvertierte Kraftspender
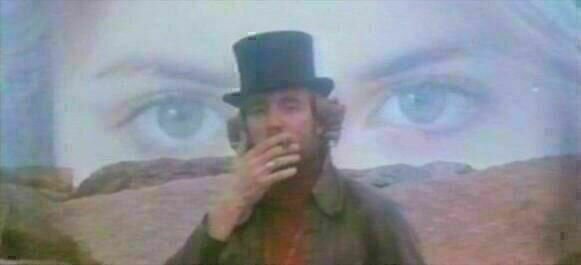
Besonders wird mir ein kleines Flurgespräch in Erinnerung bleiben. Kurz nach der Vorstellung von Wes Cravens Angela, The Fireworks Woman (1975), einem malerischen Inzest-Porno, den Craven unter dem Pseudonym „Abe Snake“ herausbrachte, ging es da nämlich um: die Liebe. Die Liebe, die in diesem Film zu finden war. Und mit der man bereits einen Abend zuvor in Kontakt kommen konnte, nämlich in Jack Deveaus Left-Handed (1972), ebenfalls ein Hardcore-Film. In beiden gibt es jede Menge expliziten Sex zu sehen. Aber eben nicht nur. Oder besser: Zu gutem Sex gehört denn doch noch etwas mehr.
In Left-Handed sind es Fahrten durch eine unbestimmte Upstate-Landschaft, Schnee, eine Farbpalette von grau-weiß, schwarz-grün, etwas nebelig, Straßen, rough, doch auch harmonisch. Durch diese Landschaft fährt ein Auto, das für solche Regionen gemacht scheint und in dem ein junger Mann mit markantem Gesicht und einem interessant tätowiertem Körper (was man erst später bewundern darf) sitzt. Er beliefert ein paar Männer mit Gras, einer von ihnen arbeitet in einem Antiquitätengeschäft in der Stadt und veranstaltet hin und wieder schwule Orgien. Der Plot von Left-Handed ist lose, aber es werden zwei Liebesbeziehungen angedeutet: eine hetero- und eine homosexuelle. Der schöne Mann, der beliefernde, ist in beiden beteiligt, und am Ende sieht man ihn weinen. Ich merke mir selten das Ende eines Films, aber dieses wird mich begleiten. Es sind verrauschte Tränen, genauso wie die Schwänze und Gesichter, die man manchmal durcheinanderbringt. „Fast durchgängig herrscht unfassbare Wärme. Der erste Film des Golden Age, der mir wirklich klargemacht hat, welche Utopie mal in Pornographie/Sex lag, oder zu liegen schien?“, wird Robert Wagner in der Publikation zum Kongress zitiert. Left-Handed ist für mich der introvertierte Kraftspender, ein Genuss, der etwas in mir zu streicheln vermochte.
Angela, The Fireworks Women wirkt dagegen fast operettenhaft, viktorianisch, durchmischt mit West-Coast-Coachella-Hippietum und einem Wes Craven, der als eine Art okkulter Zauberer die Szenerie um die verbotene Liebe zwischen Bruder und Schwester herbeizaubert. Die fanden schon in Kindertagen zueinander (Szenen, die für die gezeigte italienische Kopie offenbar erst inszeniert und eingefügt wurden), doch was damals ging, darf heute nicht mehr sein. Peter (Eric Edwards) hat sich im Laufe seines Erwachsenenlebens zur Religion bekannt, ist Geistlicher geworden, während seine Schwester Angela (Jennifer Jordan) sich noch immer über alle Maßen nach ihm verzehrt. Sie wankt zwischen der Suche nach der gemeinsamen Liebe (und sucht Peter auch schon mal in der Beichtkammer auf, um dort ihre zarten Finger durchs Gitter zu strecken) und einer versuchten Abkehr. Die für mich schönste Szene ist diesem Unterfangen gewidmet: wenn Angela einige Tage auf einem kleinen Segelboot verbringt und unter gleißender Sonne in einen tranceartigen Zustand verfällt, in der Hoffnung, Klarheit zu finden.
Wo es in Left-Handed kaum Licht gab, da ist in Angela, The Fireworks Women alles ausgeleuchtet und wie illuminiert, teils wirkt das wahnsinnig und dann auch wieder heilig. Warm jedenfalls ist auch dieser Film, sich freistoßend auf eine nach innen gewandte Weise. Die Filme lieben sich nach innen, und es scheint ihnen völlig egal, ob ihnen jemand dabei zuschaut oder nicht.
Carolin Weidner
So hard-boiled, dass Barbara Stanwyck alt aussieht

„Crime does not pay“ ist der eindringliche Rat, den die schöne Titel-Rocknummer den Protagonistinnen im tollen Vorspann mit auf den Weg gibt. Doch die Didaktik, die daraus zu sprechen scheint, sucht man in Rasthaus der grausamen Puppen (1967) vergeblich. Am Anfang geht ein Raub kolossal schief, und das Gesicht der Protagonistin Betty Williams (Essy Persson) findet sich in einem sehr eindrücklichen Bild der Gefangenschaft gerahmt durch eine zersplitterte Autoscheibe. Dann spult der Film in seiner ersten Viertelstunde die Konventionen des Woman-in-Prison-Films, die sich in der Form wohl erst später vor allem im US-Kino herausbilden sollten, im Schnelldurchlauf ab: Es gibt lesbische Liebeleien, Folter durch kochendes Wasser aus der Dusche und eine sehr dominante Oberaufseherin (mit dem schönen Rollennamen Nipple und passend scharfkantigen Gesicht: Ellen Schwiers), die scharf auf die Insassinnen ist. Inmitten von alldem die unschuldige Helga Anders, aus deren depressiv in sich zusammengefallener Grundstimmung immer wieder eruptiv ihre Verzweiflung herausbricht. Nach dem Ausbruch landet die Gruppe von Frauen, die überwiegend so hard boiled sind, dass sie Barbara Stanwyck im thematisch ähnlichen Ladies They Talk About (1933) glatt alt aussehen lassen, dann bald im titelgebenden Rasthaus, wo es viele markige One-Liner, ein Eifersuchtsdreieck und jede Menge weiterer Schauwerte gibt. Von den vielen Nebenfiguren, die hier den Weg unserer delinquenten Clique kreuzen, hat jede ihre eigenen Groschenromangeschichte im Gepäck. Wie in den oft in einer einzigen Einstellung aufgelösten spektakulären Schlägereien behält Regisseur Rolf Olsen mit oft geradezu lustvoll ausgestellter low brow-Attitüde auch über die Verwicklungen seines Figurenensembles meisterhaft den Überblick – und legt so einen der ganz großen bundesrepublikanischen Exploitationfilme vor.
Nicolai Bühnemann
Ein Weißwein mit Hannelore, 57 Jahre danach

Fangen wir mit den Dingen an, die ich nicht vermissen werde: Marika Rökk zum Beispiel. In Karussell (1937) dreht sie sich zwar in ihren Tanzszenen enorm und verdreht dabei den Männern den Kopf, hat dabei aber etwas Maschinenhaftes an sich. Mein Herz könnte ich nie an sie verlieren. Angel Guts: Red Classroom (1979) fand ich aufgrund der sehr problematischen Darstellung von Sex (Vergewaltigung en masse) als ziemlich widerlich – und im Nachhinein betrachtet deshalb auch eine interessante Erfahrung. Der ebenfalls gezeigte Angel Guts: Red Rust (1988) hingegen: ein Gedicht! Wie zwei Filme mit ähnlicher Stoßrichtung so unterschiedliche Reaktionen hervorrufen können … Der Unterschied: Im ersten Film wird das Publikum durch seine Film-im-Film-Ebene zum Komplizen, das fällt beim Nachfolger weg, bei dem man sich eher an Neonfarben, starker Bildsprache und unerfüllten Sehnsüchten erfreuen kann.
Was bleibt also vom 17. Hofbauer-Kongress in Nürnberg? Ein heißer Aufguss mit Curd Jürgens in (zu) knappem Handtuch. Ein Feldwebel, der zum Frontalangriff auf die Lachmuskeln des Publikums übergeht, indem er exzessivst Grimassen schneidet. Der leere Blick und das vielsagende Schweigen einer Frau, die einen Mann vergewaltigen will. Über-Exzess von Österreichs Regie-Gott Rolf Olsen, der im Rasthaus der grausamen Puppen (1967) aufspielt. Be-swingte Sorglosigkeit im ganz und gar nicht tristen Doppel in der finnischen Sauna und im Nudistenclub. Zum „volljährigen“ Jubiläum nächstes Jahr würde ich mir trotzdem wünschen, dass der Kongress sich wieder auf seine „Kernkompetenzen“ besinnt und mehr (deutsche) Sittenfilme aus den 60er und 70er Jahren gezeigt werden. Wie Immer wenn es Nacht wird (1961). Hannelore Elsner gibt darin die verlorene junge Geliebte. 57 Jahre später sitze ich mit ihr und Edgar Reitz anlässlich seiner parallel laufenden Retrospektive und in Vorbereitung unserer eigenen im Filmarchiv Austria bei einer Flasche Weißwein am Tisch: „Dass es diesen Film noch gibt! Den habe ich seit damals nicht mehr gesehen und hätte ihn mir sehr gerne wieder angeschaut!“ Vielleicht bin ich auch einfach nur sehr verwöhnt.
Florian Widegger
Ein Visconti-Film von Helge Schneider und andere Entdeckungen
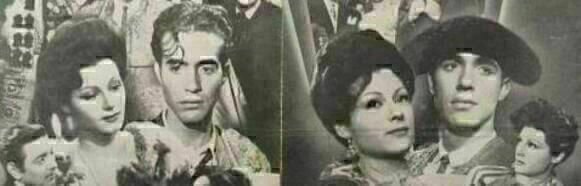
Immer wenn es Nacht wird (1961), ein schwarzweißer Party- und Frauenarztfilm: Syphilis und Dolce Vita, musikalisch in fantasievolle Färbungen eingetaucht vom Komponisten Wolfram Röhrig (einem deutschen Elmer Bernstein?). Als Verzweifelte winden sich eindrucksvoll einsam: Jan Hendriks, Karin Kernke und Elisabeth Volkmann.
Der zweite Frühling (1975) mit Curd Jürgens, von Uli Lommel. Ein ganz großer Wurf, unvorstellbar, bis man ihn sieht. Eine Art Visconti-Film von Helge Schneider, voller Überdruss, Nacktheit und Irrwitz, ein wildes Wagnis und gekonntes Geständnis. Kamera: Lothar Elias Stickelbrucks (wie schon bei Lommels Jodeln is ka Sünd und Lemkes Paul).
Santa (1943), ein mexikanisches Prostitutionsmelodram, die dritte Verfilmung des Stoffes, vom Film-noir-Erfinder Norman Foster raumsicher inszeniert, vom österreichischen Filmverleih schlecht synchronisiert und ruppig gekürzt, und trotzdem ein Gedicht. Schwelgend in Schönheit und Schmutz. Ein filmisches Medaillon zu Ehren der Zweifaltigkeit von Hure und Heiliger. Mit Esther Fernández. Und Ricardo Montalbán in seiner ersten großen Rolle, als madonnengläubiger Torero.
In Santas nächster Nähe arbeitet im noblen Bordell ein blinder Klavierspieler. Dermöchte Santas Schönheit beschrieben bekommen von seinem einzigen Freund, einem mitleidvollen Knaben, der sich schwertut, die Worte zu finden. „Aber ihre Haare kann ich dir beschreiben, denn die sind wie etwas, was auch du gut kennst. "Ihre Haare sind so schwarz wie die Nacht.“
Rainer Knepperges
Nüchterner Kontrapunkt

Nach der Vorführung von Jörn Donners Wie vergewaltige ich einen Mann (1979) gab es überwiegend lange Gesichter. Für viele Besucher wollte das kühle schwedische Rachedrama nicht so recht ins Konzept des Kongresses passen. Und auch wenn ich das exaltiert Leidenschaftliche und Sinnliche, das man sich in Nürnberg auf die Fahnen schreibt, gerne hab, kann es in der geballten Form eines mehrtägigen Festivals auch manchmal anstrengend sein. Donners Adaption von Märta Tikkanens gleichnamigem Roman war zwar nicht mein Festivalhighlight, aber als nüchterner Kontrapunkt hat sie mir dann doch ziemlich gut gefallen. Mit seiner langsamen, beherrschten und auch ein wenig trockenen Erzählweise scheint der Film eins zu werden mit seiner schüchternen, unscheinbaren Heldin. Und so wie die Bibliothekarin Eva nähert auch er sich zaghaft der Vergeltung, ohne sich dabei jemals dem Exzess hinzugeben. Selbst wenn sie am Anfang von einer Zufallsbekanntschaft vergewaltigt wird, wirkt die Tat gerade deshalb so grausam, weil sich dieser betont undramatisch inszenierte Moment so wenig von den kleinen Demütigungen ihres freudlosen Alltags abhebt.
Eva und ihre Kolleginnen führen ein Leben, in dem es nur begrenzte Spielräume für sie gibt. Dass sie auch hübsch aussehen wollen, ist dabei nicht das Problem. Schon eher aber, dass ihnen kaum etwas anderes zugestanden wird. Ich erinnerte mich beim Sehen des Films daran, wie befremdlich erwachsene Männer manchmal als Kind auf mich wirkten. Während sich die Damenwelt mit bunten Pailletten-Oberteilen und abenteuerlichen Haarspray-Frisuren hübsch machte und gewissermaßen die moralische Ordnung wahren musste, durften diese haarigen, oft etwas unförmigen und nach Bier riechenden Gestalten grob scherzen und auch ansonsten ziemlich unvernünftig sein. Später ist mir zwar klar geworden, dass das ein Spiel ist, an dem sich beide Seiten beteiligen, aber die Männer schienen dabei doch den besseren Deal gemacht zu haben.
Bei Donner sind sie fast allesamt chauvinistische, auch äußerlich eher unattraktive Leute, die der Film aber nicht um jeden Preis als Schweine brandmarken will. Vielmehr zeigt er, dass zwar auch sie einem äußeren Druck ausgesetzt sind, am Ende aber doch sehr viel mehr Freiheiten genießen. Um sich an ihrem Peiniger zu rächen, kann Eva zwar die ihr zugeschriebene Rolle nicht ganz hinter sich lassen, aber es gelingt ihr doch, mit Perücke und Trenchcoat zu einer anderen zu werden – zu einem anderen Typ Frau, der selbstbewusster und sexuell aggressiver auftritt, aber auch zu jemandem, der mit der Vergewaltigung am Anfang nichts mehr zu tun zu haben scheint. Die Sonnenbrille wird im Kino oft als auffälliges Symbol des Unauffälligen verwendet. Das monströse Exemplar, das Donners Heldin auf der Nase trägt, scheint aber eher den gegenteiligen Effekt zu haben. Wenn sie zunehmend in das Leben ihres Vergewaltigers eindringt, ihn verfolgt und provozierend in einem Lokal beobachtet, dann erlaubt ihr die Brille, beharrlich zu starren, während die Augen dahinter den Blickkontakt wahrscheinlich nicht aushalten.
Michael Kienzl
Eine Geschichte, zart und durchsichtig wie ein Paar Strümpfe

Wir sind im wohlig geschäftigen Haus einer Baden-Badener Modeagentur. Gladiolenhafte junge Frauen präsentieren Kleider mit Namen wie „Smaragd“ und „Saphir“; Männer wuseln um sie rum. Man sucht gerade ein Modell für eine neue Feinstrumpfmarke. Mamie van Doren, die flaumweich hübsche amerikanische Filmschauspielerin, hat sich hier eingeschmuggelt. In Wahrheit gehört sie einer bedeutenden Juwelenräuberbande an. Am Anfang von Mädchen mit hübschen Beinen (1958) hat sie vor dem Souterrainfenster der Dienststube des Wachmannes gestanden, um ihn abzulenken, während ihre Kollegen nach Tresoren suchten. Der Wachmann – am nächsten Tag Gespött in allen Zeitungen – kann der Polizei nachher kaum etwas sagen. Er hat nur ein Paar sensationelle Beine gesehen und – als ein Windzug Mamies Kleidersaum hob – die Muttermälchen an ihrem Oberschenkel. Sie waren in der Form des Sternbildes des Großen Bären angeordnet. Oder des Kleinen? Das wird zum Gegenstand einer Debatte zwischen Männern. (Ein Freund erzählte mir, als Catherine Deneuve auf der Berlinale war, hat ein Mann in einer Rede über sie gesagt: „Frau Deneuve hat ja schon längst ein goldenes Bärchen.“) Die Geschichte, die hieraus erwächst, ist selber zart, durchsichtig und dünn wie ein Paar Strümpfe. Sie dreht sich im Grunde nur darum, wie und in wen sich Mädchen mit hübschen Beinen sexuell verlieben. Und ob Männer etwas tun können, damit das geschieht.
Da wir von Strümpfen und vom Fräuleinwunder reden … Anfang der 60er Jahre sah ich die Kessler-Zwillinge bei meiner Oma im Fernsehen Reklame für Nylonstrümpfe machen. Zu einer plüschigen Marschmelodie tanzten und sangen sie synchron: „‚Nur Die‘! Das ist ein Strumpf voll Poesie. ‚Nur Die‘! Ja, unsere ganze Sympathie gehört ‚Nur Die‘!“ In diesem Film liegen die beiden in einer intimen Bühnendarbietung wie zwei langgliedrige Windhündinnen auf und neben einer Chaiselongue. Ihre hautengen und hautfarbenen Turnanzüge haben hauchzarte Glitzerstickereien an Busen und Unterleib und lassen sie fast nackt wirken. In ihrer Selbstgenügsamkeit und gertenschlanken Perfektion wirken sie aber nicht die Spur obszön. Es ist, als gehörten sie mehr zu den Pflanzen oder Tieren als zu den Menschen. Nach einiger Zeit, wie von einer inneren Stimme geweckt, erheben sie sich und machen einige Übungen rund um das Möbelstück. Dann legen sie sich wieder hin so wie zuvor. Ellen und Alice. Ihr ganzes Wesen scheint ihre ranke und bewegliche, mädchenhafte Zwillingshaftigkeit zu sein. Es ist, als würde sich ihr Leben, ihr ganzer Wille darin bereits erfüllen und erschöpfen.
Ein anderes Mädchen mit hübschen Beinen befindet sich den ganzen Film lang in einem Nebenraum, verwickelt in eine Auseinandersetzung mit dem jungen, hübschen Fotografen Adrian Hoven. Sie ist noch unerfahren als Fotomodell, und man hat sie gewarnt: „Lass dich nicht anfassen! Man kennt die Fotografen!“ Die Kinder meiner Generation kennen alle die von unseren Vätern kolportierte Legende, bevor wir auf die Welt kamen, habe man die Taillen unserer Mütter mit zwei Händen umfassen können. Genauso eine Figur hat sie auch. Schlank wie ein Reh, doch kurvig. Aufrecht und stolz. Hohe, spitzgeformte Brüste, perfekte und wellige Frisur. Wie ein Figürchen aus Keramik, eine Vase, ein künstlerisches Wunderwesen, strahlt sie eine Heiterkeit und spielerische Perfektion aus, als sei sie mit sich und der Welt vollkommen im Reinen. Adrian will sie nicht verschrecken – das erklärt er einem Kollegen –, sondern geduldig und behutsam vorgehen. Sie trägt ein enges, traumhaft sitzendes Kleid mit frontal durchgehender Knopfleiste, wie die Klingelleisten von Miethochhäusern. Sein Plan ist es, Tag für Tag während ihrer Fotosessions immer mehr Knöpfe zu öffnen und so die Grenzen unmerklich zu verschieben. Man sieht ihn immer mal zwischendurch, emsig und von seinem Plan beseelt, in ihrer Nebenkammer ein- und ausgehen. Wie ein Vogel, der mit dem Nestbau in einer Hecke beschäftigt ist. Einmal läuft sie empört heraus, kehrt aber wieder zurück.
In einem anderen Zimmer tanzen Mamie van Doren und Antonio Cifariello miteinander. Ich kannte Mamie bisher nur als „Sexbombe“ aus der Presse, aber sie ist halb so wild. Sie ist eigentlich eher sogar ein unschuldiges und fast braves Mädchen. Schöngesichtig, freundlich, körperlich reizvoll … manchmal hab ich sie in meiner Fantasie mit der spritzigen, vergnügten und eigenwilligen Liselotte Pulver vermischt, die ich letzten Sommer in dem funkelnden Klettermaxe gesehen hab. Mamie will Antonio betrunken machen, damit er ihr Gaunerprojekt nicht stört. Der junge Mann kippt anfangs noch den Sekt, den sie ihm füttert, heimlich in Blumentöpfe (es standen reichlich davon rum in Wohnungen der Fifties). Doch dann ergibt er sich ihr und dem Saufen immer mehr. Sehr süß macht er das, dieses verliebte Betrunkensein, er kostet das aus, hingebungsvoll und lustig, voller Einfälle und Flausen.
Im letzten Salon sitzt Willy Birgel, als moralisch äußerst aufgelockerter Gaunergentleman mit verarmtem Adelshintergrund. Das steht ihm viel besser als der onkelig-dominante Premiummann mit Prinzipien, der sonst sein Amt ist. Müde und jovial klopft er bei jeder Gelegenheit Sprüche mit „Das Herz eines Mädchens ist …“. Man glaubt ihm die mitmenschliche, bereitwillig von den Hauptrollen im Getümmel zurücktretende Wärme. Er kommt mir sogar fast ein bisschen wie Paul Hörbiger vor. Seit ich Birgel vor zwei Jahren in Frauenarzt Dr. Bertram gesehen habe, als er sich so sehr freute, Gefühle in einem jungen Mädchen zu erwecken, und wie es ihn dann bekümmerte und zerfraß, als er entdeckte, dass sie seine Tochter war … damals begann seine Fassade für mich zu bröckeln; ich sehe ihn mehr und mehr als Menschen. Ein Freund fand, er sei ein Fremdkörper in diesem Film, und ich verstehe, was er meint. Er wirkt, als säße er nur da. Jenseits der Rollen, einfach im Urlaub mit dabei. Ein alter Junge mit vielleicht auch hübschen Beinen.
Silvia Szymanski
Körperteile schweben von der Leinwand

Auf dem Rückweg vom Kongress sitze ich übermüdet im Zug, und weil ich meine Bahncard verlegt habe, wünsche ich mir, als die Schaffnerin sich nähert, dass ich unsichtbar werde, damit mir ein unangenehmes Gespräch erspart bleibt. Ich denke an einen Moment im Kino zurück, zwei Tage vorher, vor einem Film in der Spätvorstellung: Jemand fragt meinen Sitznachbarn, ob der Platz neben ihm noch frei sei. Aber da sitze ja schon ich; dunkel gekleidet und vermutlich schon arg erschlafft wie ich bin, falle ich nicht so auf, aber ganz leer ist der Platz eben doch nicht. Erst nach dem Kongress im Zug komme ich auf den Gedanken: Eigentlich wäre es super, tatsächlich unsichtbar zu werden, nicht nur jetzt und hier im IC, sondern auch und gerade im Kino, beim Hofbauerkongress. Unsichtbar werden, nicht mehr ein verortbarer Körper in einem mit anderen verortbaren Körpern gefüllten Zuschauerraum sein, sondern eine geisterhafte Präsenz, flüchtig und mächtig wie die Figuren auf der Leinwand; oder vielleicht könnte ich auch, wie der Lüstling in der Edogawa-Rampo-Erzählung Der Sesselmann, mit dem Sitz verschmelzen, in den Kinosaal selbst eindringen, andere Menschen auf und in mir beben spüren.
Am nächsten gekommen bin ich einem solchen Ideal von Kino als sinnlich entgrenzendem Ichverlust auf dem diesjährigen Kongress während Radley Metzgers Carmen, Baby (1967). Der Film läuft direkt nach dem Abendessen, etwas zu gut gesättigt und leicht betrunken sitze ich da und lasse die Bilder mal an mir vorbei-, mal in mich hineinfließen. Carmen, Baby hat ein gemächliches Tempo, der altbekannte Stoff der Bizet-Oper scheint keinen der Beteiligten allzu sehr zu interessieren, aber das Produktionsdesign ist super, und Metzger hat tolle Schauspieler gefunden, eine sinnlich-freche Carmen (Uta Levka) und einen Jose (Claus Ringer), unter dessen milchbubihafter Naivität manchmal eine erstaunliche Härte durchschimmert. Ich versuche nicht einmal, der Handlung zu folgen, sondern verliere mich in den leicht rosig glänzenden Gesichtern, den begehrlichen Blicken, den kleineren und größeren Zudringlichkeiten der nur vorderhand verhältnismäßig keuschen, im Detail fröhlich perversen Kamera. Der schönste Moment des Films ist eine Großaufnahme, in der zärtlich ein Ohr gefingert wird. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, gehört der Finger Carmen und die Ohrmuschi Jose. Aber ich habe gar kein Interesse mehr daran, Körperteile auf Menschen zuzurechnen, und die Finger, Ohren, Gesichter, Blicke lösen sich nicht nur von den Figuren, sondern gleich ganz von der Leinwand, schweben auf mich zu, umgeben mich, wo auch immer ich mich in diesem Moment befinden mag.
Lukas Foerster














Kommentare zu „17. Hofbauerkongress: Sinnlich entgrenzender Ich-Verlust“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.