Von Ulm in die weite Welt – Interview mit Eckhart Schmidt
Showman Eckhart Schmidt über seine Anfänge, die Zeitschrift Filmkritik als Feindbild, Reparaturarbeiten an Blacky Fuchsberger und eine Ohrfeige von Reinhard Hauff.
Das Kino des Eckhart Schmidt, ein Außenseiter unter den deutschen Autorenfilmern, ist ein höchst vielfältiges: Er hat Spiel-, Kurz-, und Experimentalfilme gedreht sowie eine große Auswahl an Dokumentationen. Und so variabel die Formen und Formate seiner Filme sind, so unterschiedlich waren auch die Orte seiner Tätigkeiten. So taucht sein Name seit den 1970er Jahren an allen Fronten des Showgeschäfts auf: in den Feuilleton-Spalten vieler Tageszeitungen, als Verantwortlicher diverser Fernsehsendungen und, in regelmäßigen Abständen, auf der Kinoleinwand. In einem Gespräch haben wir vor allem versucht, die Anfänge und die weniger bekannten Seiten seiner Karriere zu beleuchten. [Das Gespräch wurde von Ulrich Mannes und Hans Schifferle am 13.6.1997 in München geführt und erschien ursprünglich in der Filmzeitschrift 24]
Wie sind Sie nach München gekommen?

Ich wollte in meiner Jugend immer Maler werden und habe mich deshalb nach meinem Abitur in Stuttgart und München für die Kunstakademie beworben. Ich bin aber beide Male nur für die freie Klasse zugelassen worden. Da meine Eltern das Studium nicht finanzieren konnten und ich für die freie Klasse kein Stipendium bekommen hätte, musste ich diese Idee aufgeben. Ich bin dann nach München gegangen, um Sprachen zu studieren, Germanistik, Anglistik, Romanistik, und habe daneben Philosophie und Psychologie belegt.
Hatten Sie damals in der Malerei schon eine bestimmte Richtung eingeschlagen?
Ich habe sehr spontan gemalt, gegenständlich und abstrakt. War natürlich sehr von dem beeinflusst, was sich in Ulm, wo ich ins Gymnasium gegangen bin, an der Hochschule für Gestaltung abgespielt hat, von Max Bill u.a. In Ulm war damals überhaupt ein unglaublich anregendes kulturelles Klima, wie ich es nie mehr erlebt habe. Ich war viel im Theater. Die Brecht-Modellinszenierungen unter anderen von Palitzsch habe ich mir zum Beispiel angesehen. Und die Stadt war ein guter Nährboden für den Jazz, weil die Leute von der Hochschule dafür sehr aufgeschlossen waren. Manche Jazzgruppen kamen überhaupt nur nach Ulm. Und Jazz hieß Existentialismus: Sartre und Camus lesen, für Juliet Greco schwärmen …
Fürs Kino haben Sie sich noch nicht interessiert?
Doch, ich bin parallel auch viel ins Kino gegangen. Am meisten hat mich an den Filmen die Erotik gereizt, und da war der katholische Filmdienst eine gute Hilfe: Die Filme, die man sich dann immer angeschaut hat, waren die, die mit zwei E bewertet wurden, das heißt „Für Erwachsene mit erheblichen Einschränkungen“ – da gab’s also nackte Weiber. Drei E war auch in Ordnung, obwohl es da auch um moralische Kriterien ging, die mich nie interessiert haben. Vier E war ganz schlecht, das bedeutete, es sind religiöse Anschauungen verletzt worden. – Aber diese Bewertungen waren meine ersten filmischen ›Orientierungen‹ …
Viele Filme hab ich auch mehrmals gesehen. Wenn man wollte, konnte man damals in den Kinos nach dem Ende der Vorstellung leicht sitzenbleiben: Man hat einfach so getan, als ob man zu spät gekommen wäre. Manche Filme habe ich so an einem Tag dreimal hintereinander gesehen und auf diese Art eine unglaubliche Filmbildung bekommen. Dazu habe ich die entsprechenden Zeitschriften gesammelt und gelesen, Filmrevue, Filmkurier, wodurch sich auch das Interesse am Inhalt und den Regisseuren stark erweitert hat. Besonders geschwärmt habe ich damals für Martine Carol, deren Filme ich mir immer bis zu 20 Mal angeguckt habe. Ich hatte immer zwei Fotos in meiner Brieftasche: Juliette Gréco und Martine Carol. Die eine war die Intellektuellenmuse, die andere mein Symbol für Sex.
Das war alles in der Gymnasialzeit?
Ja, ich war damals um die 14 Jahre alt. Später habe ich in den Diskussionsabenden der Hochschule noch die ganzen progressiven Filme gesehen. Sehr beeindruckt hat mich … nicht mehr fliehen von Herbert Vesely (1955). Auf der anderen Seite haben mich Western interessiert. Einer der ersten Filme, die ich überhaupt gesehen habe, mit acht Jahren in einem Neu-Ulmer Kino, war ein Audie-Murphy-Film. Damals wohnte ich noch in Pfaffenhofen, einem Dorf, das 20 Kilometer von Ulm entfernt lag. Wir sind mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren. Das war ein wahnsinniges Abenteuer für uns, und wir haben noch Wochen darüber geredet.
Der zweite Film, den ich gesehen habe, in einer Volkshochschul-Veranstaltung, war ein Kriegsfilm mit Hildegard Knef: Decision Before Dawn (1951) von Anatole Litvak. Von da an bin ich kontinuierlich ins Kino gegangen. Ich hatte einerseits eine Orientierung zu ganz simplen Filmen, die mit Sex verbunden waren, wie Caroline Cherie (1968) oder Lucrezia Borgia (1953). Auf der anderen Seite gab es, beeinflusst durch die Hochschule, eine Vorliebe für sehr ambitionierte Filme. So habe ich die ganzen Antonionis und Viscontis gesehen.
Das musikalische Interesse ging auch auseinander: Einerseits Jazz und andererseits Rock ’n’ Roll. Rock ’n’ Roll war für mich die Entdeckung überhaupt, eine Basiserfahrung. Durch ihn gab es zum ersten Mal eine junge Generation. Vorher hatte man das Gefühl, es gibt nur kleine Erwachsene.
Erzählen Sie uns doch was von Ihren Anfängen in München?

Während des Studiums habe ich angefangen, Kritiken für den Bayerischen Rundfunk zu schreiben. Man musste damals für eine Sendung, in der sich zwei Typen über Film unterhalten, Dialoge schreiben. Zwei Schauspieler, die keine Ahnung vom Kino hatten, haben diesen Text dann gesprochen. Das war immer entsetzlich, hat mir aber pro Sendung 120 Mark eingebracht, was für uns gigantische Summen waren, ungefähr eine Monatsmiete. Später habe ich Aktualitäten fürs Fernsehen gemacht: Politikerreden, Kulturereignisse, also Berichte für die Nachrichtensendungen – die härteste Schule meines Lebens. Aktualitäten hieß: Man bekam am Morgen zwei, drei Termine, hat gedreht, das Material zum Entwickeln gebracht, und um fünf Uhr konnte man anfangen zu schneiden. Man bekam beispielsweise folgende Themen: „Chlor im Trinkwasser“ und „Neues Kino eröffnet in München“. Die Vorgabe lautete: Der erste Beitrag soll 53 Sekunden lang sein und der zweite 20, keine Sekunde länger. Beide sollten ein Original-Statement haben und einen erklärenden Kommentar. Und man hatte für den Schnitt nie länger Zeit als eine Stunde. Das Material war 16mm-Umkehrfilm, das hieß, wir konnten keinen Schnitt zweimal machen – wir konnten also nur kürzen, niemals verlängern. Die Schule bestand darin, unglaublich konzentriert arbeiten zu müssen, vorher im Kopf zu schneiden und die Länge schließlich auf die Sekunde genau zu treffen. Diese Fertigkeit wirkt sich bei mir noch heute aus. Zum Beispiel beim Schnitt meines neuen Films Hollywood Dreamers (1997). Ich hatte 100 Stunden Material zur Verfügung, und da bei mir die ganzen Aufnahmen im Kopf sind, habe ich auf den Off-Line-Schnitt verzichtet und gleich den sendefertigen On-Line-Schnitt gemacht, und am Ende war ich bei 89:37 Minuten. Ich kann nur mit Cuttern zusammenarbeiten, die diesen Blindflug verkraften. Für die meisten Cutter ist das unvorstellbar. Die fragen mich dann immer: „Wie weißt du denn, was die letzte Einstellung sein wird?!“ Aber ich weiß das. Wenn ich mir vornehme, der Film wird 89 Minuten lang, dann wird er so lang.
Daher weiß ich auch bei den Dreharbeiten meiner Spielfilme immer genau, was ich haben will. Ich lege die Einstellungen fest und die Optik. Ich setz mich hinter die Kamera und sag, wie ich mir das alles vorstelle, und dann erst kommt der Kameramann an die Reihe. Auch will ich von ihm wissen, wie lang er fürs Licht braucht. Wenn er über das Zeitlimit geht, dann greife ich halt ein … Ich bin allerdings auch sehr flexibel, wenn es nicht so funktioniert wie vorgesehen. Angenommen, wir können im vorgesehenen Raum nicht drehen, dann gehe ich einfach in den Nebenraum und werde vielleicht zwei neue Dialoge ins Drehbuch schreiben. Das können die Kameramänner oft nicht verstehen. Aber ich finde, es geht um den inneren Ausdruck. Jede Szene hat ein essential, und das ist für mich übertragbar.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Loft habe ich zehnmal umgeschrieben. Die vorletzte Fassung war, dass ich auf Sizilien in einem Robinsonclub drehen wollte: die Rache der Animateure. In einem dieser Gebäude sollte das Massaker stattfinden. Doch dann haben die Veranstalter einen Rückzieher gemacht, weil sie es zu brutal und vielleicht nicht so günstig für ihren Club fanden, wenn sich die Animateure an den Leuten rächen, die sie die ganze Zeit unterhalten müssen. Nachdem das nicht möglich war, hab ich das Drehbuch auf das Loft in Haidhausen umgeschrieben. Hier schlagen halt anstelle der Animateure die menschlich gewordenen Bilder zurück. Trotzdem ist diese Fassung für mich der gleiche Film geworden. Ob er nun auf Sizilien oder in Haidhausen spielt, ist für mich kein wesentlicher Unterschied.
Ich finde, dass diese Flexibilität, die Sie durch Ihre Rundfunkarbeit gewonnen haben, auch Ihre Spielfilme beeinflusst hat, die immer auf Aktualitäten basieren.
Ich glaube, dass Musik und Mode immer ganz wesentliche Faktoren für mich waren. In der Musik gab es vier entscheidende Bewegungen: Jazz und Rock ’n’ Roll, dann Punk und New Wave – das war die erste Bewegung, die ein Medienbewusstsein mitgebracht hat – und schließlich Hip-Hop.
Und die musikalischen Bewegungen dazwischen haben Sie nicht interessiert?

Beat war nicht so ganz mein Ding, und den sogenannten erdigen Rock finde ich entsetzlich, wenn also Instrumente gerupft werden oder einer sein Gitarrensolo ablässt. Ich mochte zwar Sgt. Pepper, manche Platten von den Rolling Stones und die frühen Pink-Floyd-Platten – mehr die psychedelisch angehauchten Sachen. Aber das alles war für mich nichts Neues. Wie für mich Techno oder Drum & Bass im Vergleich zu dem, was ich im Rahmen von New Wave gehört habe, auch nichts wesentlich Neues ist. Ich habe das Gefühl, die wesentlichen Elemente des Techno schon Ende der 1970er Jahre hinter mich gebracht zu haben, durch bestimmte Gruppen, wie Human League, Depeche Mode oder Ultravox. Beim Hip-Hop hingegen sehe ich einen ganz neuen Ansatz, einen ganz anderen Blick auf die Welt und einen neuen Umgang mit dem Material.
In der Mode gab es für mich auch ganz wesentliche Stationen. Zum Beispiel das Aufkommen der italienischen Mode. Ich bin damals nach Mailand gefahren, weil ich den Originalladen von Gianni Versace sehen wollte, und ich hab mir dort seine Sachen rauf und runter gekauft.
Uns würde interessieren, wie Sie zur Süddeutschen Zeitung gekommen sind?
Ich habe von einem Kollegen beim Bayerischen Rundfunk gehört, dass die Süddeutsche Zeitung einen Kritiker sucht, und wurde durch seine Vermittlung zu einem Gespräch geladen. Ich musste als Test zwei Probekritiken schreiben. Sie haben meine Texte zwar zu Tode redigiert, aber gesagt, dass sie es weiterprobieren wollen.
Haben Sie in der SZ nur Filmkritiken geschrieben?
Nein, der nächste Schritt bei der Süddeutschen Zeitung war die neu entstandene Fernsehseite. Gernot Sittner, der erste Fernseh-Redakteur, hat mich gefragt, ob ich für ihn schreiben will. Das hat mich natürlich interessiert – Fernsehen war was Neues –, und so habe ich viel übers Showgeschäft geschrieben …
…in dem Sie später auch gearbeitet haben?
Ja. Eines Tages – das muss schon in den 1970er Jahren gewesen sein, nach meinen ersten Filmen – habe ich eine Kritik über die Sendung Der heiße Draht mit Joachim Fuchsberger verfasst. Bald darauf bekam ich einen Anruf vom Südwestfunk. Die luden mich zu einer Pressekonferenz ein, sie meinten, ich hätte sehr produktiv geschrieben. Da die Sendung in Grund und Boden gefahren war, fragten sie mich, was ich denn ändern würde. Und ich machte ihnen einige Vorschläge, worauf der damalige Programmdirektor Dieter Stolte mich nach Baden-Baden eingeladen hat. Ich bin dann hingefahren und hatte freie Hand. Die waren in der Krise, wussten weder ein noch aus. So habe ich alles durchorganisiert, und die Sendung ist dann auch relativ erfolgreich geworden. Nach dem Heißen Draht kam Auf Los geht’s los. Insgesamt habe ich ungefähr 80 Samstagabend-Kisten beraten. Eine meiner Ideen war, dass man Promotion für die Filmleute macht, Stars reinschiebt und dadurch in die Zeitungen kommt. Wir hatten von der Streisand über Anthony Perkins oder Robert De Niro bis zu Arnold Schwarzenegger alles, was nicht niet- und nagelfest war, in der Sendung.
Was war Ihre offizielle Funktion?

Ich war der Berater von Blacky Fuchsberger. Ohne uns beide ging in der Show nichts. Die anderen, wie zum Beispiel der Redakteur vom Südwestfunk, durften natürlich Vorschläge machen, aber wir haben entschieden. Mein Vorteil war, dass ich brutal eiserne Nerven habe. Irgendwas geht ja bei Live-Sendungen immer schief, und in solchen Fällen habe ich eine gewisse Fähigkeit ganz entschieden durchzugreifen und den Überblick zu behalten.
Aus Auf Los geht’s los hat sich die Talkshow Heut’ abend entwickelt, wovon wir 300 Sendungen gemacht haben: Ich habe die Fragen mit Blacky diskutiert, die Gäste recheriert und das Material aufbereitet. Dabei habe ich die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt, von Roy Black über Lothar-Günther Buchheim bis Ludwig Bölkow. Für mich war es sehr interessant zu sehen: Was macht Menschen erfolgreich? Wie steckt man Niederlagen weg? Wie bewältigt man Krisen? Was bedeuten Medien? Und alle hatten Probleme mit den Medien. Bei jedem Gast, da nehm ich keinen einzigen aus, war die Standardbitte: „Ich möchte endlich mal die Wahrheit über die Medien sagen. Was die mir alles angetan haben!“ Meine Standardantwort war: „Das hat mir schon jeder gesagt. Das ist einfach stinklangweilig.“
Die Zusammenarbeit mit Fuchsberger muss ja recht eng gewesen sein. In einer Biolek-Sendung hat er vor Kurzem auf die Frage, wer ihm am meisten bei seiner Karriere geholfen hat, geantwortet: „Meine Frau und Eckhart Schmidt.“
Wir haben uns sehr gut verstanden und in einer sehr produktiven und respektvollen Art zusammengearbeitet. Ich habe seine Probleme erkannt und versucht, meinen Beitrag zur Reparatur zu leisten. Jeder hat seinen Charakter und seine Eigenschaften, und Blacky hat seinen Egoismus und der ist nicht ganz zu reparieren. Er ist ein unabhängiger Mensch – immer schon gewesen –, und er hat sich von keinem Redakteur in irgendeiner Weise etwas sagen lassen. Und wenn wir – seine Frau und ich haben oft an einem Strang gezogen – ihn beraten haben, dann war das sachbezogen, um ein Problem auf den Punkt zu bringen.
Was hat denn Joachim Fuchsberger zu Ihrer Filmarbeit gesagt?
Wir haben ein Arrangement getroffen. Blacky geht ja durch einige meiner Filme, indirekt ist er zum Beispiel in der Story (1984), wo die Fernsehshowszene während einer Probe von Auf Los geht’s los gedreht wurde – ich habe dann nur in den Großaufnahmen Dietmar Schönherr reingeschnitten. In Der Fan (1982) ist er auch kurz zu sehen. Nach Loft (1985) hab ich ihn gebeten, sich keine Filme mehr von mir anzuschauen. Er fand die Filme so schockierend, und er fragte: „Was ist eigentlich mit dir los? Du bist doch ein kultivierter, gebildeter Mensch?“ Das haben überhaupt viele nicht auf die Reihe gebracht, Leute, die wissen, dass ich recht umgänglich bin, dass ich nicht amokmäßig herumlaufe und seit 40 Jahren mit der gleichen Frau zusammen bin. Ich habe also zu Blacky gesagt: „Ich kann locker damit leben, dass du diese Filme nicht anschaust.“ Aber er hat meine Filme und ‚Abgründe‘ respektiert. Das war ein Zeichen für den Respekt und des Fair Play, das zwischen uns herrschte.
Haben Sie in dieser Zeit nur für diese Shows gearbeitet?
Nein, ich habe mir beim Südwestfunk als Gegenleistung für meine Arbeit an der Show pro Jahr eine Sendung ausgehandelt, die ich so machen konnte, wie ich wollte, solange ich im Produktionsrahmen blieb. Da habe ich natürlich zugeschlagen und irrsinnig viele Sachen ausprobiert. Filme, mit ganz extremen Auflösungen, mit Detailsachen, oder Doppelbelichtungen, mit extremen Schnitt- und Bildfolgen, was später erst bei den Videoclips gemacht wurde.
Gehen wir aber noch mal in die 1960er Jahre zurück. Erzählen Sie doch etwas über die Entstehung der Münchner Gruppe?
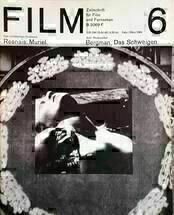
Ich habe während des Studiums in der Studentenbücherei gearbeitet und da viele Menschen kennengelernt. Das war wie eine Zentrale, in der viele Freundschaften entstanden sind. Hier tauchte Kluge auf, Syberberg und Lemke kamen dazu. Daraus haben sich verschiedene Stränge an Bekanntschaften entwickelt: Ein Strang war Thome-Lemke-Schmidt. Klaus Lemke wollte eigentlich zum Theater gehen. Er war bei der Studentenbühne und Assistent bei Kortner gewesen. Rudolf Thome und ich haben ihn davon überzeugt, dass das mit dem Theater ein Scheiß ist. Die graben immer nochmal einen Klassiker aus und inszenieren daran rum. So haben wir dann angefangen 8mm-Filme zu drehen. Die Freundschaften sind später aber aus bestimmten Gründen wieder auseinandergelaufen. Lemke ging zwar anfangs in die gleiche Richtung, in die ich auch gehen wollte, hat aber nach 48 Stunden bis Acapulco (1967) und Negresco**** (1967) eine Art Realismus gesucht: Leute ohne Drehbücher benutzt, die sogenannte Spontanität bevorzugt, was ich überhaupt nicht wollte. Für mich war Film immer, losgelöst von der Wirklichkeit, das Finden einer eigenen Realität, vielleicht mit Partikeln der Wirklichkeit, aber so, dass sie eine ganz neue Funktion bekommen.
Und Max Zihlmann?
Max Zihlmann war auch immer dabei. Aber er war in seiner Mentalität am engsten mit Rudolf Thome verwandt. Beide sind, im Gegensatz zu mir, sehr bedächtige Menschen. Mit Thomes frühen Filmen wie Supergirl (1971) oder Rote Sonne (1969) konnte ich noch was anfangen, aber dann hörte es eigentlich schon auf. Jeder von uns ist also seinen Weg gegangen, und ich bin mehr in eine Schicki-Micki-Ecke reingekommen, durch die Musik, durch Roger Fritz, den Hauptdarsteller von Jet Generation (1968).
Das Drehbuch zu Roger Fritz’ Film Mädchen, Mädchen (1967) haben Sie geschrieben?
Das sollte ursprünglich Marran Gosov schreiben. Aber mit seinem Buch ist der Roger nicht zurechtgekommen. Nach endlosem Hin und Her habe ich mich mit ihm hingesetzt und es geschrieben. Und Jet Generation war das Versprechen von Roger Fritz: Weil ich ihm bei seinem Film geholfen habe, würde ich mit seiner Hilfe meinen Film machen können. So hat er die Produktionsgeschichten und die Besetzung gemacht.
Er hat sich also selbst die Hauptrolle gegeben?
Ja. Es wurde ewig ein männlicher Hauptdarsteller gesucht. In Berlin gab es übrigens einen Geheimtip: Udo Kier. Doch er hatte für mich das total tote Gesicht, das ich bei den Probeaufnahmen schon nicht ertragen konnte – ich habe sogar Brennnesseln durch sein Gesicht gezogen, um eine Reaktion von ihm zu bekommen. Jedenfalls haben wir beschlossen, dass er es nicht ist. Es lief dann auf Roger Fritz selbst hinaus, obwohl er immer gesagt hat, dass er nicht will. Ich glaube aber, dass er im Hinterkopf die Rolle immer schon spielen wollte, und er hätte im Grunde jeden von mir vorgeschlagenen Darsteller gekillt.
Ihre Frau Isi ter Jung spielt ja in allen Ihren frühen Filmen mit. Hatte sie schon Schauspielerfahrung?
Sie ist gelernte Schauspielerin und hat im Ulmer Theater bei Zadek und Hübner gespielt. Kennengelernt haben wir uns bei der Schülerzeitung, die ich in Ulm gemacht habe. Als ich nach München ging, blieb sie in Ulm, und wir durften nicht miteinander verkehren, weil ich für ihre Eltern aus einer „sozial niederen Gesellschaftsschicht“ kam. Eines Tages ist sie abgehauen und zu mir nach München gezogen. Dann habe ich die Eltern angerufen und gesagt, sie kommt zurück – unter der Voraussetzung, dass wir heiraten, damit es keinen Skandal gibt. Sie war also Schauspielerin, und es lag für mich nahe, mit ihr die Kurzfilme zu machen und später die Spielfilme.
Sie hat keine anderen Filme gemacht?
Neulich hat sie bei Sherry Hormans Irren ist männlich (1996) eine Rolle gespielt. Aber ihre Ambitionen waren nie sehr groß.
Kann man sagen, dass die Münchner Gruppe als Gegenpol zu einem bestimmten Richtung von Kino entstanden ist, etwa zu den Oberhausnern?
Wir hatten verschiedene Richtungen. Es gab Leute, die auf der Grenze waren, wie Peter Schamoni, mit dem wir schon geredet haben. Andere, wie Franz-Josef Spieker, wurden von beiden Seiten akzeptiert. Aber es gab Feindbilder, wie Edgar Reitz, Alexander Kluge, Enno Patalas …
Also der Kreis um die Filmkritik?

Filmkritik war absolutes Feindbild. Wobei das Interessante war, dass wir Abende lang zusammen saßen: Enno Patalas, Hans-Dieter Roos, Frieda Grafe, Theodor Kotulla … Wir haben uns nächtelang gestritten, aber man hat sich auseinandergesetzt und ist zusammengeblieben. Dann hat Hans-Dieter Roos das Anti-Filmkritik-Organ Film gegründet, das von Leo Kirch finanziert wurde. Und darin haben wir unseren Stiefel gemacht. Die Filmkritik hat die Filme, die wir geliebt haben, mit grotesken Wertungen belegt, Godard einen Faschisten genannt, was für uns völlig absurd war … Enno Patalas hatte ja die Geschichte des Films geschrieben. Ich hab ihm damals gesagt: „In deinem Buch sind von oben bis unten gepflasterte Irrtümer. Du wirst dich später schämen, dass du es geschrieben hast.“
Eine Sache, die noch wichtig für mein Filmverständnis ist: Damals hatte Leo Kirch viele Filmpakete gekauft und sämtliche Kritiker Münchens engagiert, um diese Filme zu sichten. Er wollte eine Inhaltsangabe und eine Bewertung, denn es gab nichts über die Filme, keine Besetzungsliste, kein Pressematerial. So sind wir monatelang gesessen und haben uns am Tag zehn Filme reingezogen. Da war alles dabei, sämtliche Western, sämtliche Film Noir, alle Gene-Kelly-Filme, alle von Raoul Walsh und Budd Boetticher.
In Ihren meisten Filmen, wie in Jet Generation, spielt München eine zentrale Rolle?
Ja. Ich habe Dekors aber immer als Material gesehen und sehe auch die Stadt als Material. Ich versuche nie ein Dekor total zu erfassen, sondern die für die Story entscheidenden Elemente herauszugreifen. Und München hatte da seine Faszination. Ich bin ja damals von Ulm nach München gekommen – diese Geste ist ein paar Mal in meinen Filmen drin: von Ulm in die weite Welt. Ich habe München aber zitathaft, nie dokumentarisch benutzt. Das sieht man auch in Alpha City (1985), der in Berlin gedreht ist, und sogar Berliner wussten gar nicht, wo einzelne Szenen spielten. Das sind rausgegriffene Elemente für den eigenen Trip …
Konsequent haben Sie das im Gold der Liebe (1983) verwirklicht, wo Schauplätze aus Wien und München vermischt werden.
… und wenn eine Stadt diese Reize nicht mehr hergibt, wenn ich mich nicht mehr für solche Details begeistern kann, dann habe ich ein Problem. Das hatte ich nach einer Reihe von Filmen in München, und ich habe gesagt, ich muss weg. Ein Weg war einfach ausgeschöpft.
Aber kommen wir zu Atlantis (1970). In diesem Film gibt es bereits Parallelen zu Undine (1992) …
Es ist erschütternd, dass man immer den gleichen Film macht. Als ich nach 30 Jahren Jet Generation wieder gesehen habe, habe ich gemerkt, dass er bis in einzelne Dialoge in Broken Hearts (1996) zu erkennen ist …
In meinen Filmen sind die Leute nur nach ihren Gesten zu beurteilen und nicht nach ihrer Vorgeschichte: „An ihren Taten sollst du sie erkennen“. Das Merkwürdige meiner Filme ist, dass das in den alten Filmen, die schon ein wenig Patina haben, leichter zu erkennen ist.
Nach Atlantis haben Sie dann ein Jahrzehnt lang keinen Film mehr gemacht. Hing das mit dem mäßigen Erfolg zusammen?
Das war schon der mäßige Erfolg. Ich hatte ja viele Drehbücher geschrieben. Das erste Drehbuch von mir hieß Nach Amerika, eine Killergeschichte, auf dem Cover war die amerikanische Fahne. Das wollte mal Rob Houwer produzieren. Mein zweites Drehbuch war das Käthchen von Heilbronn nach Kleist.
Nach Atlantis gab es also eine gewisse Resignation?
Würde ich schon sagen. Aber aus der Fernseharbeit mit Fuchsberger haben sich die späteren Filmprojekte entwickelt. Auf diese Art habe ich auch Sam Waynberg von der Scotia kennengelernt, mit dem ich eine Reihe Filme gemacht habe. Die Fernseharbeit war ein Steigbügelhalter.
Die Inspiration für die Filme in den 1980ern kam aber wohl mehr aus Punk und New Wave und aus der Arbeit mit der S!A!U! [ein von E.S. herausgegebenes Kulturmagazin; 1978–1980)]?
Die S!A!U! war ganz essenziell. Dadurch habe ich unglaublich viele neue Leute kennengelernt. Wir haben in der S!A!U! Autoren gedruckt, die woanders nicht publiziert wurden. Es war eine Aufbruchstimmung Ende der 1970er Jahre.
Was war denn Ihre Initialzündung, den Fan zu drehen?

Die Initialzündung war eine Reportage über die ZDF-Hitparade, die ich für den Playboy geschrieben hatte. Dann kam Punk und New Wave dazu, wodurch ich die Story radikal zu Ende gedacht habe. Und es kam mein Interesse für Rituale hinzu. Da haben mich David Byrne und Brian Eno, mit denen ich oft zusammen war, inspiriert, und die waren fasziniert von afrikanischen Ritualen. Einverleibungs- und Opferrituale haben mich schon sehr interessiert. Das lag auch in der Zeit.
War die Finanzierung des Fan schwer auf die Beine zu stellen?
Die war überhaupt nur durch einem Trick möglich: Indem ich nach einer Ablehnung durch die FFA, die Förderanstalt, die Geschichte geändert und als Traum dargestellt habe. Aber dann haben die Kinobesitzer absolut negativ auf den Film reagiert und Sam Waynberg hat in einer Nacht- und Nebelaktion den Schluss wieder wegmachen lassen.
Die zweite Schwierigkeit bei Der Fan war die Auseinandersetzung mit Désirée Nosbusch. Sie hatte ein Problem: Sie wollte immer das nette Mädchen sein und Komödien drehen, in Wirklichkeit ist sie ein richtiges Monster. Und zu ihrer Monstrosität ist sie nicht gestanden. Aber sie hat sich anfangs mit der Rolle total identifiziert und gesagt: „Das bin ich“. Bei den Dreharbeiten war eine lockere Atmosphäre, und sie wollte sogar, solange wir die Szenen in der Wohnung des Stars gedreht haben, keine Mustervorführungen sehen. Doch dann, als die Sache eigentlich schon gelaufen war, wollte sie zwei Einstellungen wieder raus haben. Es kam zu einem Prozess, und es ging um die Frage, ob ihr Freund und Manager, der für sie den Vertrag unterzeichnet hat, überhaupt dazu berechtigt war, weil Desirée Nosbusch noch minderjährig war.
Ich muss sagen, mein filmisches Leben wäre anders verlaufen, wenn ich weiter mit ihr Filme gemacht hätte, sie war meine liebste Darstellerin. Ich weiß nicht, ob es positiver verlaufen wäre – es hätte eine Kette monströser Filme mit ihr gegeben –, aber sie war die Schauspielerin, die ich mir immer gewünscht hatte. Ich habe ihr auch noch mehrmals Angebote gemacht, zum Beispiel für Das Wunder (1985).
Der Erfolg des Fan hat Sie aber angetrieben, weiter Filme zu machen?
Ich hatte danach mehr Möglichkeiten … Sie müssen es so sehen: Ich bin der einzige deutsche Regisseur, der nie mit dem Fernsehen kooperiert hat. Bei anderen Filmen läuft es so ab: Da ist ein Fernseh-Redakteur, der mit dem Produzenten befreundet ist. Und dadurch bekommt die Produktionsfirma vom Sender einige Millionen sozusagen reserviert. Und mit dem zweiten Bein, der Filmförderung, ist das Projekt finanziert. Einen Sender zu haben war und ist entscheidend für die Filmförderung. Und da ich keinen Sender hatte, gab es immer Schwierigkeiten mit der Finanzierung, anderseits hatte ich meine Freiheit. Die Filme hat Sam Waynberg letztlich über die Videoauswertung finanziert. Ich war über Jahrzehnte der einzige deutsche Regisseur, der durch Video schwarze Zahlen gemacht hat. Und die Indizierung von Loft, Gold der Liebe und Der Fan war damals eher fördernd. Durch diese Basis hat sich Sam Waynberg immer wieder zu einem neuen Film von mir überreden lassen. Aber trotzdem war die Finanzierung immer ein Abenteuer.
Wie sind Sie zu Ihrem Pseudonym Raoul Sternberg gekommen?
Das war, als ich für die Süddeutsche Zeitung gearbeitet und am Tag drei Kritiken für die Fernsehseite schreiben musste. Der Redakteur fragte mich damals, ob ich ein Pseudonym wüsste.
Auch die Figuren in Ihren Filmen nennen Sie meistens Raoul, manchmal aber heißen sie Frank …
Ich finde den Namen Raoul einfach sehr schön, aber meine Frau sagte schon öfters, wenn noch einmal in meinen Filmen jemand Raoul oder Raphaela heißt, lässt sie sich scheiden, und in solchen Fällen bin ich auf Frank ausgewichen. Aber Frank heißen die Helden, mit denen ich weniger zu tun habe, die eine neutrale Rolle spielen.
Und Raphaela?
Raphaela bin eigentlich immer ich.
Reden wir noch über die Faschismusthematik, die in Ihren Filmen immer wieder auftaucht.
Auf diese Spur bin ich über die New-Wave-Gruppe Devo gekommen. Die traten in ihren Konzerten als futuristische Arbeiter auf und mit denen habe ich Stunden und Tage über die Faschismus-Problematik diskutiert. Und die haben mich gelehrt, diese Dinge anders und ›unschuldiger‹ zu sehen. Faschismus ist ein Teil der Geschichte und eine moralische Haltung dazu bringt erstmal gar nichts. Der Fan und Gold der Liebe habe ich als Bild für das Verhältnis zwischen Volk und Führer gesehen. Die Frage ist für mich: „Hat Hitler die Deutschen verführt, oder haben sich die Deutschen Hitler geholt?“ Eine nicht auszuschöpfende Frage.
Da Sie ja selber Kritiker sind, möchten wir wissen, wie Sie die durchweg negativen Kritiken verarbeitet haben?
Die Begegnung mit Douglas Sirk, Jean-Pierre Melville und anderen, die durch finstere Zeiten gegangen sind, sowie die 300 Folgen von Heut’ abend, wo es keinen einzigen Gast gab, der nicht Probleme hatte, haben mich bestärkt, dass ich meinen Weg gehen muss. Es ist schwierig, aber ich kann es nicht ändern. Das einzige, was man tun kann, ist den nächsten Film drehen.
Erzählen Sie uns doch zum Schluss noch die Geschichte mit der Ohrfeige von Reinhard Hauff.

Reinhard Hauff war anfangs ein guter Freund von mir. Wir haben zusammen studiert, und wir sind einmal gemeinsam aus einer Vorlesung gegangen, um zu beschließen, die Uni zu verlassen. Der Professor hatte uns Fragen von diesem Schwierigkeitsgrad gefragt: „Hier sehen Sie eine weiße Wand. Welche Farbe hat diese Wand?“ Er kriegt keine Antwort und meint: „Sie wissen also nicht, dass diese Wand die Farbe Weiß hat?“ Schweigen. An diesem Tag haben wir beide zu uns gesagt: „Ab heute ist die Uni für uns zu Ende.“ Uns hat also damals einiges miteinander verbunden. Dann haben sich unsere Wege getrennt. Er wurde zum braven Betroffenheitslinken – ich war sowas höchstens peripher.
In Christ und Welt habe ich dann eine Kritik über Hauffs Endstation Freiheit (1980) geschrieben und gesagt, dass hier jemand Standpunkte vertritt, die er gar nicht lebt, und habe ihm unterstellt, dass er groß abkassiert. Später gab es die Begegnung Hauff – Schmidt, nachts in der Agnesstraße, wo wir beide wohnen. Er hatte einen Hund an der Leine. Es beginnt ein normales Gespräch, und dann sagt er: „Was du da geschrieben hast, finde ich unmöglich.“ Ich antwortete: „Du weißt genau, dass das stimmt.“ Wir haben also unterschiedliche Standpunkte und plötzlich schmiert er mir eine. Ich habe überlegt, ob ich zurückschlagen soll, habe aber gezögert, wegen des Hundes. Zu Hause habe ich mir gesagt, den zeige ich an, und hab den Prozess dann auch gewonnen.

















Kommentare zu „Von Ulm in die weite Welt – Interview mit Eckhart Schmidt“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.