Ständige Vertretung – US-Filme beim DOK Leipzig
Die diesjährige Retrospektive des DOK Leipzig widmet sich der eigenen Festivalgeschichte und präsentiert eine Auswahl aus den erstaunlich vielen US-amerikanischen Filmen, die dort zu DDR-Zeiten liefen. Kuratorisch verantwortlich für die Schau „Un-American Activities“ sind Tobias Hering und critic.de-Autor Tilman Schumacher. Ein Gespräch.

Lukas: Der Titel der Reihe verweist auf das House Un-American Activities Committee, das von 1938 bis 1975 aktiv war, aber heute vor allem mit der sogenannten McCarthy-Ära der 1950er Jahre verbunden wird. Einer der Filme der Reihe beschäftigt sich auch direkt mit dem Committee, allerdings setzt die Auswahl erst im Jahr 1962 an, als die McCarthy-Ära ihren Höhepunkt bereits überschritten hat. Dazu zwei Fragen: Warum kommen die 1950er im Programm nicht vor, gab es in den ersten Festivaljahren noch keine (interessanten) amerikanischen Filme im Programm? Und: Prägt das Erbe der McCarthy-Zeit das Programm in anderer Hinsicht?
Tilman: Unserem Kenntnisstand nach ist 1962 das erste Jahr, in dem die Internationale Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche, wie das Festival zu diesem Zeitpunkt hieß, einen US-Film im Programm hatte: eben Robert Cohens Commitee for Un-American Activities, der die Geschichte, das jahrelange medienwirksame Treiben und den Einfluss, den das Committee auf das Alltagsleben von US-Amerikaner:innen hatte, in einer hybriden Filmform aus dokumentarischem Found Footage und inszenierten Passagen nachgeht.
Bis 1989 gibt es dann kein Jahr mehr, in dem kein US-Film beim Festival lief. Das haben unsere Recherchen im Bundesarchiv ergeben, wo die erhaltenen Festivalakten heute lagern. Es gibt vermutlich zwei Gründe dafür, dass erst 1962 – also in der 5. Ausgabe des DOK – ein solcher Film aus den USA auf dem Festival lief: Zum einen waren die ersten beiden Ausgaben des Festivals 1955 und 1956 noch als „gesamtdeutsch“ angelegt, es wurden also nur Produktionen der DDR und BRD berücksichtigt. Von 1957 bis 59 fand das Festival aus unterschiedlichen Gründen gar nicht statt. Als es dann 1960 weiterging, war das Programm schon sehr international aufgestellt, und ab 1961 hieß es dann auch „Internationale Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche“.

Tobias: Wenn schon 1962 drei Filme aus den U.S.A. im Programm auftauchten – neben Committee for Un-American Activities waren das Sunday von Dan Drasin, den wir ebenfalls zeigen und The Black Fox, eine Hitler-Satire von Louis Clyde Stoumen – so erscheint uns das bemerkenswert früh, noch dazu ein Jahr nach dem Mauerbau. Das widersprach doch etwas den gängigen Vorstellungen davon, was der Kalte Krieg auf dem Feld der Kultur zuließ und was nicht. Später haben wir im Bundesarchiv sogar Korrespondenzen gefunden, die belegen, dass schon 1961 ein Film von Cohen hätte gezeigt werden sollen, dessen Kopie aber offenbar auf dem Frachtweg verschollen ist. Cohen war als GI in den Fünfzigerjahren in Bremerhaven stationiert und hat 1959 sogar einen Film in der DDR gedreht mit dem Titel Inside East Germany. Der scheint allerdings in seiner ursprünglichen Form nicht mehr erhalten zu sein.
Wir haben unsere Auswahl auf US-Filme beschränkt, die in Leipzig gezeigt wurden, und als das anfing, waren die 1950er eben schon vorbei. Inhaltlich blieben sie aber präsent, und es erscheint mir auch bezeichnend, dass mit Cohens Film eine effektiv gemachte Kritik am Antikommunismus am Anfang dieser Geschichte stand. Denn das war ja ein neuralgischer Punkt: Während der Kommunismus die angestrebte Gesellschaftsform war, mit der die DDR alle Mühen und Härten des Realsozialismus zu rechtfertigen suchte, stand „Kommunismus“ für konservative Amerikaner für das Böse schlechthin. Dass beide Seiten mit dem Begriff wohl kaum dasselbe meinten, ist nochmal ein anderes Thema. Die USA als ein Land, in dem Systemkritiker als Kommunisten verfolgt werden, blieb ein wichtiger Topos der DDR-Politik und auch der Leipziger Dokumentarfilmwoche. Und Donald Trump hat die alte Keule ja kürzlich auch wieder ausgepackt, etwa gegen die demokratischen Gouverneure, die sich ihm widersetzen, oder die Unis, denen er den Geldhahn abdrehen will. Also ja, der Titel der Retrospektive verweist auf die Fünfzigerjahre, aber er spannt auch einen Bogen, finde ich, der bis zu gegenwärtigen Protesten und Polarisierungen reicht.

Tilman: Soweit wir die US-amerikanischen Filme, die während knapp 30 Jahren in der DDR-Zeit beim heute DOK Leipzig genannten Festival liefen, ermitteln und sichten konnten, war die Zeit und das Erbe der McCarthy-Ära in der Tat ein zentrales Thema. Filmisch wurde das ganz unterschiedlich aufgegriffen. Drei Beispiele: Emile de Antonio, dem wir innerhalb unserer Retro eine Hommage mit 5 Filmen widmen, und der nicht nur ein wichtiger linker Kompilationsdokumentarist der1960er bis 1980er Jahre war, sondern auch ein Netzwerker, eine Art „ständige Vertretung“, für die Präsenz von US-Dokumentarfilmen in Leipzig, hat in seinem Debütfilm Point of Order! (1964) McCarthy aus der Rückschau direkt angegriffen. Der Film ist eine verdichtete Montage der sogenannten McCarthy-Army-Hearings, die 1954 über gut 190 Stunden hinweg im Fernsehen ausgestrahlt wurden und bei denen das US-amerikanische Fernsehpublikum live mitverfolgen konnte, wie die Macht des selbsterklärten obersten Kommunistenjägers Stück für Stück erodiert. Auch in De Antonios Millhouse – A White Comedy, der vom unheilvollen und vermeintlich unaufhaltsamen Aufstieg Richard Nixons zum US-Präsidenten sowie der Mitschuld der Medien hieran handelt, ist McCarthy, zu diesem Zeitpunkt längst tot, noch omnipräsent. Nixon war Mitglied des Ausschusses für un-amerikanische Umtriebe – McCarthy selber gehörte dem Ausschuss gar nicht an – und De Antonio zeigt, dass Nixon im Grunde mit denselben schmutzigen Mitteln arbeitete wie McCarthy, und letztlich der eloquentere und gewieftere Demagoge war.
Ein drittes Beispiel: In einem viel späteren Festivalbeitrag, nebenbei einer großen Entdeckung für Tobias und mich, The Good Fight: The Abraham Lincoln Brigade in the Spanish Civil War (1984), werden Veteran:innen einer US-amerikanischen Kampfeinheit befragt, die im Zuge des Spanischen Bürgerkriegs gegen den Faschismus Spaniens und Deutschlands an der Seite internationaler Brigaden kämpften. Das erfrischend undogmatische Dokument ist nicht zuletzt deshalb spannend, da es auch darum geht, wie diese Veteran:innen in der Nachkriegszeit im eigenen Land diskriminiert wurden und ins Kreuzfeuer gerieten. Als Protagonist:innen eines linken Amerikas der 1930er und 40er Jahre wurden sie im rechtskonservativen Rollback, der nach dem Tod Roosevelts 1945 einsetzte, zu Feinden im Innern erklärt.
Daran anschließend: Die Retrospektive umfasst Filme aus drei Jahrzehnten. Könnt Ihr, auch mit Blick auf die damals in Leipzig präsentierten Filme, die ihr jetzt nicht für die Reihe ausgewählt habt, etwas dazu sagen, wie sich das Interesse Leipzigs für den amerikanischen Dokumentarfilm und dessen Themen in dieser Zeit verändert hat?

Tobias: Ich denke, das Interesse war tatsächlich grundsätzlich ein thematisches. Im Vordergrund standen in Leipzig vor allem die Themen der Filme und nicht ihre möglicherweise experimentelle Machart. Das spricht aus vielen internen Dokumenten, Reglements und Strategiepapieren, die man im Bundesarchiv findet. Immer geht es um Themen und oft werden diese auch zahlenmäßig evaluiert: wie viele Einreichungen zu welchem Thema, welchen Anteil bestimmte Themen am Festivalprogramm hatten usw. Man wollte zudem „kämpferische“ Filme. Es gibt eine schöne Stelle in einem internen „Zielsetzungspapier“ von 1964, in dem stand, dass das Festival „besonderen Wert auf den engagierten Dokumentarfilm“ zu legen habe und das Wort „engagiert“ dann handschriftlich durch „kämpferisch“ ersetzt wurde. Von Dokumentarfilmen aus den kapitalistischen Ländern wurde erwartet, dass sie dortige Missstände thematisierten und sich kritisch dazu positionierten. Das spricht aber noch nicht gegen die Filme. Missstände der eigenen Gesellschaft zum Thema zu machen, ihr den Spiegel vorzuhalten etc. ist ja ein weit verbreiteter und respektierter Selbstanspruch von Dokumentarfilmer*innen. Tendenziös wurde dann erst der Kontext, in dem diese Filme in Leipzig gezeigt wurden, denn in den Filmen aus den sozialistischen Ländern fand eine vergleichbar kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Gesellschaft nicht statt. Am Pranger standen die kapitalistischen Länder, allen voran die USA.
Wir haben versucht, Themen und Konjunkturen, die uns bei der Recherche aufgefallen sind und die uns bemerkenswert schienen, in der Retrospektive abzubilden. Uns ist zum Beispiel die deutlich zunehmende Präsenz von Filmkollektiven in den 70er Jahren aufgefallen und wir widmen daher Zweien – dem Newsreel Kollektiv und Kartemquin Films – je ein Doppelprogramm. Uns ist auch aufgefallen, dass in Leipzig nur sehr wenige Filme schwarzer US-Filmemacher*innen gezeigt wurden, obwohl die Civil-Rights-Bewegung, der Rassismus in vielen Bereichen der US-Gesellschaft und auch die Black Panther Party durchaus Themen von Filmen waren. Diese hatten jedoch in den allermeisten Fällen weiße Filmemacher*innen gemacht. Ich denke, es wäre voreilig, daraus gleich einen Rassismus-Vorwurf an die damaligen Festivalverantwortlichen zu stricken, Paternalismus hat aber sicher eine Rolle gespielt und der sprach ja auch aus vielen offiziellen DDR-Verlautbarungen zu Befreiungsbewegungen im globalen Süden. Aber das Missverhältnis in der Repräsentanz Schwarzer Anerkennungskämpfe spiegelte auch eine reale Schieflage in der amerikanischen Protestbewegung, die nicht-weiße Akteur*innen in den 70er Jahren immer lautstärker benannten. „Don’t speak in my name.“ Eine Konsequenz davon war zum Beispiel ein Konflikt innerhalb des Newsreel-Kollektivs, der 1972 zum Bruch und später zur Neu-Gründung als „Third World Newsreel“ führte, in dem nun überwiegend People of Color und mehrheitlich Frauen aktiv waren. Christine Choy, eine der Protagonist*innen dieser durchaus nicht unumstrittenen Transformation, wird zu einem Online-Gespräch zu Gast sein.
Eine andere Entwicklung, die sich aus dem amerikanischen Filmaufgebot der Jahre ablesen lässt, ist, dass es in den 1980er Jahren eine zunehmende Öffnung auch für kommerziellere Formate wie Musikfilme gab – D.A. Pennebakers Jimi Plays Monterrey lief zum Beispiel 1987 in Leipzig, Prince’ Sign o’ the Times 1988 und der Tom-Waits-Konzertfilm Big Time 1989. Darin spiegelte sich zwar eine Entwicklung, die es auch in der Ankaufpolitik des staatlichen Progress-Verleihs gab, der die Kinos der DDR belieferte, aber das waren Filme, die uns für unseren Kontext nicht mehr so interessierten und die man ja auch nicht mehr entdecken muss. Mehr interessiert hat uns das Künstlerporträt Golub (1988) von Kartemquin Films, in dem quasi am Vorabend des Mauerfalls der Gewalt geladene Bildfundus noch einmal aufscheint, der seit 30 Jahren auch über die Leipziger Leinwände gelaufen war, und der hier zum Rohmaterial für die riesigen Gemälde Leon Golubs wird.

Tilman: Ein „Evergreen“ in Leipzig waren US-Dokumentationen mit Streik- und Gewerkschaftsthematik sowie Filme, die sich mit den militärischen Interventionen der USA, allen voran in Vietnam, auseinandersetzen. Aber auch dokumentarische Porträts von Figuren eines „anderen Amerikas“ wurden über die Dekaden hinweg präsentiert, so etwa zu Paul Robeson, César Chávez und Joan Baez. Damit ist ein Amerika der Opposition angesprochen. Gerne bezog man sich auch positiv auf die ausgeprägte linke Bewegung der 1930er und 40er Jahre (etwa beim Film Union Maids, 1976) oder auf die Counter-Culture sowie die Bürgerrechtsbewegung ab den 1960er Jahren, etwa angelegt im bereits erwähnten Kurzfilm Sunday von Dan Drasin.
Was Veränderung anbelangt, kann man mit Mut zur Vereinfachung außerdem von einer stark politisierten Phase von Mitte der 1960er bis Ende der 1970er Jahre sprechen, in der viele Protestfilme des militanten US-amerikanischen Dokumentarismus samt zahlreichen Filmen von Filmkollektiven zu sehen waren. In der Frühphase gibt es hie und da auch noch Filme, die man mehr einem beobachtenden Dokumentarfilmstil zurechnen kann, die weniger stark als die Filme der späten 60er und 70er Jahre ihr politisches Argument vor sich hertragen.
Tobias: Man tut sich, glaube ich, keinen Gefallen, die Dokumentarfilmwoche vor 1990 – oder irgendein anderes Filmfestival – als eine homogene Entität verstehen zu wollen, deren „Interessen“ oder „Absichten“ sich eindeutig ermitteln ließen. Die Leipziger Dokumentarfilmwoche war eine jährlich stattfindende internationale Plattform, die sich der Staat einiges kosten ließ und die womöglich das angesehenste Kulturereignis der DDR war. Ich habe aus den Dokumenten, die ich kenne und auch aus Zeitzeug*innengesprächen und der Literatur zur Festivalgeschichte den Eindruck gewonnen, dass sich mit diesem Ereignis sehr unterschiedliche Erwartungen, Hoffnungen und Begehrlichkeiten verbanden – filmkulturelle, politische, ökonomische, persönliche. Und ich denke, dass sich auf den Wegen, wie das Programm jährlich zustande kam, trotz der hierarchischen Strukturen auch immer wieder Spiel- und Verhandlungsräume auftaten, in denen unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Akteur*innen die Filmauswahl und das Bild des Festivals beeinflussen konnten. Es gab zwar das Komitee, darunter den Direktor, dann die Auswahlkommission und natürlich eine Parteigruppe innerhalb des Festivals. Aber es sprachen ja auch externe Institutionen des DDR-Filmwesens in Leipzig mit: die DEFA, das DDR-Fernsehen, der Club der Filmschaffenden, die Hauptverwaltung Film, die Babelsberger Filmhochschule, das Staatliche Filmarchiv, das die Retrospektiven organisierte und sich auch für die Interessen der Filmclubs stark machte. Ich denke, man muss sich einen Aushandlungsprozess vorstellen, der da immer wieder stattfand. Vielleicht gehörte es dazu, so zu tun, als sei allen klar, wo es hingehen müsse und dass man sich einig sei – immerhin gab es das Festival-Reglement, in dem die ideologische Ausrichtung klar vorgegeben war. Aber gleichzeitig wussten auch alle, dass das nicht stimmte und dass jeder versuchte, auf dem abgesteckten Terrain möglichst geschickt zu manövrieren.
In der Retrospektive tauchen einige durchaus prominente Namen auf, unter anderem Emile de Antonio, dem im Vorfeld des Festivals wie erwähnt eine kleine Werkschau gewidmet ist, und Barbara Kopple. Andere bekannte Filmemacher, die man aufgrund der Themen ihrer Filme durchaus in Leipzig hätte erwarten können sind hingegen nicht vertreten, wie etwa Frederick Wiseman oder Robert Kramer, der nur als Mitgründer des Newsreel-Kollektivs vorkommt. Wisst ihr etwas darüber, wie es in diesen oder anderen Fällen zu solchen Lücken kommt? Auch die Abwesenheit von Filmemachern, die eher dem gegenkulturellen, „Underground“-Spektrum des amerikanischen Dokumentarfilms zuzurechnen sind, springt ins Auge.
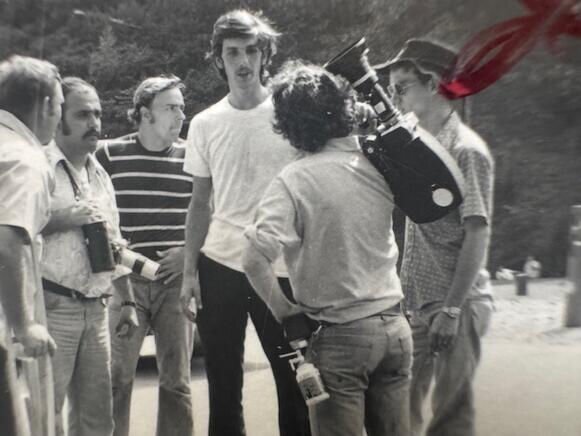
Tilman: Das stimmt. Wiseman und Kramer, aber auch Robert Frank, Les Blank, Jonas Mekas, Robert Gardner, Jill Godmilow und viele andere fehlen. Woran das liegt, ist schwer zu rekonstruieren. Ein paar Vorschläge: In der Regel war es so, dass Filmemacher des dezidiert politischen Dokumentarfilms den Weg nach Leipzig fanden, dass sie diese Bühne selbst (etwa auch über die Vermittlung Emile de Antonios) suchten und dabei von den Entscheidungsträgern in Leipzig gegenüber experimentelleren und weniger eindeutig politaktivistischen Dokumentarfilmformen präferiert wurden.
Auffällig ist etwa, dass die immens einflussreiche Dokumentarfilmströmung des Direct Cinema fast gänzlich aus der Leipziger US-Präsenz ausgeklammert wurde, nur zwei frühe Film Richard Leacocks, Happy Mother‘s Day, Mrs. Fisher und Republicans, the new breed sowie zwei Musikfilme D.A. Pennebakers liefen im Zeitraum zwischen 1962 und 1989. Meinem Kenntnisstand nach galt Direct Cinema wie Cinema Verité ab den 1960er Jahren in der DDR als eine bürgerliche, einer falschen Neutralität verpflichtete Schule des Dokumentarfilms, der man keinen Raum geben wollte. Ideologische Vorbehalte hatte man vermutlich auch bei der von dir angesprochenen Underground-Bewegung, da sie, zwar oppositionell und gegenkulturell, jedoch eben nicht mit realpolitischer Stoßrichtung versehen, sich schlecht in die Front-Logik des Festivals in Zeiten von Kaltem Krieg und Blockkonfrontation vereinnahmen ließ. Mir ist auch nicht bekannt – ohne dies bis ins Letzte einschätzen zu können – dass sich Protagonist:innen des Underground aktiv um eine Teilnahme in Leipzig bemüht hätten.
Tobias: Die Kontakte in die USA bauten sich über die Jahre auf, unter sicher nicht ganz einfachen logistischen und politischen Bedingungen. Es gab offenbar Mittler, die aus Überzeugung für das Leipziger Festival warben, neben Emile de Antonio etwa den Filmkritiker Gordon Hitchens, der auch für das Mannheimer Festival als USA-Korrespondent arbeitete. Ich habe den Eindruck, dass es durchaus ein Bemühen von Leipziger oder DDR-Seite gab, mit verschiedenen Leuten und Produktionszusammenhängen in den USA in Kontakt zu kommen, man nahm jede Kontaktaufnahme von dort gerne an. Auswahlreisen in die USA, wie sie sich etwa Oberhausen leistete, gab es aber offenbar nicht. Man war also auf informelle Netzwerke angewiesen, aber die entwickelten sich, denn wenn einmal jemand nach Leipzig gekommen war, so schien der Eindruck in den allermeisten Fällen positiv gewesen zu sein. Die Leute kamen wieder, oder reichten erneut Filme ein und ermunterten auch andere aus ihrem Umfeld dazu. Die Zahl der Einreichungen aus den USA hat ständig zugenommen. Spätestens ab Mitte der 1970er Jahre waren die USA oft das Land, aus dem der Auswahlkommission die meisten Einreichungen vorlagen – in manchen Jahren bis zu 80 Filme, von denen dann maximal 10 ausgewählt wurden, teils für den Wettbewerb, teils für das Informationsprogramm oder für Sondervorstellungen, etwa die Sektion „Preisträger anderer Festivals“.
Über die Abwesenheit von Frederick Wiseman in Leipzig hat Caroline Moine in ihrem wichtigen Buch zur Leipziger Festivalgeschichte, Screened Encounters (2018), sinngemäß geschrieben, dass seine Filme eigentlich nach Leipzig gehört hätten, dort aber nicht liefen, weil sie zu wenig militant gewesen seien, und er auch nicht dem Netzwerk angehört habe, mit dem das Leipziger Festival Kontakte pflegte. Moine hat aber auch behauptet, dass nur sehr wenige US-amerikanische Filme in Leipzig für den Wettbewerb angenommen worden seien, im Durchschnitt einer pro Jahrgang, und dass diese wenigen meist von Befreiungskämpfen in der „Dritten Welt“ gehandelt hätten. Das stimmt nun nachweislich nicht, die Retrospektive widerlegt das, und mir scheint, dass die beiden Urteile ein bisschen zusammenhängen.
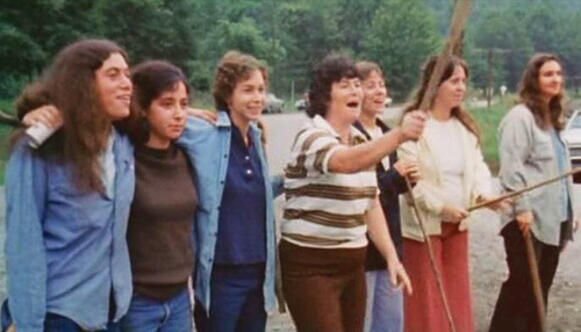
Sie basieren offensichtlich auf der Vorstellung, um nicht zu sagen dem Vorurteil, dass „Leipzig“ – aber wen meint man damit? – ein sehr voreingenommenes Interesse an US-Filmen gehabt habe und man auch nur mit einem kleinen Zirkel in den USA zu tun hatte. Es stimmt, dass sich viele der US-Filmemacher*innen, deren Filme in Leipzig gezeigt wurden, kannten und unterstützten, aber es war keine kleine homogene Szene, und sowohl thematisch als auch formal repräsentierten die gezeigten Filme eine ziemlich große Bandbreite. Wisemans erster Film, Titicut Follies, lag 1967 der Leipziger Auswahlkommission vor und tatsächlich ist im Protokoll kurz vermerkt, dass der Film „nicht dem Reglement und Motto des Festivals“ entspreche und die Sichtung nach 17 Minuten abgebrochen worden sei. Natürlich würde man sich wünschen, die Kommission hätte da mehr Geduld und womöglich gedankliche Freiheit gehabt. Aber es diskreditiert die Filmauswahl des Festivals nicht per se, wenn Filme, die in der westlichen Diskursgeschichte als politisch, systemkritisch oder radikal kanonisiert wurden, dies aus der explizit parteiischen Perspektive der Leipziger Auswahlkommission damals nicht waren. Sicher hätte weniger Reglement und mehr Pluralismus dem Leipziger Festival gut getan, aber das ist vielleicht auch eine rückblickende Wertung. Als Titicut Follies 1967 nach 17 Minuten abgebrochen wurde, war Frederick Wiseman noch nicht der, über den wir heute schreiben können, dass wir ihn in den Leipziger Programmlisten vermissen.
Ich denke, die Gründe für die ideologische Ausrichtung der Filmauswahl waren vielfältig und sie veränderten sich auch. Tatsächlich ließen sich die US-amerikanischen Filme schwerlich für ein plattes Feindbild USA einspannen, denn sie zeigten ja allein durch ihre Existenz und die filmische Eloquenz, mit der sie gemacht waren, dass sie aus einem „anderen Amerika“ kamen, für das sie sich leidenschaftlich einsetzten, einem „guten Amerika“, das in der DDR offiziell als verbündet galt, in dem aber trotz knapper Mittel und Schikanen durch Behörden oder das FBI künstlerische und staatsbürgerliche Freiheiten gelebt wurden, die es in der DDR in dieser Form nicht gab. Das knirschte, das rieb sich, und mir erscheint es interessanter und auch schlüssiger, davon auszugehen, dass dieses Knirschen und diese Reibung von einigen Programmverantwortlichen in Leipzig intendiert war, anstatt mir vorzustellen, dass dort alle Tomaten auf den Augen hatten.
Tilman: Noch angemerkt: Die beiden heute bekanntesten US-Filme, die neben Barbara Kopples Harlan County, U.S.A. auf dem DOK liefen, demnach keine „Lobby“ brauchen und deshalb von uns nicht ausgewählt wurden, sind Koyaanisqatsi (außerhalb des Wettbewerbs) und Michael Moores Roger & Me, der 1989 im internationalen Wettbewerb die Goldene Taube gewann. Nach 1989 war selbstredend die Präsenz von US-Filmen kein Politikum mehr wie ehemals.
In Eurem Text zur Reihe schreibt Ihr, dass die Machtkritik, die die Filme artikulieren, sich teils auch auf realsozialistische Gegebenheiten beziehen lässt – und dass das einigen Verantwortlichen des Festivals durchaus bewusst war, dass sie darin gar eine Stärke der entsprechenden Filme sahen. Könnt Ihr das an einem Beispiel erläutern?
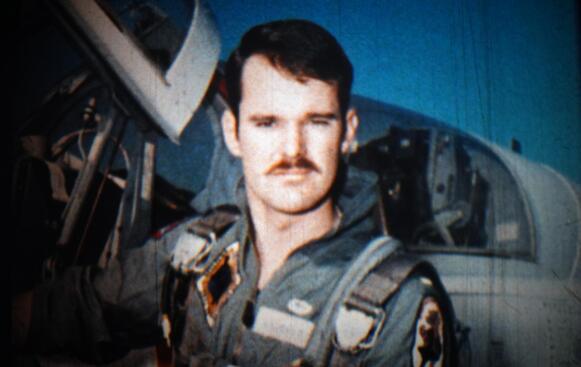
Tobias: Ein konkretes Beispiel im Sinne: Für diesen Film hat sich der- oder diejenige aus diesen oder jenen Gründen gezielt eingesetzt, kann ich dafür nicht geben, weil ich dafür keine Belege habe. Das hat aber viel mit dem zuvor bereits Gesagten zu tun, zum einen mit der lückenhaften Dokumentenlage, die einen umfassenden Blick „hinter die Kulissen“ nicht hergibt, zum anderen mit der Annahme, dass Filme, die „nach hinten losgehen konnten“, und davon gab es viele, nicht nur versehentlich durchgerutscht sind oder gar nicht verstanden wurden. Sondern dass nicht wenige, und in den Achtzigerjahren wahrscheinlich zunehmend mehr, Entscheidungsträger*innen in Leipzig das Festival auch zu einem Ort des kritischen Austauschs über die immer augenscheinlicher werdenden Probleme der DDR-Gesellschaft machen wollten. Schon Robert Cohens Committee on Un-American Activities, der für uns sozusagen am Anfang steht, weckt mit seiner Darstellung des missgünstigen, bespitzelnden und schikanierenden Staatsapparats unweigerliche Assoziationen an die Praktiken der Stasi und ich denke, dass dies auch 1962 durchaus gesehen wurde. Wir wissen aus Zeitzeugengesprächen und teils auch aus internen Rechenschaftsberichten, dass in amerikanischen Filmen immer mal wieder einzelne Szenen oder Sätze als inakzeptabel markiert und rausgeschnitten wurden – mal ging es um Mao, mal um eine Referenz auf Prag 1968. Der Schlusssatz einer der Protagonistinnen im Film Union Maids ist aber offenbar durchgegangen: „Ich glaube noch immer an den Sozialismus, aber ich bezweifle, dass irgend ein europäisches Land den Sozialismus hat, den ich mir wünschte. Die Macht sollte bei den Menschen liegen, lasst das Volk entscheiden.“
Zum Programm der Reihe geht es hier.
Wildcat Setfoto: Courtesy Deborah Shaffer









Kommentare zu „Ständige Vertretung – US-Filme beim DOK Leipzig“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.