"Eine bestimmte Form von Neuanfang" - Interview mit Cristina Nord
Gespräch mit der neuen Forums-Leiterin über kollaborative Arbeit, experimentierfreudige Gratwanderungen und die Wiederbelebung der Unverfrorenheit.
Frédéric Jaeger: Wie kam es dazu, dass du neue Forumsleiterin geworden bist?

Cristina Nord: Als ich im Goethe-Institut in Brüssel war, habe ich eng mit dem Forum zusammengearbeitet. Da habe ich eine Veranstaltungsreihe gemacht, die hieß German Filmfestivals on Tour, und dabei wurden die Filmwoche Duisburg, DOK Leipzig und das Forum vorgestellt. Birgit Kohler aus dem Vorstand des Arsenals war immer wieder zu Gast. Ein anderer Punkt der Zusammenarbeit war ein großes Festival in Brüssel und Kairo über Feminismus und Künste in der MENA-Region und in der Diaspora in Europa, und das nicht nur diskursiv, sondern auch mit vielen künstlerischen Programmen. Vor allem Performance, aber auch ein Filmprogramm. Es hieß Tashweesh. Dazu gehörte auch eine Kooperation zwischen den Goethe-Instituten in Brüssel und Kairo, Stefanie Schulte Strathaus vom Arsenal – Institut für Film und Videokunst und Helena Kritis von der Brüsseler Beursschouwburg.
Die Zusammenarbeit aus meiner Zeit bei der taz, in der ich über das Forum und das Arsenal-Programm berichtet habe, setzte sich also in diesen vier Jahren, in denen ich nicht in Berlin war, auf einer anderen Ebene fort. Somit wurde ich hier dann eingeführt als jemand, die nicht nur schreiben kann, sondern die auch Kulturveranstaltungen in einem großen Rahmen konzipieren und gestalten kann. Ich glaube, diese Kombination aus Management- und Konzeptionsfähigkeiten war dann etwas, was sehr stark für mich sprach.
Gleichzeitig war ich beim Goethe-Institut und wollte es nicht verlassen. Nachdem der Vorstand des Arsenals für ein Jahr die Interims-Leitung übernommen hatte, wollte er die Stelle der Forums-Leitung neu besetzen. Die Gespräche mit der neuen Berlinale-Leitung dauerten länger als erwartet, sodass es zu dem Zeitpunkt, als es wirklich spruchreif wurde, für eine Ausschreibung zu spät war – was der Arsenal-Vorstand und ich sehr bedauert haben.
Das heißt, du hättest dir das auch gewünscht?
Ja, weil es einfach sauberer ist. Gleichzeitig hat man aber pragmatische Dinge zu berücksichtigen, die zum Beispiel bedeuten, dass es keinen Sinn hat, ein Festival zu leiten, das im Februar stattfindet, wenn man erst im Oktober den Job antritt.
Wie haben dich deine früheren Tätigkeiten in den ersten Monaten begleitet? Erwischst du dich manchmal dabei, dass du noch unterschiedliche Blicke in dir trägst?
Ich glaube ja, dass der Blick einer Kritikerin auch sehr hilfreich ist. Mal ganz davon abgesehen, dass ich immer noch sehr schnell Texte schreiben kann, was insbesondere in diesen Tagen, in denen wir den Katalog vorbereiten, nützlich ist, und dass ich auch Texte zuverlässig redigieren kann. Dieses Handwerkszeug ist geblieben und war auch bei Goethe nie weg.
Als Kritikerin sollte man eine Grundbegeisterung mitbringen. Die hatte ich, und die hilft mir jetzt. Der kritische Blick äußert sich, wenn ich zum Beispiel relativ schnell weiß, ob ich einen Film interessant fürs Forum finde oder eher nicht. Da habe ich ein ganz gutes Gespür und kann schnell Entscheidungen treffen.
In vielen Bereichen hat man mit Werken zu tun, die schon eine Geschichte haben, die schon umgeben sind von Kontexten, über die schon erzählt wurde, und nun kommst du im Forum mit Filmen in Kontakt, zu denen noch keine Geschichte gesponnen wurde.
Ja, das stimmt. Das ist ein ganz toller Moment, wenn du etwas siehst, was dir vorher noch kein Begriff war, die ersten 15 Minuten funktionieren, und du bist angefixt und schaust weiter. Es hat dir aber vorher noch nichts gesagt, weder der Regisseur oder die Regisseurin noch überhaupt irgendwas. Das ist natürlich auch eine Herausforderung an die Urteilskraft, besonders in dem Feld, auf dem sich das Forum bewegt. Wo man nicht das konventionell narrative Kino zeigt, sondern eines, das dazu neigt, experimentierfreudiger zu sein.

Je experimentierfreudiger ein Film ist, desto mehr kann auch schiefgehen. Gerade dann, wenn man ausgetretene Pfade verlässt, kann man intensiv danebenhauen. Wenn man versucht, Filme aufzuladen und eine magische Ebene zu berühren. Sowas wie der Tiger im Baum bei Tropical Malady. Das sind natürlich Momente, auf die wir als Kritiker*innen total wild sind, aber sowas herzustellen ist eine irrsinnige Gratwanderung, denn wenn du zwei Dinge anders machst, ist es einfach nur dummer Kitsch, esoterisch oder stereotyp. Das zu beurteilen ist nicht immer einfach. Deswegen sind wir auch eine Gruppe mit unterschiedlichen Sensibilitäten und unterschiedlichen Zugängen und reden dann über solche Dinge.
Wie hat sich denn die Auswahlkommission zusammengefunden? Und wie hat sich dieser gestaffelte Auswahlprozess gestaltet?
Ich habe versucht, dieses geografische Konzept aufzulösen, da das oft in die Richtung mündet, dass der oder die Delegierte für die bestimmte Region sich auch als Anwalt oder Anwältin dieser Region versteht, und das kann die Entscheidung über die Qualität der Filme trüben. Außerdem wollte ich auch Leute haben, die Expertise haben im Hinblick auf Dinge wie Queer Cinema wie Jan Künemund oder auch Post-Internet-Bildproduktion wie Vincent Stroep aus Antwerpen. Die Aufgabe der Beraterinnen und Berater ist es, Input zu geben, aber auch Filme zu sehen und zu kommentieren. Im Komitee ist das natürlich auch unsere Aufgabe, und dann treffen wir uns manchmal drei, manchmal vier Tage am Stück im Arsenal und gucken Filme.
Ihr habt es ja ein bisschen verändert. Ihr seid jetzt nur noch fünf, vorher waren es mal neun.
Genau, 2018 waren es, glaube ich, acht, und davor waren es neun. Der Hintergrund war, dass ich ein kleineres Komitee möchte, das schnell Entscheidungen treffen kann und in dem die Diskussionen produktiv sind. Dann gibt es auch noch so Dinge wie Terminfindung, da es einfach schwierig ist, neun Leute zur gleichen Zeit in ein Kino zu bringen.
Zum ersten Mal waren Birgit Kohler und Stefanie Schulte Strathaus nicht mehr im Auswahlkomitee?
Die beiden beraten nach wie vor. Sie haben extrem viel Expertise, und es wäre ja dumm, nicht darauf aufzubauen. Gleichzeitig geht es aber auch um eine bestimmte Form von Neuanfang, und auch die Arbeitsbelastung im Arsenal ist ja keine kleine.
Du meintest, du willst, dass Entscheidungen schneller getroffen werden – heißt das, dass du das Komitee als eine Form demokratischer Entität verstehst? Oder gibt es auch Situationen, in denen du allein entscheidest, dass ein Film auf jeden Fall ins Programm kommt? Vielleicht ist das ja auch manchmal nötig.
Das ist auf jeden Fall manchmal nötig, klar. Es gibt Situationen, in denen man schnell sein muss, und ich mache das, wenn ich meine, ich muss es machen. Das heißt, ich habe qua Position diese Möglichkeit. Ich kann Filme einladen, auch wenn sie ansonsten niemand gesehen hat. Ich kann auch Filme einladen, obwohl die anderen vier meinen: „Ne, wollen wir nicht.“ Die Frage ist eben, wie oft ich das tue, ob ich das tue …
Ja, welchen Begriff du vom kollaborativen Arbeiten hast.
In den allermeisten Fällen wird diskutiert, und dann bilden sich meistens Mehrheiten. Aber ich finde es schon wichtig, dass ich, die ich auch die programmatische Ausrichtung präge, die Möglichkeit habe, bei einem Film, der mir sehr zusagt, weil er der programmatischen Ausrichtung entspricht, entscheiden kann: Den nehmen wir jetzt. Bei insgesamt 35 Filmen ist das, glaube ich, auch verschmerzbar.
Weil du von programmatischer Ausrichtung sprichst – meinst du und möchtest du, dass man eine Art Nord-Handschrift im Programm wiedererkennt?
Vielleicht ist das etwas viel erwartet vom ersten Jahrgang, aber ich denke schon, dass sich nach und nach etwas abzeichnen wird. Vielleicht keine „Nord-Handschrift“, da es, wie gesagt, ein kollaborativer Prozess ist, aber doch gewissermaßen eine neue Handschrift. Ich denke, das ist auch nötig, da sich das ganze Gefüge ja ändert. Das heißt auch, dass die Rolle, die das Forum zu Zeiten der Kosslick-Berlinale innehatte, heute nicht mehr ohne weiteres gegeben ist. Dinge ändern sich ja, wenn sich der Kontext ändert. Das ist auf jeden Fall etwas, über das wir uns Gedanken machen. Wir schauen, dass das Profil klar erkennbar ist. Dass wir die Sektion sind, die viele Essayfilme zeigt, die zwischen Dokumentar- und Spielfilm umherspringen, die experimentierfreudig sind, die klassischeren Narrationen nicht entsprechen … das war immer auch schon alles der Fall, aber wir wollen uns stärker darauf fokussieren.
Aber erstmal ist die Kontinuität zu dem, wie sich das Forum in der Vergangenheit begriffen hat, größer als die Veränderung oder die Fokussierung, die du vornehmen möchtest?
Ja, das wäre auch komisch, wenn man sagen würde, jetzt zeigen wir ganz viele Arthouse-Filme mit ’nem hohen kommerziellen Potenzial.
Midnight-Filme …
Midnight-Movies – gutes Stichwort. Gab es früher, gibt es aber nicht mehr, weil keiner mehr um Mitternacht ins Kino geht. Verhältnisse ändern sich, Kontexte ändern sich. Es gibt Netflix, die Leute gucken Midnight-Movies, wenn überhaupt, zu Hause. Es gibt das Hongkong-Kino aus den 90ern, das man hoch und runter abfeiern konnte, so nicht mehr …
Was ich toll finde und wo ich mir schon vorstellen könnte, davon in Zukunft mehr zu zeigen, sind Filme, die mit relativ niedrigem Produktionsetat entstehen konnten, was früher B- oder C-Movies waren, die sich eben, weil sie weniger Wert auf Glossyness oder ähnliches legen, auch mehr trauen können.
Im Sinne von Tabubrüchen?
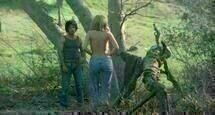
Ja, genau, im Sinne von viel radikaleren Verhandlungen. Wenn man sich B-Movies aus den 70ern anschaut und wie Frauen- und Männerrollen verhandelt werden, hatte das ganz oft eine Unverfrorenheit, die das Hollywoodkino zu dem Zeitpunkt nicht haben konnte. Das B-Movie hat da quasi draufgehauen. Da gibt es auf der einen Seite natürlich eine sehr frauenfeindliche Tradition, aber auf der anderen Seite gibt es auch jemanden wie Stephanie Rothman, die in diesem Umfeld sehr feministische Filme gemacht hat. Sowas finde ich sehr interessant. Wir versuchen nun zu gucken, ob wir aktuelle vergleichbare Filme irgendwo finden. Wir waren in diesem Jahr in der Hinsicht nicht so erfolgreich, aber wir haben immer mal wieder in die Richtung geguckt. In Wirklichkeit ist das ja auch eine Forums-Tradition.
Total. Eine, die vielleicht in den letzten 15 Jahren abgenommen hat. Was, glaube ich, auch äußere Gründe hat. Das wäre ja auch die Herausforderung: Wie kommt man an Filme, die sich eigentlich um Festivals nicht scheren?
Ich glaube auch, dass Streamingdienste das zum Teil abdecken. Gerade was auch Filme für ein Diaspora-Publikum anbelangt, die nigerianisch-britischen Filme und Serien auf Netflix, die ich total interessant finde. Auch weil es einen Markt dafür gibt, aber das ist etwas, wovon das deutsche Fernsehen und auch die deutsche Filmförderung weit entfernt sind. Das Bergen des popkulturellen Potenzials von Einwanderung.
Du hast die Veränderung im Berlinale-Umfeld angesprochen. Da gibt es natürlich eine Frage, die aktuell überall gestellt wird, wenn es um das Forum geht. Was macht denn das Forum, wenn es jetzt das Forum Nr. 2 als Wettbewerb gibt – Encounters?
Dann ist erstmal meine Gegenfrage: Ist Encounters ein Forum Nr. 2?
Das wissen wir noch nicht ...
Genau. Ich würde erstmal sagen: Es ist schon ziemlich anders. Encounters zeigt weniger Filme. Beim Forum können wir Filme von Leute spielen, die vollkommen unbekannt sind, und da habe ich den Eindruck, dass das bei Encounters nicht ganz so ist. Wir haben auch Filme, die mit dokumentarischen Formen viel probieren, was, denke ich, bei Encounters auch nicht der Fokus ist. Ich habe das Gefühl, es gibt sehr viel Raum für das Forum, das Forum zu sein, und es gibt auch viel Raum für Encounters, Encounters zu sein. Und dann schauen wir uns das mal an beim Festival, wie sich das alles so gestaltet.
In der Vergangenheit war ja das Forum sehr viel enger angedockt an die Berlinale, auch weil Christoph Terhechtes Vertrag von der Berlinale abhing und er selbst Mitglied des Wettbewerbskomitees war. Es gab jetzt die Entscheidung, dass das Forum ein wenig unabhängiger wird und nicht mehr in diesem engen Sinne von der Berlinale abhängt, obwohl es natürlich trotzdem Teil der Berlinale ist.
Ich würde da gerne betonen, dass das Forum zum Arsenal gehört und auch vom Arsenal verantwortet wird. Das ist wichtig, weil das tatsächlich bedeutet, und das ist ein großer Unterschied zu den anderen Sektionen der Berlinale, dass die Programmentscheidungen unabhängig fallen. Es gibt Prozesse des Austausches und des Dialogs, an deren Ende aber nicht steht, dass jemand sagt: Ihr müsst diesen Film zeigen. Im Grunde genommen ist es diese Idealsituation, in der man unterschiedliche Expertisen zusammenbringt und dafür sorgt, dass sie sich gegenseitig befruchten und bereichern. Ich bin dem Vorstand des Arsenals gegenüber in der Rechenschaftspflicht, weniger der Berlinale. Gleichzeitig gibt es natürlich, und dafür sind wir extrem dankbar, viele Bereiche, die gerade in der Organisation gemeinsam getragen werden oder wo wir uns einfach dankenswerterweise an die Berlinale andocken können. Das heißt, es gibt eine programmatische Unabhängigkeit, aber gleichzeitig auch eine Verwobenheit.

Wir haben in diesem Jahr durch das Jubiläum einen Verweis auf die Geschichte, bei dem wir stark auf den 1971er-Jahrgang abheben, auf diesen Moment, in dem das Forum überhaupt in die Welt kam und wie das auch das Verhältnis zur Berlinale am Anfang definierte. Indem wir das in den Blick nehmen, zeigen wir auch nochmal die Geschichte einer Sektion, die gegründet wurde, weil das Hauptfestival an einen sehr schwierigen Punkt gekommen war und die Gesellschaft einfach an einer anderen Stelle war. Das Festival war quasi statischer und statutarischer als die Gesellschaft drumherum, und das war ja der Rahmen, in dem das Forum gegründet wurde.
Heute sind wir an einer anderen Stelle, und darüber werden wir viel nachdenken im Rahmen des Jubiläumsprogramms und im Rahmen eines diskursiven Tags, an dem genau solche Fragen behandelt werden – also durchaus auch selbstreflexiv.
Zum Jubiläumsprogramm: Warum kamt ihr auf die Idee, das Jahr 1971 zu zeigen, und zeigt ihr alle Filme?
Wir zeigen alle Filme, allerdings nicht alle im Rahmen des Festivals. Normalerweise spielen wir aktuelle Forumsfilme im Arsenal nach, direkt nach dem Festival, und das machen wir dieses Jahr mit der zweiten Hälfte des Jubiläumsprogramms. Die kommt dann im März im Arsenal.
Warum dieses Programm? Wir fanden es viel charmanter als ein Best-of, auch das ein kollaborativer Prozess. Wir fanden es auch super, um darauf aufmerksam machen, dass das Forum ja nicht nur das Festival ist, sondern auch mit einer Verleih- und einer Archivfunktion Hand in Hand geht, und viele Filme, die da 1971 liefen, hatten auch deswegen ein Nachleben, weil eine Kopie davon bei uns geblieben ist. Das sind oft Kopien, die heute nicht mehr spielbar sind, weil 50 Jahre eine lange Zeit sind für eine analoge Kopie. Aber nichtsdestotrotz hat es über einen längeren Zeitraum eine Fortexistenz dieser Filme bedeutet.
Fast schon ein wissenschaftlicher Zugang, sich einem Jahr zu widmen und dabei eher in die Tiefe zu gehen, statt ein bisschen von allem zu zeigen.
Es gibt viele Aspekte, die über ein wissenschaftliches Interesse hinausgehen, und das hat mit dem Jahr 1971 zu tun. Mit diesem gegenkulturellen Impetus, der auch hinter der Gründung des Forums steckte und sich in vielen Filmen des Programms abbildet. Wie viele Filme da sind, die die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung in den Vordergrund heben, anti-koloniale Kämpfe sind prominent, dann die Filme, die mit den radikalen Kämpfen in Lateinamerika zu tun haben. Die Filme sind getränkt von einem Aufbruchsgeist, der damals präsent war. Dann gab es eine Phase, in der man dachte, alles, was damals diskutiert wurde, ist Teil geworden von gesellschaftlichen Prozessen. Es hat quasi eine Mainstreamisierung der Dinge, die damals verhandelt wurden, stattgefunden. Wenn man an Filme denkt wie Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, ist die Gesellschaft heute natürlich eine ganz andere als die in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren. Das heißt, irgendwie sind all die Sachen, auch die ästhetischen Experimente, die 1971 radikal waren, irgendwann auch Teil der Nike-Werbung geworden, zugespitzt formuliert. Man könnte natürlich sagen, dann ist ja alles gut. Jetzt gerade leben wir aber in einer Zeit, in der das wieder zur Debatte steht, und all das, was so aussieht, als hätte es sich verfestigt, steht dabei infrage. Und es geht damit los, dass die radikale Rechte fast überall auf der Welt gerade auch kulturpolitisch Stellschrauben zu drehen versucht. Als ich im Herbst in Brasilien war, war das ganz stark spürbar. Gerade für das Kino, das für Bolsonaro eine Art Schreckgespenst ist und wo die guten Bedingungen, die die brasilianische Filmindustrie hatte, zurückgedreht und eingeschränkt werden. Heute vertreten Menschen und politische Parteien öffentlich frauenfeindliche, antisemitische, rassistische Positionen. All das ist wieder da, wenn es denn je ganz weggewesen ist.
Das heißt, wir haben den Eindruck, dass das, was 1971 in der Luft war, nicht eins zu eins wieder in der Luft liegt, aber dass Errungenschaften von progressiven Bewegungen stark unter Beschuss sind und wir uns dazu verhalten wollen und können, indem wir diese Filme präsentieren und indem wir diese Radikalität von damals und diesen Aufbruch von damals nochmal in unser Gedächtnis rufen. Ich finde, das ist sehr reich, auf der gesellschaftlichen, aber auch auf einer ästhetischen Ebene.

Was ich daran klasse finde: Wenn ich mir einen Film anschaue wie The Woman’s Film von der Newsreel Group, dann habe ich auf der einen Seite das Gefühl, das ist Lichtjahre entfernt, das hat mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun. Das sind Frauen, die fast in so einem selbsthilfegruppenartigen Setting sitzen und dann entweder im Kreis oder im Close-up von ihren Erfahrungen berichten. Von ihren Familien, ihren Arbeitsstellen, und du hast den Eindruck, die erzählen das erste Mal davon, wie sehr es nervt, nirgendwo ernst genommen zu werden. Wie fürchterlich es ist, den ganzen Tag zu arbeiten und dann abends nach Hause zu kommen und dann erwartet der Ehemann, dass man den Haushalt schmeißt. Auf der anderen Seite ist der Film auch wieder nah dran. Und ich glaube, dieses Nähe-Distanz-Verhältnis kann sehr bereichernd sein im Hinblick auf die Seherfahrungen, wenn man sich mit dem Jubiläumsprogramm beschäftigt.
Gleichzeitig wird es sehr viele Echos geben zwischen den Filmen im Jubiläumsprogramm und dem aktuellen Forums-Programm.
Spürt man manchmal bei Filmen, so etwas wie einen „Instant Classic“ vor sich zu haben? Filme kann man ja auf unterschiedliche Weisen lieben. Und bei manchen vibriert etwas, da weiß man, da wird ganz viel passieren mit dem Film.
Also ich hätte schon das Gefühl, dass da auf jeden Fall Filme sind, mit denen viel passiert. Wir haben zum Beispiel einen Eröffnungsfilm. Und da sind dieses Hin- und Herlaufen zwischen Vergangenheit und Gegenwart und möglicherweise auch ein In-die-Zukunft-Gucken total Mise-en-abyme-mäßig drin. Das ist ein Film von Raúl Ruiz, sein erster, unvollendeter Spielfilm, den Valeria Samiento jetzt fertiggestellt hat, EL TANGO DEL VIUDO y su espejo deformante (dt.: Der Tango des Witwers) heißt der. 1973 ging der Regisseur ins Exil, das Material blieb in Chile und tauchte viel später wieder auf. Das heißt, in seiner Entstehungsgeschichte umspannt der Film diese 50 Jahre. Der Film schreitet voran, es geht um den Witwer, der von seiner verstorbenen Frau heimgesucht wird, die lauter alberne Sachen macht. Irgendwann gibt es aber einen Punkt, ab dem der Film rückwärts läuft, und das ist einfach prima, wenn du ein Programm machst, das sich so intensiv mit dem, was war, auseinandersetzt und was das für heute bedeuten könnte, und dann hast du plötzlich so einen Film, der genau solche Bewegungen in Szene setzt. Das fand ich sehr, sehr schön, und da habe ich schon das Gefühl, dass das etwas ist, das bleiben wird.
Weil das der Film ist, der sozusagen schon zur Hälfte historisch ist?
Genau, quasi das Bindeglied. Wir haben tatsächlich ziemlich viele Filme im Programm, die sich mit Dingen, die in der Vergangenheit lagen, auseinandersetzen und dafür auch Darstellungsformen finden, die mit Archiv-Material umgehen, die mit Reenactment umgehen.
Du hast schon einen aktuellen Schwerpunkt erwähnt, den es früher auch schon gab. Sind die dokumentarischen oder essayistischen Formen der Kern des Forums?
Auf jeden Fall. Das ist etwas, das verstärkt wird.
Ist das ein Bereich, der wenig bearbeitet wird? Da haben manche Filme beim Forum ja wirklich eine Heimat.

Ja, das glaube ich wirklich. Also es gibt Dokumentarfilmfestivals, dann gibt es FID Marseille und Visions du Réel, die möglicherweise diese Zwischenbereiche stärker abdecken. Ich denke da an Leute wie José Luis Guerín, Avi Mograbi, Vincent Dieutre, der auch immer wieder Filme im Forum hatte. Ich habe dafür eine starke Affinität, es ist etwas, das mich sehr reizt und dem ich viel abgewinnen kann. Gleichzeitig weiß ich, dass das Filme sind, die im regulären Kinobetrieb relativ wenig Chancen haben. Für mich ist das Forum auch ein Ort, der Filmen eine Plattform bietet, die sich im aktuellen Kinobetrieb vielleicht schwieriger behaupten können. Ich verstehe das auch ein bisschen als Auftrag, Filme voranzubringen, die es anderswo schwer haben.
Welche Filme sind für dich in diesem Jahr diese programmatischen Setzungen, von denen du vorhin sprachst?
Einer, der mir sehr interessant erscheint, ist Ouvertures, der von einem Kollektiv gedreht wurde. Der Regisseur Louis Henderson zusammen mit dem Produzenten Olivier Marboeuf und der haitianischen Theatergruppe The Living and the Dead Ensemble. Die haben einen Text genommen von Édouard Glissant, ein Theaterstück namens Monsieur Toussaint über François-Dominique Toussaint Louverture, der in der haitianischen Revolution eine ganz wichtige Rolle spielte. Die haitianische Revolution war ja ein ganz großer Testfall für die Aufklärung, weil die Sklaven auf Haiti gesagt haben: „Wenn jetzt alle Brüder sind, warum sind wir dann Sklaven?“ Dann begann eine Rebellion gegen die französische Kolonialmacht, die zunächst auch erfolgreich war, dann aber doch niedergeschlagen wurde. Der Film ist ein Triptychon. Im ersten Teil in der Jura auf den Spuren von Toussaint Louverture, der zweite Teil dann auf Haiti, da übersetzt die Theatergruppe das Stück ins haitianische Creole und studiert es dann ein, und im dritten Teil sind es vorwiegend die Geister der Toten, namentlich der Geist von Toussaint Louverture, der auch mitmachen will.
Das ist für mich ein toller Film, weil er einerseits so einen kollaborativen Prozess erlaubt und auch weil es nicht ganz so ist, dass ein Regisseur aus einem privilegierten Land in ein deutlich prekäreres Land geht und da dann einen Film macht und mit dem fertigen Werk zurückkommt, sondern es ist ein geteilter Prozess. Gleichzeitig ist es ein Film, der auf eine sehr interessante und freie Art und Weise mit etwas vertraut macht wie der haitianischen Revolution. Gerade heute, wo bestimmte Gruppen dazu tendieren, die Aufklärung als absolut zu setzen. Wenn man dann guckt, dass die Französische Revolution mit all ihren schönen Ideen von Anfang an einen Riesen-Widerspruch in sich hatte, kann man ja auch darauf kommen, dass es im Lobgesang auf den Westen auch Widersprüche gibt.
Ein anderes Beispiel ist ein israelischer Film namens The Viewing Booth von Ra’anan Alexandrovicz. Der ist für mich wichtig, weil er ein ganz, ganz kleines Setting hat. Ich finde das immer sympathisch, wenn man aus einem engen Rahmen und wenig Geld viel rausholt. Er hat eine Art Versuchsanordnung, in der er US-amerikanischen Studierenden Videos zeigt, meistens YouTube-Videos, die von NGOs genutzt werden, aber auch von der israelischen Regierung. Die NGOs versuchen, Widerstand gegen die Besetzung der Westbank hervorzurufen, indem sie Videos zeigen von israelischen Soldaten, die in palästinensische Häuser eindringen. Die Videos der israelischen Regierung sind natürlich viel freundlicher gegenüber der eigenen Politik. Man hat also dieses Videomaterial, das der Regisseur den Studierenden zeigt, und die reagieren darauf – das ist, was wir sehen. Es gibt eine Studierende, deren Eltern kommen aus Israel und haben eine starke Pro-Netanjahu-Position, und sie ist davon stark imprägniert. Dann sieht sie diese Bilder, wie unter Umständen auch sehr rabiat vorgegangen wird, und fängt dann sehr eloquent darüber zu sprechen, was sie an den Bildern stört. In einem zweiten Schritt stellt sie sich dann aber wieder selbst infrage. Die Kritik, die sie an den Bildern hat, bleibt trotzdem fortbestehen.
Das ist vielschichtig und toll und gerade in diesem Kontext Nahostkonflikt sehr selten zu sehen. Er behandelt auch weniger den Nahostkonflikt als solchen, sondern viel stärker die Fragen: Mit was für Bildern sind wir heute konfrontiert? Glauben wir diesen Bildern? Wann glauben wir ihnen nicht? Das sind ja sehr brisante Fragen.
Du hast das Programmatische jetzt an zwei Filmen festgemacht. Gäbe es noch einen dritten Titel, der in eine andere Richtung weist?
Ja, es gibt noch einen Film, der, glaube ich, noch etwas sichtbar macht, was wichtig ist. Der ist von Paula Gaitán, einer brasilianischen Filmemacherin, der heißt Luz nos Trópicos, der dauert mehr als vier Stunden. Länge ist ja auch so ein Faible von mir. Der ist eine ganz schöne Herausforderung. Sehr frei in der Narration. Unterschiedliche Stränge, die erstmal abgegrenzt voneinander funktionieren und dann brutal ineinanderfallen, dann gibt es so etwas wie Wurmlöcher im Schnitt. Du hast eine Bewegung auf der einen Zeitebene, dann hast du einen Schnitt, und in der nächsten Einstellung wird diese Bewegung wieder aufgegriffen.
Wie ein Match Cut.
Genau, dann bist du aber in der anderen Zeitebene. Dazwischen liegen 150 Jahre. Der Film ist vor allem im Amazonasgebiet angesiedelt, aber auch in Nordamerika, in New England. Im Amazonasgebiet ist es immer sehr heiß, und in Neuengland ist immer Winter. Zwei Zeitebenen, einmal die Jetztzeit und einmal irgendwann im 19. Jahrhundert. Es ist letztlich wie ein Hohelied an die Landschaft und die indigene Bevölkerung in beiden Regionen. Die Kombination aus der Freiheit der Form und der Art und Weise, wie die Landschaften gefilmt sind und wie die indigenen Figuren gefilmt sind, ist einfach toll. Das ist auch ein Film, von dem ich sagen würde, der hat sehr, sehr viel von dem, was mich anzieht.
Darf man Spaß haben im Forum?

Auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel einen Film aus Kanada von Matthew Rankin namens The Twentieth Century, und das ist ein Film, der einen Riesenspaß macht. Möglicherweise ist das etwas, was ich versuche, auch wenn ich durchaus so ein Think-Piece-Typ bin, stärker in den Fokus zu rücken. Spaß zu haben ist ein Potenzial. Ich habe den Eindruck, dieses Beharren darauf, dass Sachen auch Spaß machen – nicht in diesem Sinne von „Wir wollen die Leute abholen“, „Wir müssen jetzt auch Unterhaltung machen“ – das meine ich überhaupt nicht, aber einfach das Potenzial und die Großartigkeit von Spaß ist sehr wichtig.
Du sagtest, es gibt nur 35 Filme. Sind es also weniger als vorher?
Genau. Also mit dem Jubiläumsprogramm sind es dann wieder über 60. Vom Gesamtumfang ist es also ungefähr wie in den Vorjahren. Meine Idee ist aber auch für die Zukunft, es ein bisschen zu verkleinern, auch um die Klarheit des Profils zu haben.
Wahrscheinlich wird es in Zukunft immer 35 aktuelle Filme geben, bei denen ich den Eindruck habe, mit ihnen kann man eine bestimmte programmatische Setzung treffen, und dann zusätzlich historische Filme, weil das von Anfang an ein wichtiger Teil des Forums ist.
Und in welchen Kinos wird das Forum stattfinden?
Cinestar war ein wichtiges Kino, aber auch das haben wir in einem kollaborativen und kollegialen Prozess so ausgetüftelt, dass alle Sektionen zu ihrem Recht kommen und am Potsdamer Platz in den größeren Kinos vertreten sind.











Kommentare zu „"Eine bestimmte Form von Neuanfang" - Interview mit Cristina Nord“
Es gibt bisher noch keine Kommentare.