Yvy Maraey – Kritik
Juan Carlos Valdivia weiß um die Fallstricke der Repräsentation, weiß sogar viel zu viel über sie. Aber auch das weiß er.

Nachdem die Guaraní-Gemeinde den Weißen aus La Paz als ihren Gast aufgenommen hat, ist die Rede von einem Karneval. Bunte Farben, indigene Rituale, exotische Rhythmen: ein Versprechen für die Kamera, das aber in einem anderen Film eingelöst werden muss. Ein traditioneller Tanz ist zwar kurz im Hintergrund zu sehen, aber bald folgt der Schnitt zum Morgen danach: Eine Frau kehrt mit einem Besen die Spuren der vergangenen Nacht weg.
Juan Carlos Valdivias Yvy Maraey verweigert sich nicht nur dem ethnografischem Voyeurismus, er macht diesen selbst zum Thema: Andrés (Valdivia) ist politischer Filmemacher und möchte einen Film über die Guaraní machen. Er sucht einen Übersetzer und Guide, der ihn auf seiner Reise begleiten kann, deren Fluchtpunkt das „yvy maraey“, das „Land ohne Böses“, sein soll. Erst mal nichts Neues unter der Sonne, derlei selbstreflexive Spielereien gehören mittlerweile zur Grundausstattung eines kritisch-postkolonialen Kinos, das sich von der Arthouse-Exotik absetzen möchte (siehe etwa der deutlich konventionellere Und dann der Regen (También la lluvia, 2010). Aber Yvy Maraey dreht die Schraube noch eine Windung weiter. Nicht nur mit den besten Intentionen steigt Andrés in sein Projekt ein, sondern auch mit recht ambitionierten theoretischen Überlegungen. In einer frühen Szene redet er vor sich hin, denkt nach über die koloniale Erfahrung, über einen schwedischen Fotografen, der vor 100 Jahren die Guaraní abgelichtet hat und zum Ausgangspunkt seines Films werden soll. Nicht ein Film über edle Wilde soll es werden, sondern ein Film über die westliche Konstruktion des Wilden, über die „Kamera als Instrument des Genozids“, wie es später heißt.
Die kulturelle Identität der Weißen

Dass die Ebene der politischen Repräsentation zwar nicht einen jahrhundertealten Rassismus mal eben so abschaffen kann, aber durchaus radikale Veränderungen auch im Blick auf die Verfasstheit der Gesellschaft nach sich zieht, das ist eine der ersten Thesen eines thesenreichen Films. Bolivien ist das Land mit dem ersten indigenen Staatspräsidenten. Damit macht sich im Zentrum breit, was nach Staatsräson eigentlich an den Rand gehört. „Wir sind doch jetzt die neuen Indigenen“, sagt Andrés zu seinem Guaraní-Guide Yari (Elio Ortíz). Und der widerspricht nicht mal: „Genau, jetzt könnt ihr euch mal ein bisschen mit eurer Identität befassen.“ Das ist so etwas wie die grundsätzliche Bewegung, die Yvy Maraey anstößt. Auch Andrés wird schnell auf den Trichter kommen, dass es bei seinem Filmprojekt nicht um die Guaraní, sondern um ihn selbst geht.
Die politische Schönheit von Yvy Maraey ergibt sich dann daraus, dass der Film diese Bewegung nicht einfach affirmiert. Gerade das angstvolle Nachdenken um den richtigen Umgang mit dem Fremden kann schließlich schnell zu einem schuldbewussten Abwenden führen; man spricht dann nur noch über sich selbst und bemitleidet die eigenen Privilegien. Valdivia lässt sich nicht auf Exotismus, aber auch nicht auf derartige Selbst-Geißelung ein. Er macht weder einen Film über Indigene, noch dreht er einfach den Blick um. Anstelle der dualen Logik des Blickens setzt sich eine bewegliche Kamera, die eine Szenerie eher umkreist als festhält, sodass die Vertreter der „Kulturen“ sich zwar immer wieder gegenüberstehen, sich im Bild aber nicht gegenseitig ausschließen. Valdivia verweigert sich dabei niemals der Möglichkeit eines Gemeinsamen durch die Behauptung einer unwiderbringlich hierarchischen Differenz, sondern setzt seine Figuren buchstäblich an einen Tisch. Yvy Maraey sieht nicht zwei Kulturen, sondern race relations.
Verhältnisse statt Kulturen

Trotz mancher arg expliziter Bilder gelingt dem Film dabei eines famos: dass in jedem Moment kulturelle Fragen eine Rolle spielen; dass sie in keinem Moment die Oberhand gewinnen und die sozialen Beziehungen territorialisieren. Die Vorstellung eines indigenen Wesens wird durch die Gegenüberstellung unterschiedlicher Gemeinden und Sprachen aufgebrochen; Andrés wird auf indigene Filmstudenten treffen, die längst an ihrem eigenen Projekt arbeiten; und an die Existenz des „yvy maraey“ glauben nur – aus traditionellen Gründen – Yaris Mutter und – aus pragmatischen Gründen – ein indigener Kongressabgeordneter, für den die Behauptung einer statischen Kultur eine politische Notwendigkeit ist. In Yvy Maraey dagegen gehen überall Risse durch diese Kultur, und über das Verhältnis zum Fremden lässt sich schwerer sprechen, wenn dieses Fremde selbst nur aus Verhältnissen besteht, die wiederum ständig im Werden begriffen sind.
Valdivia erzählt indes ziemlich selbstsicher vom Verlust von Sicherheiten. Sein Film ist genauestens konstruiert, weiß von vornherein, wohin die Reise geht. Doch weil die Reise eben ins Ungewisse geht, sich in immer tieferen Labyrinthen verläuft, tut das dem Film keinen Abbruch. Die genaue Konstruktion dient den Fragen, nicht den Antworten.
Das Denken in Auflösung begriffen

So verschlägt es Andrés bald die Sprache. Die theoretischen Gedanken, die er während der Reise in sein Notizheft kritzelt, liegen bald vor ihm, zerschnitten in Papierstreifen, die ein riesiges Knäuel bilden. Zu Kausalketten lassen sich diese Streifen nicht mehr zusammensetzen; es gibt weder Anfang noch Ende, weder Prämissen noch Ergebnisse; alles hängt mit allem zusammen, die reflektierte Katze verbeißt sich in ihrem Schwanz. Das Denken treibt seinem Zusammenbruch entgegen. Will Andrés noch tiefer eindringen in sein selbst gewähltes Thema, muss er das Denken hinter sich lassen. Yvy Maraey geht eher selbst über die postkoloniale Kritik noch hinaus, indem er deren Diskurswut als Todestrieb fasst und in immer wilderen Bildern auflöst. So findet sich Andrés irgendwann – und das ist vielleicht nicht zuletzt versteckte Würdigung eines strukturellen Geschwisterfilms: Spike Jonzes Adaption (Adaptation, 2003) – allein in einem dichten Urwald wieder. Nicht der romantische, exotische Dschungel ist das, sondern der unbarmherzige, aus dem man nur mit Glück wieder rausfinden wird. „Filming is knowing is dying“, heißt es einmal.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Bilder zu „Yvy Maraey“
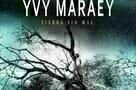



zur Galerie (5 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.






