Yours in Sisterhood – Kritik
Ein Film schaut in die Archive einer Zeitschrift und damit in die Geschichte des Feminismus. Das wirft auch ein Licht auf heutige Debatten.

Was für das Politische im Allgemeinen gilt, das gilt auch für den Feminismus und für eine Debatte wie die um #MeToo: Es handelt sich niemals um einen Stellungskrieg mit klarer Frontlinie, sondern immer um vielgestaltige Positionskämpfe. Wenn Phänomene und Begriffe wie Ermächtigung, Denunziation, Opferrollen, Post-Feminismus und Puritanismus in simple Pro-Kontra-Argumentationen gestrickt werden, dann wird als Waffe gedacht, was eigentlich Instrument sein sollte, dann wird gegenübergestellt, was eigentlich zusammengedacht gehört. Damit soll nicht die bloße Komplexität des Themas angemahnt oder gar zur Suche nach einem gemeinsamen Nenner aufgerufen werden. Im Gegenteil: Gegen diejenigen, die implizit oder explizit von der Gender-Mafia fantasieren und #MeToo benutzen, um den Feminismus gänzlich zu diskreditieren, wäre es entscheidend, Fragen des strategischen und praktischen Nutzens der #MeToo-Kampagne sowie ihre problematischen Implikationen als innerfeministische Debatten in die Öffentlichkeit zu tragen – als Konflikt also, in dem nicht der Feminismus auf dem Spiel steht, sondern seine Spielarten, als Debatte zwischen Parteien, die dem gleichen Ziel verpflichtet sind, aber Mittel und Wege unterschiedlich gewichten.
„A slap in the face of black manhood“
Nichts zeigt die Relevanz solcher Debatten so gut wie ein Blick in die Geschichte, denn auch die des Feminismus ist keine des Fortschritts, sondern eine innerlich bewegte, immer auch konfliktbehaftete, eine mit offenem Ausgang. Irene Lusztigs Dokumentarfilm Yours in Sisterhood, der dieses Jahr im Forum läuft, ist ein Film, der vollständig von dieser Geschichte lebt, der nichts anderes ins Bild setzt als Frauen, die Archivtexte vorlesen – und manchmal vielleicht noch den Ort, in dem diese Frauen leben. Die Archivtexte sind Leserbriefe ans Ms. Magazine, die 1972 gegründete, erste landesweite feministische Publikation der USA. Das Besondere an dem Projekt wird etwa zur Hälfte des Films deutlich, als sich eine Afroamerikanerin darüber freut, dass der Brief, den sie gerade vorgelesen hat – eine Beschwerde über einen Text, der mit rassistischen Stereotypen operiert, „a slap in the face of black manhood“ – damals tatsächlich veröffentlicht wurde. „Nein, wurde er nicht“, kommt die Stimme der Regisseurin aus dem Off. Bis auf einen sind die Briefe aus den 1970er Jahren, aus denen Yours in Sisterhood besteht, unveröffentlicht geblieben, erblicken somit durch den Vortrag in die Kamera erstmals das Licht der Welt.
„All men are chauvinist pigs“
Teils sind das Dankesbriefe für die Eröffnung neuer Sichtweisen durch die Zeitschrift, stolze Berichte über eigene Fortschritte dank theoretischer Ermutigung, kritische Hinweise auf blinde Flecken oder gar wütende Drohungen, Angebote eigener Texte und, natürlich, auch Fallgeschichten sexueller Übergriffe. Einige wenige der damaligen Schreiberinnen hat Lusztig ausfindig gemacht und persönlich besucht, die meisten der Briefe werden aber von Frauen gelesen, die aus dem gleichen Ort kommen wie die einstigen Autorinnen und einen ähnlichen sozialen Hintergrund haben – was dem Film die Möglichkeit eröffnet, Distanzen zu vermessen, nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu forschen. Neben den erwartbaren Diagnosen – von „Das waren ja ganz andere Zeiten damals!“ bis zu „Das ist ja immer noch genauso!“ – führt diese Überlagerung von Zeitlichkeiten aber vor Augen, wie durch die Neue Frauenbewegung Anfang der 1970er Jahre ein gänzlich neues Diskursfeld eröffnet wurde, das für uns heute selbstverständlich ist, und wie durch eine politische Intervention Dinge sagbar gemacht wurden und Begriffe geschaffen wurden. Wenn eine 13-Jährige im Jahr 1974 schreibt, dass sie glaube, alle Männer seien „chauvinist pigs“, dann verbirgt sich hinter der leicht wegzulächelnden Generalisierung noch die kämpferische Kraft von etwas Neuem, von der Benennung eines Phänomens, das erst durch diese Benennung als gesellschaftliches erkennbar wurde, das vorher keinen Namen hatte, weil es standard procedure und natürliche Ordnung war.
„I never was for women’s liberation, until I was looking for job“

Das Ms. Magazine institutionalisierte diese Intervention und verbreitete sie bis in entlegenste Winkel des Landes. Der Großteil der Orte, die Lustzig aufsucht, sind nicht die großen Städte, in denen die Frauenbewegung am sichtbarsten war, sondern Kleinstädte, Vorstädte, Provinznester und sogar eine abgelegene Hütte irgendwo in einem Wald von Oregon. Quer durch das amerikanische Rhizom hindurch entstand die Idee eines Gemeinsamen und die Notwendigkeit einer gemeinsamen Sprache, eines gemeinsamen Kampfes. Freilich war diese Idee zugleich immer ein prekäres Gebilde, das macht auch Yours in Sisterhood mehr als deutlich.
Eine Chicana-Frau etwa beschwert sich über die Unsichtbarkeit ihresgleichen auf den Seiten des Blattes, eine Native American schreibt einen empörten Brief zu einem kritischen Artikel über das Jagen und erinnert an die zentrale kulturelle Bedeutung dieser Praxis für ihre Kultur, eine andere Frau, eher der white working-class zugehörig, erklärt das Schießen sogar kurzerhand zum einzigen Sport, in dem ihr Geschlecht keine Rolle spielt. Es kommt eine christliche Frau zu Wort, die sich als Feministin und gleichzeitig als Abtreibungsgegnerin versteht, und es werden Klassenunterschiede deutlich zwischen dem Feminismus der Universitäten und dem auf die harte Tour entstandenen: „I never was for women’s liberation, until I was looking for job“, heißt es in einem Brief von einer Frau, die Polizistin und dann Tischlerin werden wollte. Im vielleicht eindrücklichsten Teil liest eine schwarze Frau einen Brief vor, in dem eine „Genossin“ anlässlich eines großen Streits auf einer NOW-Konferenz zur Einigkeit aufruft – und glaubt instinktiv zu wissen, dass die Autorin von damals weiß gewesen sein muss, die Sprache der selbsterklärten Sprachrohre der Sisterhood erkennend.
„A rigid narrow track that was set up for me before I was even born“
Wenn auch Yours in Sisterhood hier beinahe etwas schematisch wirkt, wie ein allzu fein säuberlich austariertes Diversity-Panorama nach aktuellem Stand: Wie in ein paar ausgegrabenen Briefen schon Fragen von Klassen- und ethnischer Zugehörigkeit, von Religion und tradierten kulturellen Praktiken in diesem vom Ms. Magazine eröffneten Raum zusammentreffen und sich zugleich zuwiderlaufen, das weist auf die inneren Bewegungen des Feminismus hin, die zumindest in der bürgerlichen Öffentlichkeit heute kaum noch diskutiert werden – selbst wenn sich diese Öffentlichkeit als eine post-feministische insofern versteht, als sie die Errungenschaften der Frauenbewegung für unhintergehbar hält. Und ist nicht #MeToo zunächst die ähnliche Eröffnung eines Raums für Debatten, ist nicht der Hashtag die heutige Entsprechung des Leserbriefs?
Dass diese Debatten heute teilweise anders funktionieren, hat auch mit den veränderten Bedingungen und untergründigen Logiken zu tun, in die sie eingebettet sind. War der Feminismus mal Bewegung, etwas, das aufbegehrte gegen verkrustete Strukturen, gegen männliche Herrschaft, gegen Alltagssexismus, gegen unbezahlte Reproduktionsarbeit, so wird er jetzt – der so häufig bemühte wie selten verstandene Begriff des „Gender-Mainstreaming“ bringt’s auf den Punkt – als ein Status quo verstanden, selbst als Struktur, als veraltete Kruste, die ihrerseits aufgebrochen werden muss. Wenn das weibliche Opfer eines sexuellen Übergriffs nicht mehr als politisches Subjekt wahrgenommen wird, das sich ermächtigt, über etwas zu sprechen, über das ihm zu schweigen geboten wurde, sondern selbst als machtvolle Frau, die aus Spaß an der Freude so lange gewartet hat, um nun ihren Peiniger an den Pranger zu stellen, dann zeugt das von einer vollständigen Umkehr des Verhältnisses von Freiheit und Zwang: Nicht mehr wird die Idee der Befreiung gegen gesellschaftliche Zwänge in Stellung gebracht (gegen den „rigid narrow track that was set up for me before I was even born“, wie es in einem Brief heißt), sondern es belagert nun der angebliche Zwang zur politisch korrekten Gesinnung die Freiheit eines Subjekts, das kein Produkt der Verhältnisse mehr ist, sondern seines und ihres Glückes Schmied.
Ein grundlegenderer Kampf
Unterhalb der Argumente und Begriffe in der #MeToo-Debatte tobt ebenso wie unter anderen aktuellen Diskursen ein noch grundlegenderer und vielleicht gefährlicherer Kampf, ein Kampf um das, was als Gaspedal und was als Bremse verstanden werden darf, was auf Seiten von Freiheit und Individuum steht, was auf Seiten von Zwang und System – wer die starre Macht ist und wer der bewegte Widerstand. Nicht auf Ebene der ausformulierten Argumente, sondern im Framing des Feminismus als Blockade und Regulierungssystem können schließlich auch expliziter Anti-Feminismus und die liberale Kritik am Puritanismus von #MeToo zueinander finden. Auf der Berlinale stürmten ein paar Frauen der Identitären das Podium einer #MeToo-Diskussion, um unter dem Banner von #120db (der Lautstärke von Taschenalarmen) ihren feministisch getarnten Kampf gegen „Migrantengewalt“ in Bewegung zu bringen.
Handlungsmacht zu vergrößern, nicht nur einzelne Individuen, sondern soziale und politische Subjekte zu ermächtigen, ohne dabei selbst die Kleider der Macht anzuziehen, also in Bewegung zu bleiben, das ist vielleicht eine der entscheidendsten Herausforderungen für feministische Interventionen, die nicht Gefahr laufen wollen, in bloße Rückzugsgefechte zu geraten. Wichtiger als die Frage, ob #MeToo nun uneingeschränkt zu affirmieren oder zu kritisieren ist, wäre also die Frage, wie sich die Potenziale und Gefahren des Phänomens zueinander verhalten. Zu dieser Frage gehört das Verhältnis des Feminismus zur Sexualität ebenso wie die blinden Flecken und Ausschlüsse des #MeToo-Phänomens. Wohinter man dabei nicht zurückfallen darf: dass es nicht zuletzt um die (Wieder-)Eröffnung eines Diskursraums geht, der nicht wieder geschlossen, sondern gefüllt werden will.
Neue Kritiken

Ungeduld des Herzens

Melania

Primate

Send Help
Trailer zu „Yours in Sisterhood“

Trailer ansehen (1)
Bilder


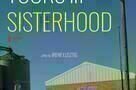
zur Galerie (3 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.








