Yomeddine – Kritik
Auch nur ein Mensch: A.B. Shawky begleitet in Yomeddine einen Leprakranken auf ein Road Movie durch Ägypten – mit humanistischen Abkürzungen.

„Ich bin nicht krank“, sagt Beshay einmal, „ich habe nur Narben, die nicht mehr verschwinden.“ Diese Narben haben nicht nur seine Hände und Füße verkrüppelt, sondern auch sein Gesicht entstellt, und dieses entstellte Gesicht ist Epizentrum von A.B. Shawkys Debütfilm Yomeddine, der es überraschend in den Wettbewerb von Cannes geschafft hat. Wir blicken auf vernarbte Haut, auf wulstige Furchen, fahren erstaunliche Gesichtszüge nach, die an Lynchs Elefantenmenschen (1980) gemahnen, und sehen diesem etwa 40-jährigen Beshay natürlich trotzdem nach und nach in die Augen. Das Problem dieses Films: Dass wir das können, wollen, sollen, das sieht er nicht als Prämisse, sondern als Aufgabe.
On the Road to Humanity

Beshay lebt in einer Kolonie für Leprakranke, führt dort ein armes, aber nicht elendes Leben, bald aber ein sehr einsames, denn wie es das Schicksal so will, kehrt seine Frau von einer Kur nicht mehr zurück. Dieses Ereignis verwitwet Beshay nicht nur, sondern setzt auch eine große Reise in Gang. Weil auf einmal eine Schwiegermutter auftaucht, weil er dadurch erfährt, dass die Kolonie Buch führt über die Verwandtschaftsverhältnisse ihrer Bewohner, kommt Beshay nun auch auf den Trichter, irgendwo da draußen eine Familie zu haben. Und obwohl ihm die Heimleitung nur seinen Geburtsort nennen kann, macht er sich auf den Weg ins Roadmovie und kann nicht verhindern, dass sich ihm ein kleiner dunkelhäutiger Junge aus dem benachbarten Waisenhaus anschließt, der, ein bisschen albern, auf den Namen Obama hört.
Dass die beiden ihre Beziehung intensivieren, dass sie zwischenzeitlich vom Weg abkommen, dass ihnen Steine in den Weg gelegt werden, dass sie von der Gesellschaft da draußen belästigt und beschimpft werden, Beshay immer wieder auf seinen verkrüppelten Körper zurückgeworfen wird, dass sie aber auch neue Freunde finden, Solidarität erfahren werden, dass hart geschnittene Brutalitäten sich mit sonnendurchfluteten Glücksmontagen abwechseln werden, dass am Ende der Reise vielleicht kein Regenbogen, aber eine Katharsis wartet: All das ist schon bei Abfahrt klar. Irgendwann mittendrin, in einem Bus, aus dem die beiden hinausgeworfen werden sollen, weil sie kein Geld mehr für eine Fahrkarte haben, da bricht es aus Beshay heraus, wie einst aus dem Elefantenmenschen: Ich bin ein Mensch, ruft er aus, ich bin ein Mensch!
Chiffre für Menschlichkeit

Dass diese „bewegende Szene“ hier kaum zu bewegen vermag, liegt wohl daran, dass der Film über seine gesamte Laufzeit wenig anderes macht, als genau das zu rufen. Yomeddine will ein Band zwischen uns und seinem Protagonisten stricken, aber wenn dieses Band aus nichts anderem besteht als unserer betroffenen Einsicht ins harte Leben des Anderen, hält es nicht lang. So leidet Shawkys Film an einem altbekannten Problem des wohlmeinenden Arthousekinos: Um seinen Protagonisten in der Menschenfamilie willkommen heißen zu können, muss er ihn zunächst ausschließen, muss diese Ausschließung wiederholen und verfestigen, Dramaturgie und Nebenfiguren um sie herum aufbauen, und wenn dieser Ausschluss dann endlich das ist, was Protagonisten wie Film hauptsächlich definiert, ist die Sache mit der Menschwerdung vertrackt, weil sie nur noch sehr asymmetrische Beziehungen herstellen kann. Das durchkreuzt schließlich den stolz vor sich hergetragenen Plan: Ist eine Figur nur mit den gröbsten Klötzen aus dem Baukasten des humanistischen Kinos konstruiert – ein Stigma, die zugehörige Ausgrenzung, der entsprechende Wunsch dazuzugehören und der Versuch, against all odds, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen –, dann wird diese Figur vielleicht zur Chiffre für Menschlichkeit, aber niemals zum Menschen.
Der Filmtitel bezeichnet den Tag des jüngsten Gerichts, den Tag, an dem dann endlich alle gleich sind, wie Beshay einmal frohlockt. Ein ähnlich religiöses Vertrauen scheint Shawky ins Kino zu haben: Es scheint keinerlei eigenständige Arbeit an der Herstellung des Gemeinsamen vollführen zu müssen. Yomeddine delegiert die Arbeit an eine abstrakte Menschlichkeit, die faul in der Nähe chillt, stets nur eine Dialogzeile, einen Gegenschuss oder eine Montage entfernt ist. Wir sind die Subjekte dieser Menschlichkeit, Beshay ist ihr Objekt. Obwohl sein vernarbtes Gesicht in jeder Szene Souverän über den Bildkader ist, ist er nie gänzlich präsent, weil er stets repräsentieren muss. Shawky verhilft Beshay nicht zum Ausdruck, er nimmt ihn in den Mangel, sperrt ihn dort ein und erklärt uns mit großem Aufwand, dass er trotz allem ja auch nur ein Mensch ist – obwohl das Kino gerade dazu da ist, dieses „nur“ mit Inhalten zu füllen.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Yomeddine“

Trailer ansehen (1)
Bilder



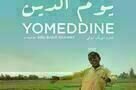
zur Galerie (4 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.








