Waldheims Walzer – Kritik
„Jetzt erst recht!“ Ruth Beckermann beschreibt in Waldheims Walzer den Verlauf einer nationalen Erregung und zeichnet dabei ein noch immer zeitgemäßes Bild der modernen Mediendemokratie.

In der kollektiven Erinnerung hat sich die Affäre um die Kriegsvergangenheit des österreichischen Bundespräsidentschaftskandidaten Kurt Waldheim aus dem Jahr 1986 zu einer Abfolge prägnanter Sätze verdichtet: „Wir nehmen zur Kenntnis, nicht Kurt Waldheim war bei der SA, sondern nur sein Pferd.“ – „Ich habe nur meine Pflicht getan, wie 100.000 andere Österreicher auch.“ Und, als Höhepunkt, das dreisilbige empörte Aufstampfen: „Jetzt erst recht!“. Diesen drei Slogans entsprechen auch unterschiedliche Phasen und Eskalationsstufen der damaligen Kontroverse: An ihrem Anfang stand die Aufdeckung, dass Waldheim in seinen öffentlichen Äußerungen und in seiner Autobiografie seine Stationierung auf dem Balkan und in Griechenland unterschlagen hatte – und damit die Frage, ob er seine Beteiligung an dort begangenen Kriegsverbrechen vertuschen wollte. Auf diese Anschuldigungen reagierte Waldheim nicht mit der gewissenhaften Aufarbeitung seines Kriegsdienstes, sondern vor allem mit einem irritierten Lächeln – nicht nur habe er sich nichts vorzuwerfen, er könne vielmehr stolz auf seinen Kriegsdienst sein, da er seine Pflicht als „anständiger Soldat“ erfüllt habe. Durch diese trotzige Zurückweisungshaltung verknüpfte Waldheim seine persönliche Vergangenheit mit der Vergangenheit des gesamten Staates – und kämpfte dafür, sich weiterhin einreden zu dürfen, dass man immer alles richtiggemacht und von all den schlimmen Dingen, die passiert waren, rein gar nichts gewusst hat. So mündete die Waldheim-Affäre schließlich in einer nationalen Erregung, die mit zunehmend aggressiver Energie jede Einforderung historischer Verantwortung als unerlaubte Einmischung von außen zurückwies – und die Waldheim schließlich zum Wahlsieg und ins Präsidentenamt trug.
Irgendwo noch eine Unordnung

Ruth Beckermanns Waldheims Walzer wirkt nun wie der Versuch, sich von all den historischen Deutungen und Interpretationen zu lösen, in die die Waldheim-Affäre während der vergangenen Jahrzehnte eingefasst wurde – nicht um diese Deutungen für falsch zu erklären oder gar zu revidieren, sondern um nachzuforschen, ob sich jenseits dieser festen Formen nicht doch noch ein zusätzlicher Sinn verbirgt, eine Unordnung, die man gedanklich noch nicht durchdrungen hat, eine Wunde, die trotz all der Jahre noch nicht ganz verheilt ist. Mit großer Genauigkeit und fast journalistischer Nüchternheit zeichnet Beckermanns Film den Verlauf der Kontroverse nach: Der Film will, bei allen anderen Interessen und gestalterischen Eigenheiten, auch informieren, will dieses bestimmte historische Ereignis auch all jenen verständlich machen, die es nicht selbst durchlebt haben oder mit dessen unmittelbaren Folgen aufgewachsen sind.
Diese Umsichtigkeit hat zur Folge, dass der biografische Bezug, den Beckermann zur Waldheim-Affäre hat, im Laufe des Films nur sehr sporadisch thematisiert wird. Die Regisseurin war, wie sie in ihrem Off-Kommentar berichtet, selbst an Protestaktionen gegen Waldheim beteiligt, und auch ein beträchtlicher Teil des verwendeten Filmmaterials wurde von ihr selbst zu jener Zeit gedreht. Doch dieser persönlichen Verwobenheit mit dem damaligen Geschehen wird nicht wirklich detailliert nachgegangen, und so gerät auch eine ganz bestimmte emotionale Auswirkung von Waldheims Wahlsieg aus dem Blick: das plötzliche Gefühl ganz vieler Österreicherinnen und Österreichern, dass ihnen die Mehrheit der Menschen im eigenen Land unerreichbar fremd waren.
Zurück zu den ursprünglichen Eindrücken
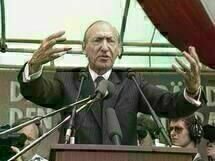
Bei aller Nüchternheit und bei aller umsichtigen Distanziertheit bricht in Waldheims Walzer immer wieder das starke Drängen durch, zu den ursprünglichen Eindrücken zurückzukehren, sich ganz dem Klang und der Erscheinungsweise der damaligen Ereignisse auszusetzen. So versinkt der Film förmlich in dem Anblick von Waldheims Händen, die bei einer Wahlkampfrede ganz ungelenk und eigentümlich steif hinaus in die Menge greifen – eine unbeholfene Geste, die in dieser Menge keinerlei Leidenschaft mehr entfachen muss, sondern die nur mehr den bereits geschürten Volkszorn einsammelt. Oder der Film beobachtet minutenlang das Gesicht von Waldheims Sohn, das bei der Anhörung durch einen amerikanischen Kongressausschuss ganz nachdenklich und gelassen wirkt, das aber in einem für das heimische Publikum bestimmten Fernsehinterview sofort etwas Schneidiges und Aggressives bekommt. Und dann entwickelt Waldheims Walzer seine Wucht manchmal auch gerade durch die Eindrücke, die er ausspart: Waldheims nomineller Gegner im Präsidentschaftswahlkampf, der SPÖ-Kandidat Kurt Steyrer, tritt in dem Film kein einziges Mal in Erscheinung, nur ganz kurz ist sein Name auf einem zerrissenen Zettel in einer Telefonzelle zu sehen. Gerade in dieser Lücke wird erfahrbar, dass die Waldheim-Affäre nicht in erster Linie eine Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen politischen Lagern war, sondern vor allem ein Kampf von Teilen der Zivilgesellschaft gegen die Verdrängung von historischer Schuld und Verantwortung – eine Verdrängung, die für sämtliche Parteien über viele Jahre hinweg zur Staatsräson geworden war.
Einer Volksseele wird ihr Geschunden-Sein eingeredet
In seiner Konzentration auf Fernsehbilder, auf öffentliche Auftritte und auf die Dynamik einzelner Slogans und Wahlkampfsprüche macht Beckermanns Film die Waldheim-Affäre vor allem auch als ein – noch immer zeitgemäßes – Medienphänomen erkennbar. Denn Waldheim und seine Unterstützer begegneten den erhobenen Anschuldigungen eben nicht in erster Linie auf inhaltlicher Ebene, durch Argumente und detaillierte Gegendarstellungen, sondern auf symbolischer Ebene, durch Wahlkampfveranstaltungen, die mit traditionellen Kleidern und Gesängen ausstaffiert waren, oder durch Empörungsformeln, die in Interviews und Pressekonferenzen beständig wiederholt wurden (und die voller antisemitischer Anklänge waren). Das Ziel war nicht, in einer Debatte um historische und persönliche Verantwortung diese oder jene Position zu beziehen, das Ziel war, die Einforderung einer solchen Debatte an sich schon als eine infame Respektlosigkeit darzustellen. Jeder Österreicher und jede Österreicherin sollte sich in Stolz und Ehre persönlich angegriffen fühlen und in der Wahl Waldheims einen existenziell zwingenden Akt der nationalen Selbstbehauptung sehen.
Vielleicht würden derartige Debatten um die NS-Zeit heutzutage einen anderen Verlauf nehmen, und vielleicht ist das hemmungslose Spiel mit antisemitischen Klischees auf oberster Staatsebene heute nicht mehr so uneingeschränkt möglich wie damals – man hofft es zumindest. Doch die Mobilisierung einer Volksseele, der man das Geschunden-sein, für das man Genugtuung fordert, zuerst noch einreden muss – diese Dynamik funktioniert heute genauso wie damals.
Neue Kritiken

Ungeduld des Herzens

Melania

Primate

Send Help
Trailer zu „Waldheims Walzer“



Trailer ansehen (3)
Bilder

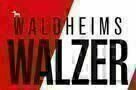


zur Galerie (5 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.











