Tag des Sieges – Kritik
Das Gedenken als Randerscheinung – Sergei Loznitsas Tag des Sieges beobachtet ein krampfhaft ungezwungenes Zusammensein und ein kollektives Schwelgen in nationaler Nostalgie.

Die eigentliche Gedenkfeier ist in Sergei Loznitsas Tag des Sieges nur eine Randerscheinung, ein wie aus rein protokollarischen Gründen festgehaltenes Detail. Die Feierlichkeiten zur Erinnerung an den Sieg der Roten Armee über Hitlerdeutschland, die jedes Jahr am 9. Mai am großen Ehrendenkmal im Treptower Park in Berlin abgehalten werden, sie enthüllen in Loznitsas Darstellung ihr eigentliches Wesen fernab der klagevollen Trompetenklänge, der andächtigen Schweigemomente oder der lautstarken Nennung gefallener Soldaten. Stattdessen beobachtet Tag des Sieges in langen und distanzierten Einstellungen, wie sich Menschen jeden Alters in Massen über das mehrere Hektar große Areal schieben, wie sie sich in lebendigen Gruppen zwischen den Reihen von Ehrengräbern versammeln, wie sie andächtig an den monumentalen, pyramidenförmigen Steinbauten vorbeimarschieren, Ansprachen halten und Lieder singen.
Dabei machen die unzähligen Hammer-und-Sichel-Flaggen, die Putin-T-Shirts und Stalin-Zeichnungen, die leidenschaftlich vorgetragenen Grußworte aus den separatistischen ukrainischen Regionen Donezk und Lugansk schnell deutlich: Nicht aus einem Gefühl der Verpflichtung den Toten gegenüber hat sich die Menge im Treptower Park versammelt, nicht aus einem Bedürfnis, sich durch rituelle Formen des Gedenkens mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, sondern vor allem aus der Lust an einem gemeinsamen Schwelgen in nationalistischer Nostalgie. Bei dieser Zusammenkunft steht nicht der individuelle Tod einzelner Soldaten im Mittelpunkt, sondern die Wiederauferstehung eines untergegangenen Weltreichs: hier zwischen den Trauerbirken und den Kalksteinreliefs, zwischen den Bronzestatuen und Granitblöcken soll die alte Sowjetunion erneut zum Leben erwachen – und sei es auch nur für einen Tag.
Wenn das innerste Gefühl vom Blatt abgelesen werden muss

Dabei schlägt Tag des Sieges jedoch nicht nur einen Tonfall der Empörung an, erhebt sich nicht einfach mit scharfem und einförmigem Urteil über all die ausgelassen feiernden Menschen, sondern wendet ihnen einen vielleicht befremdeten, aber darum nicht weniger neugierigen Blick zu. Dieses forschende Interesse wird am deutlichsten spürbar in den langen Sequenzen, in denen immer wieder neu zusammengesetzte Menschengruppen gezeigt werden, die gemeinsam und mit großer Leidenschaft russische Lieder singen – Lieder von Schlachten im Bürgerkrieg, Lieder von der alten Heimat Sowjetunion (in die explizit auch die Ukraine, Moldawien und das Baltikum einbezogen werden) und, immer und immer wieder, das russische Volkslied „Katjuscha“. Loznitsas Film gibt dem freudigen Überschwang dieses gemeinschaftlichen Singens, Klatschens und Tanzens dabei Raum und lässt ihn oft sogar mitreißend werden. Zugleich aber verharrt der Film dabei immer wieder auf Details wie den ausgedruckten Liedtexten, die gerade jene Menschen in Händen halten, die am lautesten und schwungvollsten mitsingen. Die Lieder, die dem äußeren Anschein nach doch aus dem tiefsten Herzen und der innersten Volksseele kommen sollen – sie müssen alle vom Blatt abgelesen werden.
Eine gespenstische Ausgelassenheit
So wirkt die demonstrative Freude in Tag des Sieges umso weniger lebendig, je energischer sie sich nach außen hin gibt. Dieser gespenstische Zug wird noch durch den Umstand verstärkt, dass hier etwas wiederbelebt werden soll, das gar nicht mehr leben kann, das eigentlich gar nicht mehr leben will. Denn der Zerfall der Sowjetunion war ja nicht in erster Linie ein historischer Zufall oder das Resultat einer klar benennbaren äußeren Einwirkung, die man einfach rückgängig machen könnte, er war vielmehr der Endpunkt eines langen Siechtums. Das Emblem aus Hammer und Sichel schien über die Jahrzehnte – nach dem Stalin’schen Gulag, nach den Panzereinsätzen in Budapest und Prag, nach der quälenden Sklerose der 70er- und frühen 80er-Jahre – seine moralische Unterfütterung und seine bindende Kraft zum größten Teil verloren zu haben, und so waren es schließlich auch die einzelnen Teilrepubliken selbst, die sich bei erster Gelegenheit so schnell wie nur irgend möglich von dem Staatengebilde der UdSSR loslösten. Die Fantasie einer Wiederzusammensetzung dieses Weltreichs sträubt sich somit gegen die politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten der realen Welt, ja gegen die Realität selbst – und ist daher, so fröhlich sie auch in Erscheinung treten mag, durchsetzt mit der Androhung von Zwang und Gewalt.
Der einzige Nagel, der noch trägt

Das freudige Zusammensein der feiernden Menschen vom 9. Mai wirkt zwar auf den ersten Blick wie eine offenherzige Einladung, an dem beglückenden Gefühl der Gemeinschaft teilzuhaben. Doch zugleich wird die fast manische Energie, mit der hier überall getanzt und gesungen wird, im Laufe des Films mehr und mehr zum Ausdruck einer tiefen Verunsicherung: Die Menschen hier scheinen zu wissen, dass ihre Sehnsucht nach der alten Sowjetunion nicht einfach der allgemein-menschliche Wunsch nach einem friedlichen und gerechten Zusammenleben ist, sondern nur eine private Herrschaftsfantasie – eine Selbstberauschung, die für Außenstehende im besten Fall irrelevant, im schlimmsten Fall bedrohlich ist.
Womöglich ist das der tiefere Grund, warum gerade der 9. Mai den Anlass für diese UdSSR-Festspiele gibt, warum sich die Menschen gerade an diesem Denkmal versammeln und warum sie sich so verzweifelt an den Sieg der Roten Armee über das Dritte Reich klammern: Dieser Sieg ist schlicht die einzige historische Errungenschaft der Sowjetunion, die auch deren ideologische Gegner nicht in Abrede stellen können. Und folglich kann sich nur in der Erinnerung an diesen Sieg ein auf die UdSSR gerichteter nationaler Pathos in das Gewand einer allgemeingültigen moralischen Notwendigkeit kleiden. Die gewaltige Masse der im Zweiten Weltkrieg gefallenen Sowjet-Soldaten ist für die im Treptower Park versammelten Menschen folglich nur ein Stichwortgeber: ein stabiler Nagel, an dem sie ihre nationalistischen Fantasien aufhängen können.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Tag des Sieges“
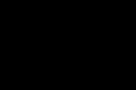

Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (5 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.









