Varda Par Agnès – Kritik
Auf Wiedersehen: In einem Film, von dem Agnès Varda womöglich wusste, dass es ihr letzter würde, kramt die französische Regisseurin im eigenen Fundus und stattet ihren Protagonisten einen liebevollen Besuch ab. Dann verschwindet sie im Sandsturm.

Varda Par Agnès hat mehr von einer Nachlassverwaltung als von einem schöpferischen Akt, der gleichberechtigt seinen Platz im Werk der Regisseurin einnimmt. Der Film findet keine neuen Bilder für ihr Lebenswerk, sondern setzt fast zur Gänze auf bereits bekanntes Material. Das Grundgerüst bilden öffentliche Auftritte Vardas, deren Kontext meist verborgen bleibt und die sie so zusammenschneidet, dass der Eindruck eines einzigen Auftritts entsteht. Der wiederum wird mit Filmausschnitten und einigen wenigen neu gedrehten Szenen bespickt.
Der vertraute Wechsel von Talking Heads und bebilderndem Archivmaterial mag konventionell sein, er entfaltet nichtdestotrotz einen Sog, denn Vardas Leben und Werk sind nun mal ein dankbarer Gegenstand, angefangen bei ihrem ersten Film, La Pointe Courte (1955), mit dem Varda, nach eigenen Angaben eine damals mit dem Medium des Films kaum vertraute junge Fotografin, die Nouvelle Vague einläutete. Vom Format her spricht die Regisseurin zwar ex cathedra, bezeichnet die Veranstaltungen aber lieber als „Plauderei“. Fast chronologisch mäandert sie von einem Film zum anderen, geht auf Besonderheiten der jeweiligen Arbeit ein und spannt zugleich den großen Bogen, in den sich alle ihre Werke einreihen.
Nichts ist banal

Varda Par Agnès hat etwas vom einem präzise orchestrierten Fest, bei dem die 2019 verstorbene Regisseurin ihre Liebsten um sich schart: Freunde, Weggefährten, Mitwirkende, Förderer, aber auch Protagonisten ihrer Fiktionen oder Dokumentationen, wobei bei Varda beides ineinander übergeht, im Grunde gar nicht voneinander zu trennen ist. Wer für Varda irgendwie von Bedeutung ist, so der Eindruck, findet sich früher oder später unter ihrer Regie oder vor ihrer Kamera wieder, setzt die Beziehung im Film fort. Jacques Demy, den Varda 1962 geheiratet hat, begegnen wir zum Beispiel in ihrer filmischen Verarbeitung seiner letzten Tage und in dem Film, den sie aus seinen Kindheitserinnerungen gewebt hat, Jacquot de Nantes (1991). Im Zentrum derer, die zu ihrer groß angelegten Rückschau einberufen werden, steht aber keine bestimmte Person, sondern die Person an sich. Nicht ihre Beliebigkeit spült sie Vardas Interesse – und damit ihrer Kamera – zu, sondern, im Gegenteil, ihre Einzigartigkeit, eine individuelle Einzigartigkeit, der sich Vardas Kunst verschrieben hat. Das Versprechen, dass jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat, dass nichts und niemand banal ist, „wenn man die Leute mit Empathie und Liebe filmt“.
Inspiration, Kreation, Teilen

Zu Gast ist auch Nurith Aviv, Vardas Kamerafrau in Daguerréotypes (1976). Aviv erzählt von den langen Sequenzen, die sie mit Varda in den Geschäften der Rue Daguerre in Paris gedreht hat, von ihrem Vorhaben, anders als in anderen Produktionen die Zeit nicht zu verdichten, sondern ihr ihren vollen Platz einzuräumen: die Zeit eben, die es braucht, ein Brot zu verkaufen. Der Blick, den man auf jemanden richtet, sagt Aviv, macht diese Person zu etwas Besonderem. Vardas Lebenswerk ist geprägt von einem Interesse für die Ränder, für das, was abseits der Aufmerksamkeit, abseits der Blicke ist: für Mona etwa, die junge Landstreicherin in Vogelfrei (1985), oder für jene Menschen, die Reste sammeln, nach der Ernte auf den Feldern oder nach dem Markt in der Stadt (Die Sammler und die Sammlerin, 2000).
„Nichts ist banal“, erwidert Varda auf Aviv, und hier hätte man sich mehr Ausführungen gewünscht, denn der Blick auf das vermeintlich Banale oder vermeintlich Nicht-Banale ist eine zentrale Frage in Vardas Schaffen. In ihrem vorletzten Film, Augenblicke – Gesichter einer Reise (2017), den sie gemeinsam mit JR inszeniert hatte, konnte man sich kaum des Eindrucks erwehren, dass dieser Blick nicht den Angeblickten besonders machte, sondern die Blickenden: diejenigen, die so gütig waren, ihre Aufmerksamkeit auf Unbekannte zu richten und diesen so zu Bekanntheit zu verhelfen. Doch die in diesem Sinne trefflich benannte „Plauderei“ von Varda by Agnès bleibt an der Oberfläche, begnügt sich damit, die Begriffstrias zu wiederholen, die die Regisseurin zu ihrem Leitbild erhoben hat: Inspiration, Kreation, Teilen.
Kokettieren mit der Vergänglichkeit
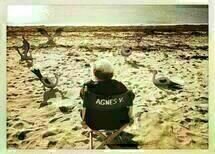
Auch bei Cléo macht Varda Halt, der jungen Protagonistin ihres zweiten Films Cléo – Mittwoch zwischen 5 und 7 (1962). Wenn es um ihr hohes Alter geht, ist Vardas Ton meist scherzend: „Ich bin neunzig, und das ist mir schnuppe.“ Doch mit Cléo, der jungen Frau, die zwei Stunden totschlagen muss, ehe sie eine lebensentscheidende Diagnose von ihrem Arzt erhält, drängt sich das Thema der Vergänglichkeit in die Rückschau. Auch der Auszug aus Augenblicke – Gesichter einer Reise ist ein Bild der Vergänglichkeit, nicht nur der Schaffenden, sondern auch des Werks: Varda zeigt ein Bild, das mühsam an einen Bunker angebracht und schließlich von der Flut weggespült wird. Dann lässt sie sich selbst von den Naturgewalten entführen und inszeniert einen Sandsturm: „Ich glaube, so beende ich diese Plauderei. Ich verschwinde in der Unschärfe. Ich verlasse Sie.“ Bis zuletzt ist der Ton verschmitzt, denn natürlich kokettiert Varda nur mit der Vergänglichkeit; weiß, dass ihr Werk – zu Recht – einen sicheren Platz in der Filmgeschichte hat und alles andere als Unschärfe hinterlässt.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Varda Par Agnès“


Trailer ansehen (2)
Bilder

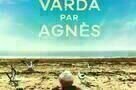


zur Galerie (12 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.













