To the Ends of the World – Kritik
Die letzten lebendigen Reste atmen die nasse Luft Französisch-Indochinas. Guillaume Nicloux hat mit To the Ends of the World einen Kriegsfilm an den Fransen der Welt gedreht.

Guillaume Nicloux ist im derzeitigen Kino einer der interessantesten Körperregisseure. Das begann mit Die Entführung des Michel Houellebecq (2014) und der Inblicknahme des titelgebenden französischen Schriftstellers als passiv-rebellierende, dauerrauchende Geisel unter herzallerliebsten Testosteronkriminellen, und setzte sich fort mit Valley of Love (2015) und The End (2016), zwei Filme, in denen sich Gérard Depardieu wie eine Hochleistungsmaschine durch lebensfeindliche Naturen rackert. Das Großartige an Nicloux’ Körperbildern ist, dass der Franzose es wie kaum ein anderer versteht, dem Kino selbst einen Körper zu geben, das Kino selbst als Körper zu denken, als einen Verkörperungsakt – der immer hinausläuft auf das Unförmige, Maßlose, Unabschätzbare und letztlich Schöne.
Ein zerfetzter Film
Mit seinem neuen Film To the Ends of the World (Les confins du monde) treibt Nicloux dieses Prinzip bis ins Unerträgliche. In diesem Film sehen wir nämlich nicht nur tote Leiber, wir sehen zugerichtete, zerstückelte, zu neuen Formationen reorganisierte Körper: Ein Haufen Leichenteile blutet auf dem Dschungelboden Französisch-Indochinas aus; ein Kopf ist an einem Ast aufgehängt, das Blut gerann an den schlaff heraushängenden Sehnen, die abgehackten Gebeine darunter sind zum runenhaften Ornament sortiert. Und während wir draufschauen auf solche Bilder, solche unmöglich identifizierbaren Leichenstückstapel, reißt der Film selbst entzwei. Ein Schwarzbild folgt, der Film wurde zerfetzt, er starb, es geht von Neuem los mit einer neuen Szene, als hätte man sie ihm wieder an den Leib genäht, als hätte man ihn operiert, diesen Filmkörper, der bis eben noch einer war, dann keiner mehr und dann ein neuer, wenngleich ein für immer blessierter, vernarbter, geflickter.
Das Leichenteil eines Leichenteils
Es ist nur folgerichtig, dass dieser Film mit einer Operation beginnt. Schwerverletzt wird der Soldat Robert Tassen (Gaspard Ulliel) von einem kleinen Mädchen in einer Urwaldhütte gesundgepflegt. Zuvor hat er eine Massenerschießung durch die Japaner überlebt, die 1943 Territorien im Norden des französischen Kolonialgebiets Indochina besetzt hatten. Tassen steigt aus dem Massengrab, das Blut läuft ihm aus dem Mund, er schiebt die Leichen von sich, unter denen er begraben liegt, hievt sich aus der Grube und schafft es, zu fliehen, bevor noch einmal in die Leichenmasse geschossen wird. Tassen ist selbst eine Art Leichenteil; nicht nur kein intakter Körper, sondern, brutaler noch, gar kein ganzer Körper mehr, aus dem Leichenhaufen gelöst wie ein übriggebliebenes, lebendiges Gebein. Sein Bruder hatte weniger Glück (vom Glück, am Leben zu sein, wird immer wieder geredet, der Tod und nicht das Leben ist der bestimmende Existenzzustand in dieser Welt), auch er wurde hingerichtet und starb. Tassen sinnt nach Rache, schließt sich einem neuen französischen Regiment an, wird abermals verletzt, überlebt abermals, hat abermals Glück und schleppt sich abermals zurück in diesen Film – als das Leichenteil eines Leichenteils gewissermaßen.
Das Gesicht von Gaspard Ulliel

Mit Gaspard Ulliel ist dieser Tassen – ganz im Nicloux’schen Körperdenken – perfekt besetzt. Sein Gesicht ist das vielleicht symmetrischste im französischen Darstellerangebot, selbst sein Bart wächst auf beiden Wangen identisch gespiegelt. Nur über die linke Wange zieht sich eine kleine Narbe, sie fällt aus der Symmetrie, unterscheidet die Gesichtshälften. Ulliel ist der Gesicht gewordene Film: schön und vernarbt, traurig und brutal, klarsichtig und verfinstert. Genau deshalb sucht die Kamera sowohl in der ersten als auch der letzten Einstellung von To the Ends of the World dieses Gesicht. Erst ein Soldat auf einer Bank in einem Militärlager, schwadenfeuchtes Wetter, massiges Naturrauschen, dann das Gesicht: Wir sehen hinein, es macht sich nackt und wir sind mitten drin in jenem Krieg in Französisch-Indochina, am Beginn der Ho-Chi-Minh-Ära – ein Krieg im Dickicht des Urwaldes, in einem schwitzigen Grün, in einem völlig undurchdringlichen (auch undurchdringbaren) Naturklangraum. Wenn hier Schüsse fallen – und sie fallen und treffen oft –, dann fallen sie mit unmäßiger Lautstärke, als sei dieser Krieg auch ein Klangkrieg gegen Flora und Fauna.
Depardieus Schutzraum
An diesen Ausfransungen der Welt, von denen der Titel des Films spricht, werden die drahtig-muskulösen Soldatenkörper, von denen Nicloux besessen ist, schlaff; das Opium hilft hinzu, die Augenlider senken sich, der Blick wird eng und verlangsamt sich. Tassen und seine Kameraden verlieren die Kontrolle über ihre Sensorik; der Filmkörper verliert die seine. Immer wieder findet To the Ends of the World dann zu Gérard Depardieu, der einen Schriftsteller spielt: Sein Hemd ist aufgeknöpft, der Körper arbeitet schwer, die Luft um ihn herum ist nass, lässt sich kaum atmen. Er sitzt auf einem Stuhl, blickt, wie nur er blickt, spricht, wie nur er spricht: von der Jugend, von seinem gefallenen Sohn, von Tassens inneren Dämonen. Depardieu ist der Ankerpunkt dieses Films, als wäre der Film bei ihm sicher, als könne ihm hier nichts geschehen – als könne Depardieu ihn heilen, diesen kaputten, semilebendigen, zerstückelt-geflickten Filmkörper. Aber der verzichtet und wird weiter malträtiert, zieht immer tiefer hinein in den Dschungel, wird immer wieder von einer Kugel zerfetzt, stolpert immer wieder über gestapeltes Gebein, Verwesungsdämpfe mischen sich in die Luftfeuchtigkeit. Ein Film, der stirbt und sein Sterben sichtbar, erlebbar macht – und ein Film, den wir nie lebendig kannten.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „To the Ends of the World“

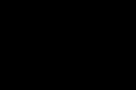


Trailer ansehen (4)
Bilder



zur Galerie (3 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Lusazia
Die Kritik ist sicherlich nicht weniger anstrengend, als der Film.
HAllein, wo ist das Gesicht symmetrisch? Weder Lippen noch Nase für sich allein sind es, wie dann das ganze Gesicht?
Frédéric
Symmetrischer als andere, würde ich sagen. So hab ich zumindest den Satz verstanden. Geht ja gerade davon aus, dass Gesichter das nicht sind und es deswegen ungewöhnlich ist, wenn sie teilweise doch so erscheinen.

















2 Kommentare