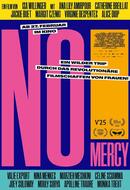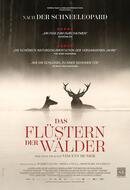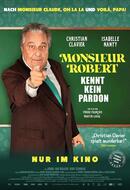The Terror – Kritik
Kälte, die die Haut vom Fleisch zieht: Die Serie The Terror folgt der Franklin-Expedition in die arktische Nacht, wo die Hybris der britischen Admiralität mit dem eisigen Hammer des Horrorgenres zerschlagen wird.

Eine Episode in Christoph Ransmayrs Roman Die Schrecken des Eises und der Finsternis beschreibt den vom Wahn ergriffenen Kartografen Julius von Payer dabei, wie er die unerreichbaren Polarinseln, die er am Horizont jenseits des Eismeers sieht, für sich erobert. In einer so pathetischen wie sinnlosen Geste schreit er in die Eiswüste hinaus, beschmeißt die Flecken im Niemandsland mit Namen. Der Wille, die Breitengrade zu überwinden, um eine Welt für Österreich-Ungarn zu erobern, entlädt sich in diesem letzten Versuch einer Bezwingung der Arktis.
Die Tugend des Empires

Eben dieser wahnhafte Entdeckergeist führte Expeditionen aus ganz Europa an den Polarkreis, im Glauben, dort eine neue Welt zu entdecken, zu unterwerfen, um damit den Ruhm des Vaterlandes zu mehren und den eigenen Namen berühmt zu machen. Die geläufigen Namen der Inseln des arktischen Archipels stehen noch heute als Zeuge für diesen exzessiven Forschungsgeist der Nordpolexpeditionen, besonders des britischen Empires.

Das Schicksal der Franklin-Expedition ist das wohl berüchtigtste Beispiel für die Tragödien, in denen viele der Polarreisen dieser Zeit endeten. The Terror begleitet die Royal-Navy-Schiffe „Erebus“ und „Terror“ nach Dan Simmons’ Romanvorlage auf der Suche nach der Nordwestpassage, die den Atlantischen Ozean im Norden Amerikas mit dem Pazifik verbindet. Expeditionsleiter John Franklin (Ciarán Hinds) und Captain James Fitzjames (Tobias Menzies) stehen ganz für den Geist der britischen Admiralität, die mit Verwegenheit und Disziplin das Eis zu erobern hofft. Captain Francis Crozier (Jared Harris), Franklins Stellvertreter, steht dem mit einer geradezu melancholischen Resignation gegenüber. Er vermag im Eis keinen Ruhm zu sehen, nur den lauernden Tod. Ein Gedanke, der in den Tiefen der sich verschiebenden, computer-generierten Eismassen als tiefes Grollen der Vorahnung widerhallt.
Vom Sterben im Eis

Das pittoresk-gleichförmige Meer der Eisschollen friert bereits in der Pilotepisode zu einer Formation, die weder Technologie noch Führungskraft der britischen Admiralität zu durchdringen vermögen. Erebus und Terror fressen sich langsam im Packeis fest, bis selbst TNT-Ladungen die Schiffe nicht mehr befreien können. Auf einen langen und dunklen Winter, der in nur einem Schnitt erzählt wird, folgt ein weiterer, noch härterer, noch eisigerer Winter. Mit ihm kündigt sich das Ende der Eroberungslust an: Die Kälte wird vom ständigen zum tödlichen Begleiter, zersetzt erbarmungslos die Körper der Seeleute, die bereits erste Erscheinungen von Seefahrtskrankheiten zeigen. Amputationen, gebrochene Gliedmaßen, offene Schädelwunden und Zähne, die sich aus dem schwarz verfaulten Zahnfleisch lösen, sind erst der Anfang des Schreckens, den die Polarnacht gleichermaßen über Offiziere und Crew bringt.

In der permanenten Dunkelheit zerschlägt Showrunner David Kajganich Technik und Werteüberlegenheit der britischen Admiralität mit dem eisigen Hammer des Horrorgenres. Nach der Ermordung eines Inuit-Schamanen trifft die Crew auf den fleischgewordenen Mythos der indigenen Bevölkerung, der in Form einer Kreatur Besatzung und Offiziere gleichermaßen verschlingt. In einer Szene, die exemplarisch für die Hybris der Royal Navy steht, deutet die Kamera die Anwesenheit des Monsters an, derweil Captain Franklin mit den Marines, die für die Jagd auf das Monster abgestellt wurden, vor den Ködern für ein Foto posiert. Auf die Perspektive der Kreatur folgt der Blick durch das Objektiv der Großformatkamera. Die Rotröcke verharren in ihrer heroischen Pose, während die Stoppuhr zur Belichtung tickt. Endlos scheint sich die Zeit zu dehnen, in der niemand etwas anderes vor Augen hat als die eigene Rolle im ruhmreichen Abenteuer in der Arktis. Mehr noch als das Monster, das nicht nur diese Pose in Stücke reißen wird, erklärt Kajganich die Kälte zum Feind. The Terror zeigt das Dahinsiechen im Eis als unentrinnbaren Bodyhorror.
Die Haut vom Fleisch gezogen

Bereits im Vorspann zieht die Kälte den Kapitänen der Royal Navy die Haut vom Schädel, legt frei, was sich hinter den prächtigen Uniformen und dem Ethos von Führung, Disziplin und Heldentum verbirgt: ein Körper, der nicht in das frostige Niemandsland gehört. So betont The Terror stets die Grenzen des menschlichen Körpers, die alle Forschungsreisenden im Zuge ihrer Hybris zu überwinden oder zumindest zu ignorieren versuchen. Eine Parallelmontage legt die Verbindung von Körper und Eis buchstäblich frei. Während die Segelschiffe das noch zugängliche Eis aufbrechen, öffnet Schiffschirurg Goodsir (Paul Ready) den Torso eines toten Matrosen. Wo die Technik einen Weg in das Eis bahnt, findet das Eis einen Weg in den Körper. Rot-bläulich setzen sich seine Spuren auf den erfrierenden Gesichtern Seefahrer ab, schwarz färbt es ihre Zehen, bis diese mit einer Art Geflügelschere abgeschnitten werden, und schließlich reißt es Captain Crozier beim Blick durch das Fernrohr die Haut von den Augenlidern. Das Eis hat die Expedition fest eingeschlossen. Jeder Blick in die Ferne, jeder Schritt zur Entdeckung der Nordwestpassage wird aussichtslos. Für Erebus und Terror gibt es nichts mehr zu erobern, nichts zu entdecken. In der Eiswüste wartet nur noch das Ende der Hybris.
Die Serie kann man bei Amazon streamen.
Neue Kritiken

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother

The Day She Returns

Prénoms
Trailer zu „The Terror“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (18 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.