The Sisters Brothers – Kritik
Jacques Audiard braucht keine starken Frauen, um den Chauvinismus des Westerns zu therapieren. Es reichen The Sisters Brothers ein paar schwache Männer und ein Chemiker, der vom Kommunismus träumt.

Ein eingespieltes Headhunter-Team wird im Oregon des Jahres 1851 beauftragt, einen wunderlichen Chemiker zu finden. Den Grund dafür kennen auch die titelgebenden Brüder Charlie und Eli Sisters nicht genau. Charlie weiß wenigstens, dass der Chemiker nicht sterben, eher ein bisschen gefoltert werden soll und dass ein weiterer Auftragshalunke namens John Morris schon mal vorgeritten ist, um ihn aufzuspüren, dingfest zu machen und den Brüdern zu übergeben. Dass das alles nicht klappen wird, davon kündet schon die Besetzung, die sich Jacques Audiard für seine Verfilmung von Patrick deWitts Roman ausgedacht hat.
Der Western geht den Bach runter

Denn Charlie Sisters tritt uns in Gestalt von Joaquin Phoenix entgegen und damit im Mantel des Exzesses. Phoenix’ Figuren trinken selten nur zum Spaß; schon bevor Charlie verkatert vom Pferd fällt, ahnen wir, dass der alkoholtrübe Blick unter diesen wuchtigen Augenbrauen labiler ist, als ihr Besitzer es wahrhaben will. Bruder Eli ist im Körper John C. Reillys gefangen, diesem ewigen Riesenbaby, das in The Sisters Brothers verdattert wie eh und je durch die Welt tapert, es mit der Gewalt nicht so hat und eigentlich schon an die Rente denkt. Und dann ist die Figur des John Morris auch noch bei Jake Gyllenhaal gelandet, in dessen Gesicht freundliches und psychopathisches Lächeln schon lange nicht mehr ineinander übergehen, sondern von vornherein ununterscheidbar sind. Lasst diese drei mal einen Typen namens Hermann Kermit Warm durch die Prärie jagen, und der straighte Westernplot geht den Bach runter.

Zumal es da, neben dem französischen Regisseur, ein weiteres Fremdelement in The Sisters Brothers gibt, das die Regeln der Frontier endgültig außer Kraft setzt. Hermann Kermit Warm, der eine chemische Formel entdeckt hat, die die Goldjagd revolutionieren wird, wird gespielt vom britisch-pakistanischen Riz Ahmed, und das so erratisch und daher verführerisch, so schüchtern und daher überzeugend, dass two-faced Gyllenhaal als John Morris bald die Seiten wechselt und sich dem Mann mit der Goldformel anschließt. Der träumt seinerseits allerdings gar nicht vom großen Reichtum, sondern von einer Art spirituellem Sozialismus in Dallas, Texas. Drei gegen einen wird zu zwei gegen zwei. Man ahnt, dass das nicht die letzte Verschiebung dieses Films sein wird.
Der Boss ist nur ein Name

Zuletzt verließen sich revisionistische Western auf eine produktive Störung des tradierten Geschlechterverhältnis durch starke Frauen, etwa in Jane Got a Gun (2015) oder im Berlinale-Wettbewerbsbeitrag Damsel (2018) der Zellner-Brüder. Bei Audiard ist selbst diese Störung Männersache. Ihm reicht der schelmisch mit Weiblichkeit aufgeladene Nachname, dazu Selbstzweifel, Selbstzerstörung, die ständige Erinnerung an die eigene Verwundbarkeit auch jenseits heroischer Duelle (manchmal ganz konkret: eines Nachts wandert eine Riesenspinne in Elis Mund und legt dort ein paar Eier). Überhaupt mal ein paar Westernhelden, die den kernigen Überzeugungston weglassen und mit zunehmend weicher Stimme über ihre Gefühle sprechen. Sich zur Ruhe zu setzen, davon träumt Eli mit dem gleichen Ernst wie einst Peter Fonda davon, nach Hause zu gehen, in The Hired Hand (1970), einem anderen Western, der lieber keiner sein wollte.

Ein weiterer Besetzungscoup ist mitverantwortlich für die allmähliche Unlust, die sich an Gesetz und Gewalt breitmacht. Blade-Runner-Star Rutger Hauer spielt den Commodore, den Auftraggeber aus Oregon, und das in kurzen Auftritten, ohne etwas zu sagen. Mehr ein Zeichen, das über der Handlung schwebt, als eine Figur, die in ihr eingewoben wäre, mehr Replikant als Mensch, sozusagen. Je weiter sich unsere vier Freunde von ihrem Startpunkt entfernen, je mehr sie miteinander sprechen, je weniger sie sich jagen, desto weniger scheint dieses Zeichen auf eine Materialität zu verweisen. Commodore ist irgendwann kein Boss mehr, sondern nur noch ein Wort.
Utopische Kräfte

Und so entgleiten dem Western allmählich die Gesichtszüge, lösen sich seine Zwangsneurosen in Luft auf. Irgendwann baden vier Männer im See, weit weg von ihren Auftraggebern und damit auch, dünkt ihnen erstmals, weit weg von ihren Aufträgen. Die Mission verliert sich, der Plot verläuft sich, das Genre franst aus. Überhaupt gibt es an den Rändern der Handlung viel mehr zu entdecken, warum also handeln? In einem Laden kauft Eli eine Zahnbürste und liest fasziniert die Gebrauchsanweisung. Später steht man staunend vor einem Wasserklosett. Im Film eines Franzosen über den amerikanischen Westen ist das natürlich ein grandioser Gag.

Aber die Hygienisierung des Westerns ist nur eine der deterritorialisierenden Kräfte, die The Sisters Brothers in den utopischen Abgrund reißen. Was ist der ganze rugged individualism, was sind die Cowboy-und-Indianer-Spiele noch wert, wenn man auf einmal solchen Komfort haben kann? Und dann künden die neu gegründeten Großstädte von so viel excitement, das nichts mit ungemütlichen Satteln und endlosen Märschen zu tun hat. Mit großen Augen läuft man durch San Francisco. Die neue Welt ist eine neue Welt.
Das ist die grundsätzliche Bewegung dieses komischen Westerns: Die Helden werden ins offene Land geschickt, aber eben nicht auf Schienen. Und so lauern dort nicht nur Gefahren und Hindernisse, die abzuwehren und zu überwinden sind, sondern auch Verführungen, Möglichkeiten, Ahnungen von einem ganz anderen Leben. Ein Leben, in dem das Gesetz nicht neu ausgehandelt werden muss, sondern auch gleich links liegen gelassen werden kann. Anarchie nicht als wilder Naturzustand, sondern als Versprechen.
Neue Kritiken

Primate

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail
Trailer zu „The Sisters Brothers“
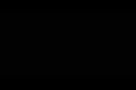
Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (18 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Lukas
ein fürchterlich öder film in meinen augen. riz ahmeds figur ist interessant, klar, auch in bezug zu früheren audiard-helden, aber es spricht doch bände, dass der film ihm so wenig raum lässt und dafür die beiden trüben brüder ihre drittklassigen mumblecoredialoge aufsagen lässt. vor allem irritiert mich, wie komplett lustlos das alles wirkt. ich meine, so viele gelegenheiten, einen echten western mit einem büdget von knapp 40 millionen zu drehen, gibt es heutzutage nicht mehr. und dann kommt nicht mehr bei rum als ein weiterer aufguss westernrevisionistischer klischees, die schon in den siebzigern alte hüte waren? ich würde ja ganz im gegenteil dafür plädieren: mehr neurosen wagen!

















1 Kommentar